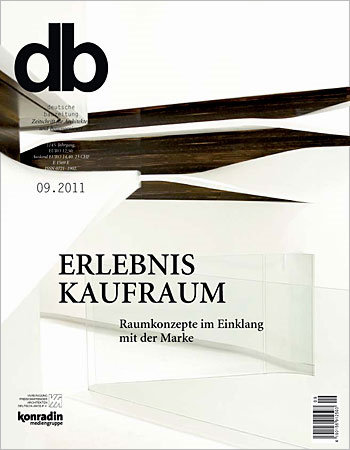Editorial
Die Architektur des Einzelhandels ist eines der flüchtigsten Phänomene der gebauten Umwelt. Nutzungen und Namen wechseln häufig. Trends und ganze Philosophien darüber, wie Verkaufsflächen zu gestalten seien, folgen einander in immer kürzeren Abständen. Produkte werden erfunden und wieder vom Markt genommen. Die Mode wechselt im Halbjahrestakt, wenn nicht öfter. Bezeichnend für diese Schnelllebigkeit ist das Phänomen der Pop-up Stores, die – wie jenes von Dr. Martens in Spitalfields Market (s. Bild links) – nur für kurze Zeit bestehen und auf spezielle Aktionen aufmerksam machen oder ohnehin nur Saisonartikel anbieten. Mit dieser Beschleunigung können Kunden und selbst die Händler kaum mehr Schritt halten.
Werte wie Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit gewinnen deshalb wieder an Bedeutung. Das heilig gehaltene Schlagwort »Erlebniswelt« erfährt eine Umdefinition weg vom spaßvollen Themenpark hin zum kommunikativen Wohlfühlort, der Begriff »Authentizität« macht die Runde. Um im gebauten Raum ein Gegengewicht zur Reizüberflutung zu schaffen, lassen sich am besten die Qualitäten atmosphärischer Orte im Gebäudebestand herausarbeiten und nutzen. Aber auch beim Neubau hängen Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit nicht von der Art des Dekors ab, sondern vielmehr davon, wie mit Oberflächenqualitäten, den Waren selbst und nicht zuletzt mit räumlichen Erlebnissen umgegangen wird. Eine Reihe von unterschiedlichen Ansätzen stellen wir auf den folgenden Seiten zur Diskussion. | Armin Geissinger
Luxus auf dem Land
(SUBTITLE) Erweiterung eines Damenmodengeschäfts in Telfs
Das alteingesessene Modehaus »Föger Woman Pure« erhielt auf einem schmalen Nachbargrundstück einen expressiven Anbau, der Schaufenster, Präsentationsraum und Laufsteg zugleich ist. Die kleinräumliche Gliederung des Altbaus wird dort in räumliche Opulenz überführt. Trotz fein ausgearbeiteter Details bedürfen der ruppige Charme der Oberflächen und die ungekannte Großzügigkeit des Anbaus seitens der Kundschaft noch einiger Gewöhnung.
Der alte Industrieort Telfs, eine 15 000-Einwohner-Gemeinde im Tiroler Oberland, hat keine kunsthistorischen Baudenkmäler aufzuweisen und nur wenige Zeugnisse beachtenswerter zeitgenössischer Architektur. Giebelhäuser mit Satteldach säumen die Hauptstraße. Und so wirkt das Schaufenster des Luxusmodengeschäfts wie ein Bote von einem fremden Stern.
Seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts beherbergt das unscheinbare dreigeschossige Haus an der Telfer Hauptstraße ein Textilgeschäft. Eine Vorfahrin hatte hier die von der längst verblichenen Textilindustrie erzeugten Stoffe in ihrem Resteladen auf 20 m² unter die Leute gebracht. Das Geschäft blieb in der Familie, die inzwischen an mehreren Fronten erfolgreich unternehmerisch tätig ist. Midi Moser-Föger erbte es vor über 20 Jahren, hat es nach und nach erweitert und dem Sortiment ein »Upgrade« verpasst. Vor einigen Jahren kaufte sie das angrenzende Wohnhäuschen, ließ es abreißen und an seiner Stelle im Vorjahr von Reto Pedrocchi ein spektakuläres Schaufenster errichten.
Das Medieninteresse war groß – und beabsichtigt. Wenn eine mutige Unternehmerin fernab der mondänen Nobelorte mit den exquisitesten Labels Geschäfte machen will, braucht sie Aufmerksamkeit.
Den Architekten hatte sie über ihre Verbindungen zu großen Pariser Modehäusern kennengelernt; als Projektleiter hatte er schon für Herzog & de Meuron den Prada-Flagshipstore in Tokio umgesetzt und für Comme des Garçons zwei »Guerillastores« in Basel. Pedrocchi war verblüfft, wie viel Entgegenkommen er vonseiten der lokalen Baubehörde erfuhr, nur Straßenflucht, Bauhöhe und v. a. der Rhythmus der Satteldachsilhouette waren einzuhalten.
Der im alpinen Raum eigentlich überall präsente und gefürchtete Ortsbildschutz ist in Telfs kein Thema – im Ort ist man bemüht, Leerstände im Zentrum zu vermeiden, ohne sich dabei auf Kebab, Pizza, Banken und Telefonshops zu beschränken.
Schaufenster im XXL-Format
Das Gesamtkonzept war einfach, es bestand lediglich darin, eine adäquate Hülle für anspruchsvolle Mode zu schaffen. Eigentlich ist es ein kleines Projekt mit nur 140 m² Nutzfläche, doch ein Entwurf von hoher Komplexität, wobei Struktur, Raum und Nutzung zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen. Das aus Dreiecksflächen zusammengefügte Betondach ist außen mit schwarzem Lochblech überzogen und hat die Form einer verschobenen Pyramide. Es schwebt bis 7,3 m hoch über einer lichten, stützenfreien Halle, die aufsteigend ihre räumliche Wirkung entfaltet. Der zur Straße hin leicht abfallende Raum wird an zwei Seiten von tragenden Wänden begrenzt, die Fassade besteht aus nach außen gekippten, in verschiedene geometrische Formen gebrochenen Glasflächen, Hocker aus Gummigranulat verhindern, dass sich die Fußgänger versehentlich am Glas stoßen. Der Zugang erfolgt über einen breiten Gang vom Altbau her, die frühere Eingangssituation wurde nicht verändert. Nichts stört die Offenheit des Raums, der sich von innen heraus entwickelt und letztlich so etwas wie ein begehbares Schaufenster bildet. Den Blickfang bilden zwei, auf halber Höhe den Raum querende Stahlbetonträger, die sich im spitzen Winkel kreuzen. Das Betonkreuz ist nicht nur statische Notwendigkeit, sondern auch Grundlage des flexiblen Raumkonzepts, die Hülle bleibt gleich, die Inhalte können sich ohne Verlust der architektonischen Qualität ändern. An langen Edelstahlhaken schwingen die Gewänder frei im Raum, begleitet von an der Wand entlangziehenden Ablagen für exquisite Accessoires. Die kargen, nüchternen Materialien Rohbeton, Glas und Edelstahl kontrastieren mit der warmen Farbe des Natursteinbodens. Das große Raumvolumen und die harten Oberflächen erzeugen einen starken Nachhall und damit die Wirkung eines hohen großen Raums. Kein aufdringlicher Raumduft und kein nervtötender Klangteppich stören. Für Kühlung und Belüftung sorgen Schlitze entlang der Fassade und eine Bodenheizung. Durch die hohen Scheiben fällt natürliches Licht und betont die Farbechtheit, Fluoreszenz-Leuchten führen über und unter dem Betonkreuz entlang und verborgene LED-Lichtstreifen beleuchten die Regale. Dank der Lichtführung verwandelt sich der Raum nachts in ein leuchtendes Prisma.
Die Umkleidekabinen, bei denen auch die Sanitäranlage angesiedelt ist, liegen hinter der Kuppel. Mit Oberlichtern versehen, weichem Teppichboden und grüngolden schimmernden Mosaiken formen sie eine intimere Atmosphäre.
Kunstwerke
Die museale Anmutung zeigt mit der Art der Hängung kreative Wege in der Warenpräsentation und verleiht den Schaustücken die Aura eines Kunstwerks, was auch ihrem Wert entspricht. Die rohen Oberflächen ohne »Innenarchitektur« bieten wenig Möglichkeiten für Veränderungen und sind per se ein Beispiel für Zeitlosigkeit, falls das Material in Würde altert.
Der Neubau als großes Schaufenster bereitet eine Bühne für die Kundinnen, die diese neugierig begutachten, aber noch kaum nutzen. Ebenso wenig wie die großzügigen Umkleidekabinen, zu deren Nutzung sie von den Verkäuferinnen auch nicht ermuntert werden. Das Neue ist Kontrast und Ergänzung zum eleganten, »wohnlichen« Altbau mit seinen Nischen und Ecken, der innen unverändert blieb, nur die Oberflächen wurden aufpoliert und die Böden geschliffen, denn die Kundinnen sind eher konservativ. Der äußere Zusammenhang zwischen Alt und Neu ist subtil inszeniert. Die Glasfront zieht sich über beide Teile und das Giebelhaus aus den 50er Jahren bekam statt des weißen einen dunkelgrauen Anstrich.
Was im Entwurf eine einfache, klare Lösung schien, war bei der Umsetzung mit viel Energie und Kraftaufwand verbunden. Das, so weiß Reto Pedrocchi, passiert ihm öfter, denn unkonventionelle Lösungen gehen an die Grenzen des Könnens und der Motivation. Die Probleme begannen beim Rechnen; zu viel Armierungseisen sei verbaut worden, glaubt er. Erwiesen ist, dass sich mehrere Firmen eine Umsetzung nicht zutrauten und dass die Innsbrucker Technische Fakultät mit der Kontrolle der statischen Berechnungen betraut wurde. Zum Glück hat sich das ortsansässige Architekturbüro Walch bei der Bauleitung sehr engagiert. Über die Kosten breitet sich ein Mantel des Schweigens, aber für ein solides Einfamilienhaus hätte es wohl gereicht.db, Mi., 2011.08.31
31. August 2011 Gretl Köfler
Spuren im Schnee
(SUBTITLE) Modegeschäft in Wien
Das neue Corporate Design eines Kitzbüheler Modelabels für Trachten, Ski- und Sportswear »versteckt« die Ladenfront hinter einer großen, weißen Wabenstruktur aus Mineralwerkstoff. Die Auffälligkeit im Stadtbild sowie die haptische Qualität des Materials führen fast zwangsläufig zum Näherkommen und Berühren – und zum Eintreten. Auch das Innere des Geschäfts ist fast vollständig mit Mineralwerkstoff ausgekleidet. Die Architekten bewiesen dabei nicht nur Mut, sondern auch Detailliebe und konstruktive Disziplin.
Die Wiener Ladenzeilen zu ebener Erde sind eine Stadt für sich. Während oben fein behauene Gründerzeitfassaden, barock anmutende Erker und gelegentlich sogar Versatzstücke aus der Belle Epoque in den Straßenraum ragen, regiert unten die beinharte Politik des Konsums. Man geht vorbei an riesigen Glasfassaden, an aufgespannten Kostümen ohne Preisschild, an Großfamilien von Schaufensterpuppen, die adrett gekleidet in Reih und Glied stehen und um Kunden buhlen.
Doch dann die Modeboutique »Sportalm«: Wie eine futuristische Bienenwabe steht plötzlich eine massive, löchrige Scheibe vor dem denkmalgeschützten Haus in der Brandstätte 8-10, nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt. Während einige Teile blickdicht sind, lassen insgesamt 148 sechseckige Aussparungen einen gefilterten Blick auf die bunten Sportanoraks und österreichischen Dirndl des Kitzbüheler Modeunternehmens zu. Das geheimnisvolle Portal aus der Zukunftswerkstatt macht neugierig und lädt ein näherzutreten.
»Genau das ist der Punkt«, sagt der Wiener Architekt Johannes Baar-Baarenfels. »Die gesamte Erdgeschosszone in der Wiener Innenstadt ist bereits weit aufgerissen. Mit einer einfachen Glasfassade fällt man hier unmöglich auf. Man erzielt keine Aufmerksamkeit, und die Leute laufen im Konsumrausch permanent an einem vorbei. Im Verstecken liegt der Reiz. Daher habe ich mich für diesen Bruch entschieden.«
Es ist ein Bruch mit der Tradition des Wiener Window-Shoppings, gewiss aber kein Bruch mit der eigenen Architektur. Denn Baar-Baarenfels reizt die Architektur seit dem ersten Tag seines Schaffens bis an die Grenzen ihrer materiellen und konstruktiven Machbarkeit aus. Viele Bauherren sind schockiert. Viele begeistert.
Die Fassade des durch und durch weißen Geschäfts besteht aus dem Mineralwerkstoff Corian. Insgesamt wurden vier Schichten miteinander verleimt und anschließend mittels einer CNC-Fräse in diese unverwechselbare Form geschnitten. Die wabenförmige Struktur ist jedoch keineswegs nur eine Frage der Optik. In den schmalen vertikalen und diagonalen Stegen versteckt sich ein rautenförmiges Flächentragwerk aus 6 mm dicken, gekanteten Edelstahlblechen. Die 8,40 x 5,00 m große Fassadenplatte, die ihrer Ausmaße wegen eines Nachts mit einem Sondertransport auf die Baustelle geliefert werden musste, ist damit selbsttragend. Auf zusätzliche Konstruktion konnte verzichtet werden.
Einziges Problem sind die Querkräfte. »Die Honeycomb-Struktur ist zwar selbsttragend, aber noch nicht stabil genug gegen horizontale Einflüsse«, erklärt Baar-Baarenfels. »Im Fall von starken Winden und Erdbeben würde sich die Fassade wie ein plötzlich beanspruchter Tennisschläger durchwölben, und die Glasscheiben würden brutal zerbersten.« Das Statikbüro werkraum wien errechnete eine horizontale Durchbiegung von 270 % gegenüber dem maximal zulässigen Grenzwert. Eine kalkulatorische Katastrophe. Erst durch die geschlossenen Felder, die scheinbar zufällig über die Fläche verteilt sind, konnte die nötige Steifigkeit erzielt werden.
Die sporadische Anordnung der amorph anmutenden Flächen ist dem Architekten nur recht: »Sieht willkürlich aus, ist es aber nicht. Eine wunderbare Genese.« In einer dieser blickdichten Füllungen prangt der Schriftzug des Geschäfts: »Sportalm Kitzbühel«. Die futuristische Schrifttype, seit langer Zeit Teil der Corporate Identity, passt perfekt zur Architektur. Durch die Ausfräsung der Buchstaben ist die Corian-Platte an dieser Stelle deutlich dünner. Untertags fällt der Geschäftsname durch die leichte Schattenwirkung auf, abends, wenn die Hinterleuchtung eingeschaltet ist, durchdringt ein diffuses Glimmen das Material.
Zum Eingang hin wird die Struktur etwas dichter. Wie ein organisches Gebilde zieht sich das Netz zusammen, täuscht dem Betrachter eine Perspektive vor, die es nicht gibt, und leitet den Passanten in dieser angedeuteten Wölbung schließlich zielgenau zum vollverglasten Eingang, in dem sich – in Form einer trapezförmigen Skulptur – ein letztes Mal die Raute wiederfindet. Der Griff liegt gut in der Hand. Es ist ein Spiel mit Nähe und Distanz, mit Einladung und Abweisung, mit Offenheit und Geschlossenheit. Letztlich, das liegt ganz im Sinne des kapitalistischen Gedankens, siegt die Öffnung. Also, hinein ins Geschäft!
Verfestigtes Winterbild
Auch innen dominiert die Farbe Weiß. Zu Füßen liegt ein heller Polyurethan-Boden, an den Wänden wabert abermals Mineralwerkstoff durch den Raum, in diesem Fall jedoch wich das wetter- und frostbeständige Corian dem etwas günstigeren Materialvetter Staron. Als hätte jemand eine intakte weiße Leinwand mit horizontalen Schlitzen massakriert, klafft das aufgeschnittene Material in den Raum, schmiegt sich mal um Mauervorsprünge, klappt sich dann wieder zu einer eleganten, homogenen Ablage auf. Es ist, als stünde man in einem dreidimensionalen Gemälde des italienischen Avantgarde-Künstlers Lucio Fontana.
»Das Bild, das wir von Kitzbühel haben, besteht aus Winter, Hahnenkamm-Rennen und dramatischen Schneewechten an den Hängen«, sagt Baar-Baarenfels in seiner für ihn so typischen konzeptionellen Dramatik. »Die weiß aufgeklappten Borde, aus deren Hintergrund wie ein Stück Erde dunkles Makassa-Holz durchschimmert, könnte man als Interpretation einer solchen Schneewechte auffassen.« Allein, in der Sportalm-Boutique sind die Schneeplatten mit allerlei High-Tech ausgestattet. In den 50 mm dicken Borden ist nicht nur die Hängevorrichtung für die Kleiderhaken integriert, sondern auch eine lineare LED-Leuchte, die direkt auf die Kleidung strahlt und auf diese Weise die Verschattung durch die vorstehenden Ablagefächer wieder neutralisiert. Das ist Disziplin bis ins kleinste Detail.
Hergestellt wurden die Borde aus einzelnen 6 mm dicken Mineralwerkstoff-Platten, die mittels thermischer Einwirkung zu diesen zweiachsig gekrümmten, um 90 ° verdrehten Hyperboloid-Flächen verformt wurden. Teils im Werk, teils vor Ort wurden die einzelnen Elemente miteinander verklebt und anschließend zu einer fugenlosen, samtig anmutenden Fläche verschliffen. Die Länge der Verdrehung ist von Bord zu Bord unterschiedlich. Insgesamt mussten für diesen Vorgang 60 Negativformen produziert werden. Baar-Baarenfels: »Das klingt zwar unwirtschaftlich. Wenn man aber bedenkt, dass die Filiale in Wien ein Prototyp ist und entsprechend oft nachgebaut wird, dann lässt sich so eine Investition wieder in einem anderen Licht betrachten.«
Und tatsächlich: Die ersten Nachfolge-Projekte in Salzburg, München, Düsseldorf, Karlsbad (CZ) und Moskau sind bereits eröffnet. Vor dem minimalistischen Hintergrund der neuen Concept Stores kommt die textile Ware – die Sportalm-Designer greifen gerne zu kräftigen Farben und üppigen Ornamenten – perfekt zur Geltung. Lediglich an Spiegeln, in denen sich die Kundinnen betrachten können, mangelt es im EG. Zu diesem Zweck müssen sie sich ins UG begeben. Der tageslichtlose Raum, der wie eine etwas weniger ambitionierte Kopie des EGs wirkt, birgt weitere Verkaufsflächen sowie drei großzügig bemessene Umkleideräume. Aufgrund der hohen Feuchtigkeit in den Außenmauern des Hauses muss das UG mit einem entsprechend hohen Luftwechsel belüftet werden.
Und was sagen die Verkäuferinnen zu ihrem neuen Geschäft? »Rein optisch ist die Architektur ein Hammer«, meint die Filialleiterin Evelyne Lebensorger. »Das ist eine futuristische Architektursprache, die in einem ganz schön großen Kontrast zu unserer Mode steht. Und es ist wie immer im Leben: Manche Kundinnen sind begeistert, anderen wiederum ist die Gestaltung zu kalt und zu unpersönlich.«
Lediglich an der Funktionalität stößt sich die Verkäuferin: »Das Konzept ist starr und entsprechend unflexibel. Und die Details sind zwar schön, aber man braucht etwas Übung, um die Kleiderhaken im richtigen Winkel aufhängen und entnehmen zu können. Da hat uns der Architekt die Latte ganz schön hoch gehängt.«
Auch in ganz anderer Hinsicht hängt die Latte hoch: Früher befand sich die Sportalm-Filiale im Haus schräg vis-à-vis in der Brandstätte 7-9. Seit dem Umzug ins neue Haus im September 2009 sind die Umsätze um 80 % gestiegen. »Immer wieder wird die Architektur in der Gesellschaft vieler anderer Faktoren als Soft Fact bezeichnet«, sagt Johannes Baar-Baarenfels. »Doch die Boutique Sportalm ist der handfeste Beweis dafür, dass Architektur ein wirtschaftlicher Hard Fact ist. Die Investitionskosten in der Höhe von knapp 1 Mio. Euro haben sich bald wieder amortisiert.« Ein sportliches Projekt.db, Mi., 2011.08.31
31. August 2011 Wojciech Czaja
Nahtstelle mit Geschichte
(SUBTITLE) Ladengeschäfte »im Viadukt« in Zürich
Unter zwei Eisenbahnviadukten im Kreis 5 entstanden hochwertige Ladenflächen und die erste Markthalle der Stadt. Die Architekten überführten mit typisch schweizerischem Minimalismus eine altbewährte Nutzung geschickt in die heutige Zeit. Die Räume unter den Steinbögen beziehen ihren Charme zum größten Teil aus der Massivität des historischen Mauerwerks und führen die angrenzenden Quartiere enger zusammen.
Seit mehr als 150 Jahren trennen zwei parallel verlaufende Bahnviadukte den Zürcher Stadtkreis 5 in zwei Teile. Während der niedrige Lettenviadukt nicht mehr gebraucht wird, fahren auf dem direkt angebauten hohen Wipkingerviadukt die Züge im Minutentakt. Seit letztem Jahr sind die Viadukte Schauplatz von Zürichs größter zusammenhängender Einkaufs- und Gewerbemeile. Auf einer Länge von 500 m bieten 49 Geschäfte und Restaurants in den neu ausgebauten Viaduktbögen ihre Produkte und Dienstleistungen an.
Hinter dem Projekt steht das Zürcher Architekturbüro EM2N. Seine Einbauten in die Bögen sind ein Symbol für den Wandel im Kreis 5. Denn durch die Neubebauung ehemaliger Fabrikareale wandelt sich der westliche Teil des Quartiers derzeit zur attraktiven Lage für Wohnungen und Büros.
Schon früher befanden sich unter den Viaduktbögen einfache Schuppen für Gewerbetreibende. Als die Viadukte vor einigen Jahren saniert wurden, mussten die Schuppen jedoch weichen. Im Quartier kamen Ängste auf, dass sich in den Bögen nur noch hochpreisige Geschäfte ansiedeln würden. Die Quartierbewohner wurden deshalb mit einbezogen, als die Stadt 2004 einen Architekturwettbewerb ausschrieb, den EM2N zusammen mit den Landschaftsarchitekten Zulauf Seippel Schweingruber (heute Schweingruber Zulauf) gewann. Als Investor für die Realisierung wurde die Stiftung PWG (Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich) beigezogen. Sie übernahm die Grundstücke im Baurecht von der Bahn.
Noch bevor die PWG mit im Boot war, trieb EM2N das Projekt auf teilweise eigenes Risiko voran und erarbeitete ein Vorprojekt.
Ein Risiko, das sich für die Architekten wie für den Kreis 5 gelohnt hat. Denn mit dem Projekt «Im Viadukt», wie die Neunutzung der Bögen offiziell heißt, hat das Quartier eine Lösung erhalten, die dem Ort gerecht wird und die Geschichte der Einbauten fortschreibt. »Wir haben uns an den alten, einfachen Einbauten orientiert und ähnlich pragmatische Lösungen gesucht«, sagt Marc Holle, verantwortlicher Partner bei EM2N. Wichtig war den Architekten, die charakteristischen Qualitäten des Viadukts »herauszuschälen« und dabei die Vernetzung des durch die Bahnanlagen zerteilten Quartiers zu ermöglichen.
Vibrationen und Toleranzen
Diese erfolgt auf zwei Ebenen und in zwei Richtungen. Von Nord nach Süd dient der Lettenviadukt als Verkehrsachse hoch über dem Quartier. Ein Fuß- und Radweg auf dem ehemaligen Gleisbett vernetzt die Naherholungsgebiete an der Limmat mit dem Park der Josefswiese und erlaubt den Nutzern einen Spaziergang oder eine Radfahrt in luftiger Höhe mitten durchs Quartier.
Insgesamt drei Aufgänge verbinden die neue Achse mit dem Straßenniveau. Die Gestaltung des Weges orientiert sich an der früheren Bahntrasse: Die Betonplatten des Fahr- und Gehwegs liegen direkt auf dem Schotterbett und erinnern an Bahnschwellen. Quer zum Viadukt erfolgt die Verbindung durch die bestehenden Straßendurchbrüche und durch die transparente Gestaltung der Einbauten.
Um das Sichtmauerwerk der Viadukte in die Räume einbeziehen zu können, musste EM2N verschiedene Herausforderungen meistern. Die Züge erzeugen Vibrationen und aufgrund von Bautoleranzen und der kurvigen Linienführung ist keiner der Bögen gleich. Jeder Einbau besteht aus zwei Teilen: Einem Raum unter dem niedrigeren Lettenviadukt und einem höheren, zweigeschossigen unter dem Wipkingerviadukt. Während das EG durch große Fenster den Bezug zum Fußgänger sucht, orientiert sich das Galeriegeschoss durch runde Oblichter in den Bogen des Wipkingerviadukts. Aufgelagert ist das aus Holz konstruierte Dach auf der Krone des Lettenviadukts und auf zwei Stahlstützen unter dem Wipkingerviadukt. Eine Erschütterungsdämmung unter der Bodenplatte dämpft die Vibrationen der Züge. Auf der Bodenplatte stehen auch die Stahlstützen und die gemauerten Seitenwände. Stürze aus Beton ermöglichen große Fensterfronten auf beiden Seiten der Läden. Die einzelnen Bögen erhielten einen einfachen Ausbau, der in von EM2N gewohnter Manier mit perfekt gelösten Details aufwartet: Alle Materialien und Formen wurden bewusst ausgewählt, um zusammen mit dem Mauerwerk des Viadukts ein austariertes Ganzes zu erhalten. Die Böden aus Hartbeton geben den Räumen einen Touch, der an die einstigen Gewerbebetriebe erinnert. Und die verzinkte Stahlkonstruktion von Treppe und Galeriegeschoss orientiert sich mit ihrem einfachen Staketengeländer und dem eingelegten Boden aus Holz an Bauteile, die man oft bei Brücken findet. Ein schwarzer, frei stehender Zylinder schließlich beherbergt die Toilette und bildet einen modernen Kontrapunkt zum Steingewölbe. Durch diese geschickte Kombination ist es EM2N gelungen, das Spezielle an diesem Ort herauszuarbeiten und das rohe Mauerwerk geschickt in ein stimmiges Gesamtbild einzubinden. Entstanden sind Läden mit einem Flair, wie man es nirgends in Zürich findet. Zusätzlich unterstützt wird die Atmosphäre durch das Rattern der Züge auf dem Viadukt – hier ist Zürich großstädtisch und Erinnerungen an die Berliner S-Bahn-Bögen werden wach.
Von außen präsentieren sich die Einbauten ebenfalls zurückhaltend: Das Mauerwerk ist hell gestrichen und die Beschriftung einheitlich. Dadurch bilden die Bögen trotz der Länge der Anlage eine Einheit, die man als Besucher beim Flanieren auf dem Weg entlang der Schaufenster auf der Westseite gut spürt. Die zurückhaltende Gestaltung resultiert aus einer Vorgabe der Denkmalpflege. Da die Viadukte unter Schutz stehen, waren auch keine größeren Leitungstrassen für eine zentrale Versorgung möglich, in das Galeriegeschoss jedes einzelnen Bogens wurde deshalb eine eigene Gasheizung integriert.
Doch die Gleichförmigkeit auf der Westseite täuscht. Nach Osten hin reagieren die Einbauten auf die unterschiedlichen Anforderungen der Bebauung. Im Abschnitt zwischen der Heinrich- und der Josefstraße beispielsweise reichen Wohnhäuser direkt an den Viadukt heran. Hier orientieren sich die Läden v. a. zur Westseite hin. Im Bereich der Josefswiese hingegen sind beide Seiten zugänglich, und die von der Stadt neu gestaltete Anlage dient als Außenraum für ein Restaurant in den Bögen. Eine spezielle Lösung wurde an der Limmatstraße gesucht, wo die beiden Viadukte sich trennen und eine dreieckige Fläche aufspannen. Hier brachte die PWG die Idee einer Markthalle ins Spiel. Die Architekten überspannten den freien Raum mit einem Dach, unter dem 1000 m² Fläche zur Verfügung stehen. Die ungewohnte, dunkelbraune, genoppte Außenbekleidung der Halle, die an den Bezug eines Ledersofas erinnert, ist Blickfänger für Passanten und bildet einen Kontrast zum schlichten Innern der Halle. Die Bekleidung ist auch ein Beispiel dafür, dass EM2N das Spiel mit ungewohnten Materialien perfekt beherrscht.
Obwohl die Zürcher Markthalle brandneu ist, bietet sie bereits viel Atmosphäre, einerseits durch das luftig wirkende Dach mit Oblichtern, andererseits durch die Viaduktbögen. Als Vorbild für das Nutzungskonzept fungierte die altehrwürdige Markthalle La Boqueria in Barcelona. Im zugehörigen Restaurant bilden zwei der Bögen großzügige Nischen, in denen die Gäste etwas abseits vom Trubel sitzen können. Riesige Kronleuchter, die direkt von den Bögen hängen, erzeugen in der Nacht eine Stimmung, die an den großen Speisesaal einer alten Burg erinnert. Ein Rahmen, der ankommt: Die Tische und die bunt zusammengewürfelten Stühle sind auch unter der Woche gut besetzt.
Durchdachtes Mietkonzept
Von den wichtigen Elementen des Konzepts ist die Architektur der Einbauten in den Bögen nur eines. Ebenso wichtig ist der Nutzermix. »Wir wollten die Bögen nicht einfach mit Geschäften und Restaurants füllen, sondern mit Nutzungen, die zur Entwicklung des Quartiers beitragen«, sagt Claudio Fetz, zuständig für die Projektentwicklung bei der PWG. Die Vermietung erfolgte deshalb nicht über Inserate, sondern man sprach die passenden Mieter direkt an. Jeder der vier Viaduktabschnitte wurde seiner räumlichen Qualität entsprechend vermietet: Im Abschnitt direkt angrenzend an die Markthalle, der aufgrund seiner Lage eine ruhige Flaniermeile bildet, sind v. a. Geschäfte mit Kleidern und Accessoires untergebracht. Auf Höhe der Josefswiese dominieren soziale und kulturelle Einrichtungen. Dahinter, wo die Anfahrt mit dem Auto möglich ist, finden sich Möbelhändler und direkt neben dem Gleisfeld der SBB ein trendiger Fahrradhändler, Ateliers oder die Räume eines Think-Tanks.
Alle Mieter profitieren von niedrigen Zinsen. Ein kompletter Bogen mit 150 m² Fläche kommt pro Monat auf 2500 bis 3200 Franken (ohne Nebenkosten).
Die Umnutzung ist mit der Eröffnung noch nicht abgeschlossen. Parallel zum Wandel im Quartier wird sich auch das Angebot anpassen müssen. In zehn Jahren ist beispielsweise die Stilllegung der Müllverbrennungsanlage auf Höhe der Josefswiese geplant, und gegenüber der Markthalle ziehen 2012 die ersten Bewohner im ehemaligen Löwenbräuareal ein. Der einfache Ausbau sowie die vielseitige Nutzbarkeit der Bögen sind in dieser Situation ein Trumpf: Sie erlauben es, rasch und flexibel zu reagieren – ein Stück nachhaltige Architektur, das die einst trennenden Viadukte zu einer wichtigen Nahtstelle gemacht hat.db, Mi., 2011.08.31
31. August 2011 Reto Westermann