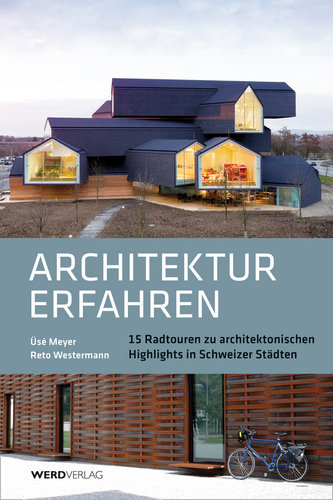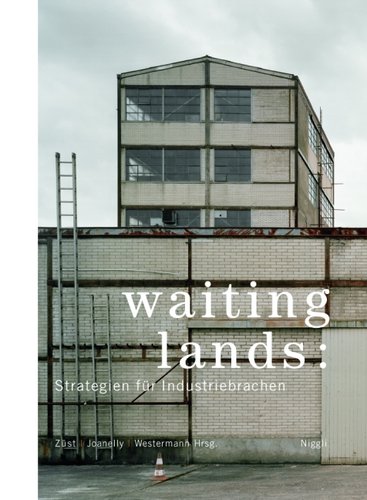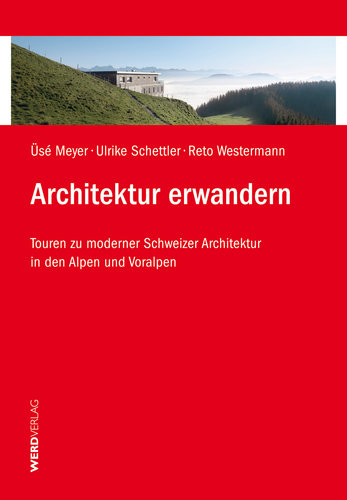Nahtstelle mit Geschichte
Unter zwei Eisenbahnviadukten im Kreis 5 entstanden hochwertige Ladenflächen und die erste Markthalle der Stadt. Die Architekten überführten mit typisch schweizerischem Minimalismus eine altbewährte Nutzung geschickt in die heutige Zeit. Die Räume unter den Steinbögen beziehen ihren Charme zum größten Teil aus der Massivität des historischen Mauerwerks und führen die angrenzenden Quartiere enger zusammen.
Unter zwei Eisenbahnviadukten im Kreis 5 entstanden hochwertige Ladenflächen und die erste Markthalle der Stadt. Die Architekten überführten mit typisch schweizerischem Minimalismus eine altbewährte Nutzung geschickt in die heutige Zeit. Die Räume unter den Steinbögen beziehen ihren Charme zum größten Teil aus der Massivität des historischen Mauerwerks und führen die angrenzenden Quartiere enger zusammen.
Seit mehr als 150 Jahren trennen zwei parallel verlaufende Bahnviadukte den Zürcher Stadtkreis 5 in zwei Teile. Während der niedrige Lettenviadukt nicht mehr gebraucht wird, fahren auf dem direkt angebauten hohen Wipkingerviadukt die Züge im Minutentakt. Seit letztem Jahr sind die Viadukte Schauplatz von Zürichs größter zusammenhängender Einkaufs- und Gewerbemeile. Auf einer Länge von 500 m bieten 49 Geschäfte und Restaurants in den neu ausgebauten Viaduktbögen ihre Produkte und Dienstleistungen an.
Hinter dem Projekt steht das Zürcher Architekturbüro EM2N. Seine Einbauten in die Bögen sind ein Symbol für den Wandel im Kreis 5. Denn durch die Neubebauung ehemaliger Fabrikareale wandelt sich der westliche Teil des Quartiers derzeit zur attraktiven Lage für Wohnungen und Büros.
Schon früher befanden sich unter den Viaduktbögen einfache Schuppen für Gewerbetreibende. Als die Viadukte vor einigen Jahren saniert wurden, mussten die Schuppen jedoch weichen. Im Quartier kamen Ängste auf, dass sich in den Bögen nur noch hochpreisige Geschäfte ansiedeln würden. Die Quartierbewohner wurden deshalb mit einbezogen, als die Stadt 2004 einen Architekturwettbewerb ausschrieb, den EM2N zusammen mit den Landschaftsarchitekten Zulauf Seippel Schweingruber (heute Schweingruber Zulauf) gewann. Als Investor für die Realisierung wurde die Stiftung PWG (Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich) beigezogen. Sie übernahm die Grundstücke im Baurecht von der Bahn.
Noch bevor die PWG mit im Boot war, trieb EM2N das Projekt auf teilweise eigenes Risiko voran und erarbeitete ein Vorprojekt.
Ein Risiko, das sich für die Architekten wie für den Kreis 5 gelohnt hat. Denn mit dem Projekt «Im Viadukt», wie die Neunutzung der Bögen offiziell heißt, hat das Quartier eine Lösung erhalten, die dem Ort gerecht wird und die Geschichte der Einbauten fortschreibt. »Wir haben uns an den alten, einfachen Einbauten orientiert und ähnlich pragmatische Lösungen gesucht«, sagt Marc Holle, verantwortlicher Partner bei EM2N. Wichtig war den Architekten, die charakteristischen Qualitäten des Viadukts »herauszuschälen« und dabei die Vernetzung des durch die Bahnanlagen zerteilten Quartiers zu ermöglichen.
Vibrationen und Toleranzen
Diese erfolgt auf zwei Ebenen und in zwei Richtungen. Von Nord nach Süd dient der Lettenviadukt als Verkehrsachse hoch über dem Quartier. Ein Fuß- und Radweg auf dem ehemaligen Gleisbett vernetzt die Naherholungsgebiete an der Limmat mit dem Park der Josefswiese und erlaubt den Nutzern einen Spaziergang oder eine Radfahrt in luftiger Höhe mitten durchs Quartier.
Insgesamt drei Aufgänge verbinden die neue Achse mit dem Straßenniveau. Die Gestaltung des Weges orientiert sich an der früheren Bahntrasse: Die Betonplatten des Fahr- und Gehwegs liegen direkt auf dem Schotterbett und erinnern an Bahnschwellen. Quer zum Viadukt erfolgt die Verbindung durch die bestehenden Straßendurchbrüche und durch die transparente Gestaltung der Einbauten.
Um das Sichtmauerwerk der Viadukte in die Räume einbeziehen zu können, musste EM2N verschiedene Herausforderungen meistern. Die Züge erzeugen Vibrationen und aufgrund von Bautoleranzen und der kurvigen Linienführung ist keiner der Bögen gleich. Jeder Einbau besteht aus zwei Teilen: Einem Raum unter dem niedrigeren Lettenviadukt und einem höheren, zweigeschossigen unter dem Wipkingerviadukt. Während das EG durch große Fenster den Bezug zum Fußgänger sucht, orientiert sich das Galeriegeschoss durch runde Oblichter in den Bogen des Wipkingerviadukts. Aufgelagert ist das aus Holz konstruierte Dach auf der Krone des Lettenviadukts und auf zwei Stahlstützen unter dem Wipkingerviadukt. Eine Erschütterungsdämmung unter der Bodenplatte dämpft die Vibrationen der Züge. Auf der Bodenplatte stehen auch die Stahlstützen und die gemauerten Seitenwände. Stürze aus Beton ermöglichen große Fensterfronten auf beiden Seiten der Läden. Die einzelnen Bögen erhielten einen einfachen Ausbau, der in von EM2N gewohnter Manier mit perfekt gelösten Details aufwartet: Alle Materialien und Formen wurden bewusst ausgewählt, um zusammen mit dem Mauerwerk des Viadukts ein austariertes Ganzes zu erhalten. Die Böden aus Hartbeton geben den Räumen einen Touch, der an die einstigen Gewerbebetriebe erinnert. Und die verzinkte Stahlkonstruktion von Treppe und Galeriegeschoss orientiert sich mit ihrem einfachen Staketengeländer und dem eingelegten Boden aus Holz an Bauteile, die man oft bei Brücken findet. Ein schwarzer, frei stehender Zylinder schließlich beherbergt die Toilette und bildet einen modernen Kontrapunkt zum Steingewölbe. Durch diese geschickte Kombination ist es EM2N gelungen, das Spezielle an diesem Ort herauszuarbeiten und das rohe Mauerwerk geschickt in ein stimmiges Gesamtbild einzubinden. Entstanden sind Läden mit einem Flair, wie man es nirgends in Zürich findet. Zusätzlich unterstützt wird die Atmosphäre durch das Rattern der Züge auf dem Viadukt – hier ist Zürich großstädtisch und Erinnerungen an die Berliner S-Bahn-Bögen werden wach.
Von außen präsentieren sich die Einbauten ebenfalls zurückhaltend: Das Mauerwerk ist hell gestrichen und die Beschriftung einheitlich. Dadurch bilden die Bögen trotz der Länge der Anlage eine Einheit, die man als Besucher beim Flanieren auf dem Weg entlang der Schaufenster auf der Westseite gut spürt. Die zurückhaltende Gestaltung resultiert aus einer Vorgabe der Denkmalpflege. Da die Viadukte unter Schutz stehen, waren auch keine größeren Leitungstrassen für eine zentrale Versorgung möglich, in das Galeriegeschoss jedes einzelnen Bogens wurde deshalb eine eigene Gasheizung integriert.
Doch die Gleichförmigkeit auf der Westseite täuscht. Nach Osten hin reagieren die Einbauten auf die unterschiedlichen Anforderungen der Bebauung. Im Abschnitt zwischen der Heinrich- und der Josefstraße beispielsweise reichen Wohnhäuser direkt an den Viadukt heran. Hier orientieren sich die Läden v. a. zur Westseite hin. Im Bereich der Josefswiese hingegen sind beide Seiten zugänglich, und die von der Stadt neu gestaltete Anlage dient als Außenraum für ein Restaurant in den Bögen. Eine spezielle Lösung wurde an der Limmatstraße gesucht, wo die beiden Viadukte sich trennen und eine dreieckige Fläche aufspannen. Hier brachte die PWG die Idee einer Markthalle ins Spiel. Die Architekten überspannten den freien Raum mit einem Dach, unter dem 1000 m² Fläche zur Verfügung stehen. Die ungewohnte, dunkelbraune, genoppte Außenbekleidung der Halle, die an den Bezug eines Ledersofas erinnert, ist Blickfänger für Passanten und bildet einen Kontrast zum schlichten Innern der Halle. Die Bekleidung ist auch ein Beispiel dafür, dass EM2N das Spiel mit ungewohnten Materialien perfekt beherrscht.
Obwohl die Zürcher Markthalle brandneu ist, bietet sie bereits viel Atmosphäre, einerseits durch das luftig wirkende Dach mit Oblichtern, andererseits durch die Viaduktbögen. Als Vorbild für das Nutzungskonzept fungierte die altehrwürdige Markthalle La Boqueria in Barcelona. Im zugehörigen Restaurant bilden zwei der Bögen großzügige Nischen, in denen die Gäste etwas abseits vom Trubel sitzen können. Riesige Kronleuchter, die direkt von den Bögen hängen, erzeugen in der Nacht eine Stimmung, die an den großen Speisesaal einer alten Burg erinnert. Ein Rahmen, der ankommt: Die Tische und die bunt zusammengewürfelten Stühle sind auch unter der Woche gut besetzt.
Durchdachtes Mietkonzept
Von den wichtigen Elementen des Konzepts ist die Architektur der Einbauten in den Bögen nur eines. Ebenso wichtig ist der Nutzermix. »Wir wollten die Bögen nicht einfach mit Geschäften und Restaurants füllen, sondern mit Nutzungen, die zur Entwicklung des Quartiers beitragen«, sagt Claudio Fetz, zuständig für die Projektentwicklung bei der PWG. Die Vermietung erfolgte deshalb nicht über Inserate, sondern man sprach die passenden Mieter direkt an. Jeder der vier Viaduktabschnitte wurde seiner räumlichen Qualität entsprechend vermietet: Im Abschnitt direkt angrenzend an die Markthalle, der aufgrund seiner Lage eine ruhige Flaniermeile bildet, sind v. a. Geschäfte mit Kleidern und Accessoires untergebracht. Auf Höhe der Josefswiese dominieren soziale und kulturelle Einrichtungen. Dahinter, wo die Anfahrt mit dem Auto möglich ist, finden sich Möbelhändler und direkt neben dem Gleisfeld der SBB ein trendiger Fahrradhändler, Ateliers oder die Räume eines Think-Tanks.
Alle Mieter profitieren von niedrigen Zinsen. Ein kompletter Bogen mit 150 m² Fläche kommt pro Monat auf 2500 bis 3200 Franken (ohne Nebenkosten).
Die Umnutzung ist mit der Eröffnung noch nicht abgeschlossen. Parallel zum Wandel im Quartier wird sich auch das Angebot anpassen müssen. In zehn Jahren ist beispielsweise die Stilllegung der Müllverbrennungsanlage auf Höhe der Josefswiese geplant, und gegenüber der Markthalle ziehen 2012 die ersten Bewohner im ehemaligen Löwenbräuareal ein. Der einfache Ausbau sowie die vielseitige Nutzbarkeit der Bögen sind in dieser Situation ein Trumpf: Sie erlauben es, rasch und flexibel zu reagieren – ein Stück nachhaltige Architektur, das die einst trennenden Viadukte zu einer wichtigen Nahtstelle gemacht hat.
db, Mi., 2011.08.31
verknüpfte Zeitschriften
db 2011|09 Erlebnis Kaufraum