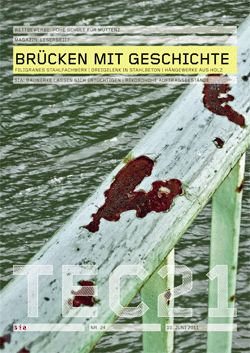Editorial
Wir stellen in dieser neuesten Ausgabe von TEC21 drei Brücken vor, die kürzlich instandgesetzt wurden - jede für sich ist erhaltenswert, ob aufgrund vorwiegend materieller oder immatiereller Werte. Anlass für die Publikation sind die Einführungskurse zur neuen Normenreihe SIA 269 «Erhaltung von Tragwerken». Zwar machen Brücken vom Wiederbeschaffungswert der schweizerischen Bausubstanz von knapp 2400 Mrd. Fr. nur etwa 50 bis 80 Mrd. Fr. aus und sind demnach nur ein kleiner Bereich in der Erhaltung von Tragwerken.[1] Allerdings sind sie aus Ingenieursicht wohl die spektakulärsten Vertreterinnen.
Jede der drei vorgestellten Brücken erzählt ihre eigene Geschichte in ihrem spezifischen Umfeld: die Haggenbrücke mit ihrem stählernen Fachwerk über das tief eingeschnittene Sittertal («Filigranes Stahlfachwerk»), die Garstattbrücke von Maillart mit ihrem Dreigelenkbogen aus Stahlbeton im ländlichen Simmental («Dreigelenk in Stahlbeton») und die hölzerne Spreuerbrücke mit ihren Hängewerken als Wahrzeichen der Innenstadt von Luzern («Hängewerke aus Holz»).
Nach einer meist beachtlichen Nutzungsdauer stellt sich bei vielen Brücken die Frage der weiteren Nutzung: Entspricht die erhaltene Brücke den aktuellen Anforderungen, oder sind Anpassungen notwendig? Soll die Brücke rückgebaut werden oder erhalten bleiben? Sind die erforderlichen Eingriffe bezüglich Aufwand und Nutzen verhältnismässig? Manchmal ist der architektonische bzw. denkmalpflegerische Spielraum bei der Beantwortung dieser Fragen nur klein, da technische Argumente (gerechtfertigterweise?) im Vordergrund stehen. Kann dann der Eingriff noch substanzschonend vorgenommen und das Erscheinungsbild beibehalten werden? Wie sollen Ingenieure zum Beispiel mit alten Nieten umgehen, wie mit 500 Jahre altem Holz oder wie mit Stampfbeton, der damals ohne Zusatzmittel verarbeitet wurde? Mit der Erhaltungsplanung stellt sich also die Frage nach dem Erhaltungswert des Bauwerks. Das im Jahr 2000 erschienene Merkblatt 2017 des SIA gibt eine Anleitung zur Ermittlung dieses Wertes von Einzelbauwerken. Letzlich liegt aber die Entscheidung, ob und welche Massnahmen zutreffend sind, im Ermessen der Entscheidungsträger. Es stellen sich viele Fragen, die sich nicht alle objektiv beantworten lassen. Ein Urteil über die Instandsetzungsarbeit von Bauwerken sollte sich darum jeder selber (vor Ort) bilden - auch von diesen drei Brücken, die exemplarisch für viele in der Schweiz stehen.
Clementine van Rooden
Anmerkung:
[01] Fokusstudie des Nationalen Forschungsprogramms «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung», NFP 54, und ergänzende Hinweise von Eugen Brühwiler, Prof. Dr., EPF Lausanne
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Hohe Schule für Muttenz
10 PERSÖNLICH
Adrien Tirtiaux: «Wir denken alle rational»
14 MAGAZIN
Leserbrief
18 FILIGRANES STAHLFACHWERK
Felix Gisler, Jörg Habenberger, Dorothée Braun Haggenbrücke: Der Steg über das Sittertal bei St. Gallen war seit seiner Eröffnung 1937 schwingungsanfällig. Nach der Instandsetzung vor einem Jahr wird die Brücke den aktuellen Anforderungen endlich gerecht.
22 DREIGELENK IN STAHLBETON
Martin Diggelmann, Olivier Bolliger Garstattbrücke: Die Strassenbrücke im Simmental, die Maillart 1939 gebaut hatte, entsprach nicht mehr den aktualisierten Anforderungen. Die letztjährige Instandsetzung ermöglicht nun die weitere Nutzung auch für 40-Tonner.
26 HÄNGEWERKE AUS HOLZ
Josef Müller, Cony Grünenfelder Spreuerbrücke: Die in ihrer heutigen Form auf das Jahr 1566 zurückgehende Fussgängerbrücke in Luzern ist kürzlich instand gesetzt worden, denn die Konstruktion war nach vielen Nutzungsjahren überbeansprucht.
33 SIA
Bauwerke lassen sich ertüchtigen | Rekordhohe Auftragsbestände
37 FIRMEN
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Korrodiertes Geländer einer Brücke, das einer Instandsetzung bedarf (Foto: photocase/Bearbeitung: Red.)
Filigranes Stahlfachwerk
Die 1937 eröffnete und vom Luzerner Bauingenieur Rudolf Dick gebaute Haggenbrücke über die Sitter bei St. Gallen ist einer der höchsten Fussgängerstege in Europa. Bereits bei der Einweihung aber erwies sie sich als sehr schwingungsanfällig, sodass sie auch nach Nachbesserungen nur teilweise für die vorgesehene Nutzung freigegeben werden konnte. Von 2009 bis 2010 setzten Basler & Hofmann das Bauwerk instand – unter strengen technischen Anforderungen und ebensolchen Auflagen seitens des Umwelt und Denkmalschutzes sowie mit akrobatischen Arbeitsbedingungen.
Richtig freuen konnten sich die Gäste bei der Einweihung der vom Luzerner Bauingenieur Rudolf Dick erbauten Haggenbrücke am 24. Oktober im Jahr 1937 kaum: Die Menschenmassen, die das spektakuläre Bauwerk mit seinen bis zu 80 m hohen Stützen besichtigen wollten, versetzten die Brücke in starke Schwingungen (Abb. 1). Schnell kamen Zweifel an ihrer Tragsicherheit auf. Dick bemass die Profile des ursprünglichen Fachwerks sehr knapp und stufte sie äusserst fein ab, um das dazumal wertvolle Material effizient einzusetzen. Projektänderungen während der Ausführung, wie die Vergrösserung der Spannweite eines Feldes, erhöhten die Ausnutzung der Querschnitte zusätzlich. Fritz Stüssi, damals Professor an der ETH Zürich, stellte mit einer statischen Überprüfung fest, dass die Bemessung nicht nur knapp war, sondern die zulässige Spannung in einzelnen Fachwerkstäben überschritten wurde. Bereits zwei Jahre nach dem Eröffnungsfest wurden deshalb einzelne Diagonalen und Gurtstäbe im Endfeld des Oberbaus sowie Stützenköpfe und Stützen verstärkt. Weil das Schwingungsverhalten damit aber nicht verbessert werden konnte, durfte die Brücke, die ursprünglich für Fuhrwerke bis zu 8 t ausgelegt war, in der Folge nur noch mit Ausnahmegenehmigung befahren werden und diente vor allem als Fuss- und Veloverbindung zwischen den beiden Gemeinden St. Gallen und Stein im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Der Volksmund nannte die Brücke passend «Ganggelibrogg».
Zustandserfassung 70 Jahre später – im Jahr 2007 – wiesen Fahrbahnplatte und Fundamente Schäden auf. Zwar war der Korrosionsschutz der Stahlkonstruktion in den 1980er-Jahren erneuert worden, sie zeigte aber bereits wieder starke Verschleisserscheinungen. Aus diesem Grund wurde eine vollständige Instandsetzung unumgänglich. Die Stadt St. Gallen und die Gemeinde Stein erteilten dem Ingenieurbüro Basler & Hofmann Ende 2007 den Auftrag, eine Zustandserfassung, eine statische Überprüfung und ein Instandsetzungsprojekt auszuarbeiten. Ziel war es, das Bauwerk längerfristig als Geh- und Radwegbrücke zu erhalten und es so instand zu setzen, dass es den heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht. Das Schwingungsverhalten der Brücke sollten die Ingenieure deutlich verbessern.
Für die Erfassung des Istzustandes nahmen die Bauingenieure die Schäden auf (Abb. 6), untersuchten das Material und überprüften die Statik. Sie liessen sich von der Feuerwehr abseilen und inspizierten die gesamte Brücke visuell. Bereits vom Geotechniker erstellte Untersuchungen der Fundamente und Filmaufnahmen vom Überbau zogen sie in die Beurteilung mit ein. Die Fundamente waren vor allem durch Steinschlag, Unterspülung durch die Sitter und Erddruck gefährdet. Am Stahlfachwerk zeigten sich zum Teil grossflächige Korrosionsschäden und Auftreibungen, d.h. Verformungen von eng aneinanderliegenden Blechen infolge Volumenzunahme durch Korrosionsprodukte. Die auf dem Fachwerkträger liegende Stahlbeton-Fahrbahnplatte wies Betonabplatzungen an der Unterseite, freiliegende Bewehrungseisen, undichte Fugen und Übergänge sowie einen abgenutzten Belag auf. Die Entwässerung leitete zudem das Wasser direkt auf das Stahlfachwerk.
Um die Tragsicherheit des Stahlfachwerks beurteilen zu können, entnahm man einen Diagonalstab, den die Empa Dübendorf auf Zugfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit, chemische Zusammensetzung und Aufbau des Korrosionsschutzes untersuchte. Aufgrund der chemischen Analyse konnte das untersuchte Profil einem Thomasstahl zugeordnet werden, der nach SIA 263 einem heutigen Stahl S 235JR entspräche. Der alte Korrosionsschutz war zweischichtig, mit stark variabler Stärke von 130 μm bis 900 μm. Es wurden beträchtliche Zinkgehalte (40 g/m2), aber nur geringe Blei- (5 g/m2) und praktisch keine PCB-Gehalte gemessen.
Zeuge der At. Galler Industriebaukunst
Die Brücke ist im schweizerischen Inventar der Kulturgüter als Objekt von nationaler Bedeutung eingetragen. Denn sie ist mit ihrer äusserst filigranen und materialsparenden Konstruktionsart Teil des Ensembles der St. Galler Industriekeimzellen und gilt als wichtiger Zeuge der Ingenieurbaukunst im letzten Jahrhundert – obwohl sie eigentlich eine technische Panne ist. Die notwendig gewordenen Eingriffe in das bestehende Fachwerksystem sollten gemäss dem Denkmalschutz bei vertretbaren Sicherheitsrisiken vermieden oder zumindest minimiert werden. Die Struktur, das genietete Geländer und die Kandelaber sollten erhalten bleiben.
Statische Überprüfung
Für die statische Überprüfung modellierten die Bauingenieure die Brücke mit einem räumlichen Stabtragwerksprogramm – basierend auf gut erhaltenen Archivplänen. Dann erfolgte die Prüfung mit den gültigen Lasten gemäss SIA 260 und 261. Die Ingenieure ermittelten die Tragsicherheit der einzelnen Stäbe und Anschlüsse mit den Schnittkräften nach Theorie I. Ordnung. Die untersuchten Anschlüsse erfüllten die Tragsicherheit. Eine begrenzte Anzahl Stäbe überschritt allerdings die Normwerte bezüglich Ausnutzungsgraden Ed/Rd um 5 bis 27 %; die kritischen Stäbe befinden sich vor allem im Überbau.
Um die Schwingungsanfälligkeit der Brücke genauer zu untersuchen, wurden Messungen und Eigenfrequenzberechnungen durchgeführt. Die Eigenfrequenzen gemäss SIA 260 liegen in dem für Fussgängerverkehr kritischen Bereich von 1.6 bis 4.5 Hz in vertikaler und von <1.3 Hz in horizontaler Richtung. Die gemessene vertikale Schwinggeschwindigkeit, die bereits ein bis zwei rennende Personen anregen können, beträgt 17.1 mm/s und ist grösser als der von der DIN 4150 vorgegebene Grenzwert von 5 mm/s. Die starken horizontalen Auslenkungen wiederum können dazu führen, dass Personen aus dem Tritt geraten. Allerdings müssten viele Personen die Brücke begehen, bis die horizontale Schwingung deutlich wahrnehmbar würde – was eher selten vorkommt. Für die tägliche Nutzung sind deshalb vor allem die vertikalen Schwingungen von Bedeutung.
Gewicht reduzieren und Dämpfung erhöhen
Das Instandsetzungsprojekt stellte vor allem die hohen Ausnutzungsgrade und die Schwingungsanfälligkeit in den Vordergrund. Zum einen sollten Tragsicherheit und Schwingungsverhalten deutlich verbessert werden, gleichzeitig aber durfte die Leichtigkeit der Konstruktion aus Denkmalschutzgründen nicht verunklärt werden. Eine orthotrope Stahlplatte mit einem Gussasphaltbelag ersetzt die Fahrbahnplatte aus Beton. Damit reduziert sich das Gewicht der Fahrbahnplatte einschliesslich Belag von 413 kg/m2 auf 280 kg/m2. Diese Gewichtsreduktion und der Verbund der neuen Stahlplatte mit den Obergurten verbesserten das statische Verhalten deutlich. Der Ausnutzungsgrad Ed/Rd der massgebenden pfeilernahen Stäbe des Untergurtes und der Streben verringerte sich von 1.27 auf 1.09, und die Eigenfrequenz fv von etwa 2.5 Hz erhöhte sich leicht, wodurch die Brücke etwas steifer wurde. Dennoch blieben zwölf Druck- und vier Zugstreben unter den normgemässen Sicherheiten. Für sie planten die Ingenieure Profilergänzungen und Verstärkungen ein. Da sich mit der leichteren Stahlplatte allein die Tragwerkssteifigkeit und das Schwingungsverhalten nur geringfügig verbessert, empfahlen die Ingenieure, Schwingungsdämpfer einzusetzen (Abb. 5). Wegen der hohen technischen und ästhetischen Anforderungen, insbesondere bezüglich Denkmalschutz, konnte man keine Standardprodukte verwenden, sondern es mussten massgeschneiderte Dämpfer entwickelt werden. Insgesamt reduzieren nun vier vertikale und zwei horizontale Dämpfer die Schwingungen um etwa den Faktor 3. Die Dämpfungen wurden von 0.5 auf etwa 2.5% angehoben.
Neuer Korrosionsschutz
Für die Erneuerung des Korrosionsschutzes wurden verschiedene Varianten geprüft. Wäre die gesamte Brücke für die Arbeiten eingehaust worden, hätte dies infolge Windlasten eine massive Zusatzbelastung für die filigranen Pfeiler bedeutet, die Abspannungen hätten aufnehmen müssen – und dies in einem engen Flusstal mit Hochspannungsleitungen. Die Planenden begrenzten die Einhausung deshalb auf rund 35 m lange Etappen. Im restlichen Bereich wurde der Korrosionsschutz im Freikletterverfahren instand gesetzt (Abb. 4). Der eingehauste Bereich erhielt einen dreischichtigen Korrosionsschutz, und im nicht eingehausten Bereich brachten die Kletterer von Hand zwei Schichten auf. Die Instandsetzungsarbeiten in schwindelerregender Höhe stellten extreme Anforderungen an die Beteiligten: Zehn Fachkräfte mit einer Kletterausbildung für Arbeiten am hängenden Seil führten die Erneuerung von rund 5700 m² Korrosionsschutz aus. Die Suva besprach vor Beginn der Arbeiten das Sicherheits- und Rettungskonzept und probte allfällige Bergungsmassnahmen. Da unter der Haggenbrücke eine Hochspannungsleitung durchführt, wurden die Arbeiten frühzeitig mit dem Kraftwerksbetreiber abgestimmt und die Leitung zeitweise abgeschaltet.
Umweltschutzmassnahmen
Die Bauarbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Umweltämtern ausgeführt. Um zu verhindern, dass schadstoffhaltiger Korrosionsschutzbelag in die Umwelt gelangt, ergriff man Schutzmassnahmen, wie mobile Zelte im Bereich der Fahrbahn oder Rucksackstaubsauger für die Freikletterer. Bei zwei Pfeilern stellten die Fachkräfte während der Ausführung höhere Bleigehalte fest als sondiert. Um die Schadstoffe aufzufangen, montierte man zusätzliche, fächerförmige Auffangvliese um die Pfeiler. Unterhalb der Brücke wurden monatlich Kontrollmessungen durchgeführt. Sie zeigten während der entsprechenden Bauarbeiten etwas erhöhte, jedoch tolerierbare Schadstoffemissionen. Die letzten Arbeiten an der filigranen Konstruktion wurden vor einem Jahr abgeschlossen. Seither präsentiert sich der Fussgängersteg aufgefrischt, und es können neben Fussgängern und Velos nun auch Mopeds und Unterhaltsfahrzeuge bis 3.5 t auf die Brücke.TEC21, Fr., 2011.06.10
10. Juni 2011 Felix Gisler, Jörg Habenberger, Dorothée Braun
Dreigelenk in Stahlbeton
Die vom Kanton Bern als schützenswert eingestufte Garstattbrücke von Robert Maillart im Simmental ist über 80 Jahre alt und hat bisher alle Verkehrslasterhöhungen gut überstanden. Der Schwerverkehr setzte der Dreigelenkbogenbrücke jedoch zu und verursachte Schäden. Das Büro Diggelmann + Partner hat sie deshalb 2010 instand gesetzt und ihre Tragfähigkeit durch gezielte Verstärkungen erhöht – das ursprüngliche Erscheinungsbild veränderte sich nur bei den Endlängsträgern an den Widerlagern.
Robert Maillart hat in seiner zweiten Schaffensperiode (1920–1940) die Mehrzahl seiner Brücken im Kanton Bern realisiert. Von den insgesamt 18 sind noch 14 erhalten, wovon die meisten von der kantonalen Denkmalpflege als «schützenswert» eingestuft werden.[1] Dass die formschönen und schlanken Konstruktionen, die sich «durch absolute Ökonomie der Mittel»[2] auszeichnen, mehr als 70 Jahre ohne wesentliche Eingriffe überdauert haben, mag erstaunen – lässt sich aber erklären. Maillart hat neben der statischen Berechnung stets auch der konstruktiven Ausbildung einen hohen Stellenwert beigemessen. Ein Blick auf die Karte zeigt zudem, dass er seine Brücken mehrheitlich in abgelegeneren Gebieten realisierte, in Gemeinden, die sich damals keine kostspieligen Bauwerke leisten konnten (Abb. 3)[3]; weil das Verkehrsaufkommen und die Fahrzeuggewichte auf diesen Strassen weniger schnell zunahmen als anderswo, genügten diese Brücken über lange Zeit den Anforderungen. Als im Jahr 2000 alle schweizerischen Strassen für Lastwagen bis 40 t freigegeben wurden, kamen die Maillart-Brücken an ihre Belastungsgrenze. Überprüfungen und Nachrechnungen zeigten zwar erhebliche Tragsicherheitsreserven, sodass die ursprünglich für Fahrzeuggewichte von 13 t ausgelegten Bauwerke bis maximal 32 t freigegeben werden konnten. Weil der zunehmende Schwerverkehr den Bauwerken jedoch progressiv zusetzte und durchgehende 40-t-Korridore gefordert wurden, mussten Lösungen für die Brücken gefunden werden. Das Tiefbauamt des Kantons Bern betraute das Ingenieurbüro Diggelmann + Partner – als Nachfolgebüro von Maillarts Berner Filiale – mit der Aufgabe, Konzepte für die Erhaltung einiger dieser Brücken zu erarbeiten und umzusetzen.
Erhaltungswert einer Maillart-Brücke
Mit der Erarbeitung der Konzepte wurde teilweise auch der Rückbau diskutiert. Bauwerke von Robert Maillart sind jedoch grundsätzlich erhaltenswert. Ein Blick ins Merkblatt SIA 2017 «Erhaltungswert von Bauwerken»[4] zeigt, dass vor allem immaterielle Kriterien dafür sprechen. Die Brücken haben sowohl einen hohen historisch-kulturellen als auch handwerklich-technischen Wert, was indirekt zu einem wesentlichen gestalterischen Wert führt. Eine Brücke Maillarts kann und darf nicht unbedacht abgerissen oder verunstaltet werden (vgl. Kasten S. 24), sondern nur, wenn eine vertiefte Abklärung keine andere valable Lösung aufzeigt, zum Beispiel bei einem ungenügenden Durchflussprofil unter der Brücke.[5]
Eine Maillart-Brücke im Simmental
Maillart entwickelte zwei neue Tragwerkssysteme für Betonbrücken: den versteiften Stabbogen und den Dreigelenkbogen mit Kastenträger. Die Garstattbrücke in Boltigen auf der Hauptstrasse durch das Simmental ist ein Beispiel für eines dieser beiden Tragsysteme. Dieses zweitletzte Projekt von Maillart vor seinem Tod, das er 1939 erbaute, gehört zur Gruppe der Dreigelenkbogen, von denen im Kanton Bern vier von ursprünglich fünf noch erhalten sind – und dies weitgehend im Originalzustand. Die Brücke wurde 2010 von Diggelmann + Partner erneuert und zeigt, mit welchen Eingriffen ein für damalige Verhältnisse innovatives und effizientes Bauwerk hergerichtet werden kann.
Maillart wählte für diese schiefwinklige Überquerung der Simme zwei in Längsrichtung verschobene, konisch verlaufende Kastenträger, die er stark vereinfacht hat: Der Bogen ist nur theoretisch vorhanden, er ist effektiv aufgelöst in gerade Linien. Die Zwillingsbrücken sind mit einer Spannweite von 32 m ausgeführt und tragen je eine Fahrspur. Eine ist – nach Norm SIA 112 (1935) – jeweils für zwei hintereinanderstehende Lastwagen von je 13 t plus eine verteilte Last von 440 kg/m2 dimensioniert. Die im Jahr 2001 durchgeführte statische Überprüfung nach Norm SIA 462 bzw. der Publication ICOM 444-46 erfolgte bereits nach den Überlegungen der inzwischen gültigen Norm SIA 269 «Erhaltung von Tragwerken» und ergab eine maximal zulässige Belastung von 32 t pro Fahrspur. Die Gelenke bestehen aus eingeschnürten Betonquerschnitten und wurden nach Leonhardt[7] nachgewiesen. Die Zustandsuntersuchung wies einen kompakten, hochfesten Stampfbeton (C50/60) aus und Karbonatisierungstiefen bis 35 mm. Hauptschadensursache war das undichte Scheitelgelenk, sodass ungenügend abtropfendes, chloridhaltiges Wasser zu Korrosion an der Bewehrung der Brückenuntersicht führte.
Die Ingenieure sahen Verstärkungen vor, die aufgrund der technischen Randbedingungen erforderlich waren und die die Denkmalpflege gleichzeitig als die schonendsten erachteten. Alle Verstärkungsmassnahmen wurden dabei gemäss den Neubaunormen SIA 260 ff. bemessen. Ursprünglich trug ausschliesslich der flache Dreigelenkbogen die Lasten in den kiesigen Baugrund ab (Abb. 6). Die Kämpfergelenke wurden so unter den aktuellen Lasten überbeansprucht. Durch eine unsichtbare, innenseitige Verstärkung der Kastenwände (Abb. 4) und die sichtbare Verstärkung der Endlängsträger sowie deren Einspannung im Widerlager konnten die Kämpferbereiche entlastet werden (Abb. 5 und 7). Ihre Querkraftbeanspruchung reduzierte sich so weit, dass die intakten, filigranen Kämpfergelenke belassen werden konnten. Mikropfähle stellen ausserdem sicher, dass sich unter den Fundamenten keine klaffende Fuge einstellt. Die nur 16 cm starke Fahrbahnplatte wurde um 8 cm aufbetoniert und mit neuen Konsolen versehen, die die gleichen Proportionen aufweisen wie die ursprünglichen. Die relativ gut erhaltenen Seitenwände wurden lokal instand gesetzt und hydrophobiert. Hingegen mussten die korrodierten Untersichten grossflächig abgetragen und mittels Spritzmörtel reprofiliert werden.
Die Bauingenieure veränderten das statische System der Brücke in Absprache mit der Bauherrschaft bewusst nicht. Sie beliessen das Scheitelgelenk und die Längsfuge zwischen den Zwillingsbrücken. Damit blieb das aus Sicht der Denkmalpflege wichtige Tragsystem erhalten, und man vermied die aus technischer Sicht problematischen neuen, schwer beherrschbaren Zwängungen – akzeptierte aber den entsprechenden Unterhalt der Fugen.
Brückenbild prägendes Geländer
Neben dem Tragwerk wird auch diese Brücke Maillarts durch ein filigranes, einfaches Profilgeländer geprägt. Es genügt bezüglich Rückhaltevermögen und Personenschutz nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Ein robusterer Nachbau, allenfalls mit Drahtgitterfüllungen, ist meist ausreichend und einem modernen, aber unpassenden Rückhaltesystem vorzuziehen. Der Nachbau des Geländers für die Garstattbrücke besteht wie schon das ursprüngliche aus U-Pfosten und Winkelprofilen mit analogen Proportionen. Er wurde jedoch als durchgehendes Zugband ausgebildet. Die Pfosten sind nicht mehr eingemörtelt, sondern aus Unterhaltsgründen mit Fussplatten aufgedübelt, die auf der Aussenseite der U-Pfosten versteckt sind. Leitplanken sind in Absprache mit der Bauherrschaft keine montiert, denn eine Gefahrenanalyse zeigte, dass die neuen, 20 cm hohen Bankette für die vorhandene Ausbaugeschwindigkeit von 60 km/h ausreichend sind.
Zusammenspiel alter und neuer Tragelemente
Durch die sorgfältige Instandsetzung funktioniert das Zusammenspiel der alten und der neuen Tragelemente. Ihre Dauerhaftigkeit bleibt für rund 50 weitere Jahre gewährleistet. Danach können neue Instandsetzungsmassnahmen nötig werden. Damit bleibt auch dieses historisch- kulturell wertvolle Bauwerk den nachfolgenden Generationen erhalten und gewährleistet gleichzeitig eine den aktuellen Bedürfnissen entsprechende Nutzung – umgesetzt mit einem im Vergleich zu einem Ersatzneubau verhältnismässigen Einsatz der finanziellen Mittel.
Erhaltungsphilosophie
In der Regel wird ein Bauwerk für nicht mehr als einige Jahrzehnte bis zum Ablauf der Lebensdauer erhalten. Wenn denn aber eine wertvolle Brücke erhalten bleiben soll, dann nicht nur für einige Jahrzehnte, sondern für möglichst viele Generationen. Dazu bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Erfüllt die Brücke die Nutzungsanforderungen weiterhin oder sind diese zukünftig geringer, ist eine Instandsetzung oder Konservierung ausreichend. Beispiele dafür sind die denkmalgeschützten Rossgraben- und Schwandbachbrücke (erbaut 1932 bzw. 1933 und instand gesetzt 2005 bzw. 2006) in der Region Schwarzenburg im Kanton Bern. Die Überprüfung erfolgt gemäss der seit 1. Januar 2011 gültigen SIANorm 269 «Erhaltung von Tragwerken».
Genügt das Bauwerk hingegen bezüglich Belastung oder Geometrie nicht mehr, ist eine Verstärkung oder Erweiterung nötig. Dies bedeutet in der Regel einen wesentlichen Eingriff ins Bauwerk, der unter Beizug der Denkmalpflege behutsam und mit Respekt für die bestehende Bausubstanz zu erfolgen hat. Einerseits sollen das Tragwerkskonzept und das bewährte statische System nicht grundlos verändert werden, andererseits sollen die Eingriffe nach Möglichkeit dort erfolgen, wo sie entweder nicht bzw. kaum sichtbar sind oder wo die Originalsubstanz bzw. -oberfläche bereits früher verloren ging. Massnahmen, die gleichzeitig der Instandsetzung und der Verstärkung dienen, sind besonders effizient: z. B. Vorbetonierungen auf chloridbelasteten und deshalb abzutragenden Oberflächen der Troginnenseiten. Originale Ober- flächen sollen hingegen erhalten bleiben und nur lokal repariert werden, auf vollflächige Beschichtungen ist zu verzichten. Erhaltungsmassnahmen ermöglichen es zudem, frühere Verunstaltungen rückgängig zu machen. Geometrischen Veränderungen wie Verbreiterungen oder Kurvenstreckungen sind aus ästhetischen und aus statischkonstruktiven Gründen enge Grenzen gesetzt. Liegen entsprechende Forderungen vor, ist mit der Bauherrschaft im Detail abzuklären, inwieweit darauf allenfalls verzichtet werden kann und wo Kompromisse möglich sind.
Die meisten Brücken Maillarts können mit geeigneten Massnahmen für aktuelle Verkehrslasten verstärkt werden. Dies setzt jedoch eine eingehende Auseinandersetzung mit den vorhandenen Tragwerken voraus, was durch die vollständig erhaltenen Unterlagen erleichtert wird. Aufgrund der Bewehrungspläne und der auf wenigen Seiten festgehaltenen handschriftlichen Berechnung sind kaum stark unterdimensionierte Tragwerksteile auszumachen; alle Tragwerksteile erreichen etwa gleichzeitig ihre Belastungsgrenze, weil Maillart als einer der Ersten die räumliche Zusammenwirkung der einzelnen Tragelemente erkannte und berücksichtigte. Trotzdem lassen sich mit den heute verfügbaren Statikprogrammen bisher verborgene Tragwerksreserven aufzeigen, womit nachgewiesen werden kann, dass die aufgrund der damaligen Belastungsversuche[8] bereits vermuteten, wesentlich höheren Tragfähigkeiten tatsächlich vorhanden sind. Bei der Entwicklung der Verstärkungskonzepte ist diesem Aspekt gebührend Rechnung zu tragen.
Im Rahmen der Erhaltung von Maillart-Brücken haben sich Werkstoffe auf Zementbasis bewährt. Bei Vor- und Aufbetonierungen ist auf einen guten Verbund und ein geringes Schwindmass zu achten. Kunststoffgebundene Materialien hingegen sind artfremd und an sichtbaren Oberflächen aus ästhetischen Gründen zu vermeiden.
Anmerkungen:
[01] Inventar der noch erhaltenen Brücken von Robert Maillart im Kanton Bern, kantonale Denkmalpflege Bern, 1991
[02] «Robert Maillart», Max Bill, 1949, Artemis Verlag, Zürich
[03] Brücken Robert Maillart, Landeskarte der Schweiz, Herausgeber TFB Wildegg, 1982
[04] Erhaltungswert von Bauwerken, Merkblatt SIA 2017
[05] Anmerkung Redaktion: vgl. «Gleichgewicht ist einer der schönsten Begriffe», TEC21 37/2010
[06] Lastmodell zur Beurteilung zweispuriger Strassenbrücken mit Gegenverkehr, Publication ICOM 444-4, EPF Lausanne, Juni 2001
[07] Vorlesungen über Massivbeton – 2. Teil, Kap. 4.2 «Betongelenke» von F. Leonhardt (1975)
[08] Belastungsversuche, Prof. Dr. M. Ros, Januar 1941, Empa ZürichTEC21, Fr., 2011.06.10
10. Juni 2011 Martin Diggelmann, Olivier Bolliger