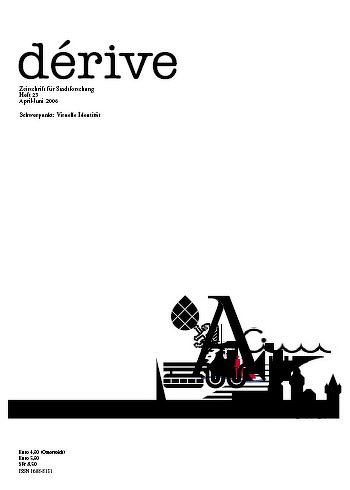Editorial
Editorial
Das dérive-Frühlingsheft widmet sich in seinem Schwerpunkt dem Thema Visuelle Identität, das Andreas Fogarasi, der sich in seiner künstlerischen Arbeit schon lange mit der visuellen Repräsentation von Orten beschäftigt und auch für das grafische Erscheinungsbild von dérive verantwortlich ist, als Redakteur betreut hat. Sein Beitrag Visuelle Identität – Orte als Marken? eröffnet den Schwerpunkt, gibt eine Einführung ins Thema und stellt die einzelnen Artikel kurz vor.
Antje Havemann und Margit Schild setzen im Magazinteil ihre Auseinandersetzung mit temporären Nutzungen, die sie im letzten Heft begonnen haben, fort und fragen sich wie nachhaltig das Temporäre sein kann. Erik Meinharter stellt das Million Donkey Hotel von feld72 vor, das zeigt, dass es Leerstand nicht nur im urbanen Bereich gibt. Bereits bei Teil 15 ist Manfred Russo mit seiner Serie über die Geschichte der Urbanität angelangt, die sich neuerlich mit Transformationen der Öffentlichkeit beschäftigt und auch zum Thema visuelle Identität einiges zu sagen hat.
Um Öffentlichkeit wird es auch bei einem kleinen Symposium gehen, das wir am 21. April ab 15 Uhr unter dem Titel Der öffentliche Raum in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie / Sektion Stadtforschung im Depot veranstalten. Abgeschlossen wird das Symposium um 19 Uhr mit einer Podiumsdiskussion. Geplant war die Veranstaltung ursprünglich als Heftpräsentation unserer lezten Ausgabe mit dem Schwerpunkt Urbane Räume – öffentliche Kunst. Dafür ist es zwar ein wenig spät, aber das soll kein Grund sein, über das Thema nicht mehr zu reden. Das genaue Programm können Sie auf unserer Website www.derive.at nachlesen.
Dieser Ausgabe ist ein Fragebogen beigelegt von dem wir hoffen, dass er von vielen von Ihnen ausgefüllt und an uns zurückgeschickt wird. Nach fast sechs Jahren finden wir, dass es an der Zeit ist, unsere Vorstellung darüber, wer unsere LeserInnen sind und was sie sich von dérive erwarten, zu überprüfen. Wir wollen dérive inhaltlich weiter verbessern und vor allem auch den Vertrieb optimieren. Dafür brauchen wir einige Informationen, die nur Sie uns geben können.
Selbstverständlich haben wir auch einige Fragen eingestreut, die Sie über Ihr Konsumverhalten aushorchen sollen, damit wir wissen, ob wir künftig eher bei Porsche oder bei Mercedes wegen Inseraten anklopfen sollen. Unter allen, die sich an der Umfrage beteiligen und Ihren Namen auf das Kuvert (nicht auf den Fragebogen) schreiben, verlosen wir rare Gustostückchen aus unserem Archiv. So werden sich die GewinnerInnen der IWI-CD zum Beispiel anhören können, wie dérive geklungen hat, bevor es überhaupt existierte.
Eine anregende Lektüre wünscht
Christoph Laimer
Inhalt
Inhalt
Editorial | Christoph Laimer
Visuelle Identität:
Visuelle Identität – Orte als Marken? | Andreas Fogarasi
Governance durch Community – Die Metempsychose des Bürgers zum Kunden | Manfred Russo
„Staats-Idee“ und „Stilgewalt“ – Anmerkungen zum Branding- und Propaganda-Pionier Hans Domizlaff | Richard Brem
Das Logo als Symptom | Tone Hansen
Stadtmarketing – Neues Planungsparadigma? | Sabine Gruber
Packaging Estonia | Andres Kurg
Copyright zu versteigern | Anita Aigner
The Brand of Freedom | Anette Baldauf
Ambiente-Dienstleistung – Sondierungen zu Kollateralkosten touristischer Kulturen | Jens Badura
Von der Nachhaltigkeit des Temporären oder: Was bleibt, wenn nichts bleibt? | Antje Havemann, Margit Schild
Die Transformationen historischer Begebenheiten Zur Tektonik der Geschichte im Forum Stadtpark, Graz | Walter Seidl
Mathieu Wellner über die Ausstellung Ort und Erinnerung – Nationalsozialismus in München im Architekturmuseum der TU München 57 Akribische Recherche im alpinen Patt Der vergessene Stadtplan Ort und Erinnerung – Nationalsozialismus in München im Architekturmuseum der TU München | Mathieu Wellner
Finden ohne zu suchen Von Alltagswelt bis Zwischenraum von Gisela Welz, Ramona Lenz (Hg.) | Christian M. Peer
KünstlerInnenseite:
Künstlerinsert von Clegg & Guttmann | Clegg & Guttmann
Faits divers:
Urbane Feldarbeiten in Prata Sannita – Das Million Donkey Hotel | Erik Meinharter
Serie: Geschichte der Urbanität:
Teil 15: Transformationen der Öffentlichkeit, Teil II: Warenöffentlichkeit durch Emotional Design | Manfred Russo
Besprechungen:
Tag und Nacht – Melnikow – ein unterbelichteter Protagonist der Moderne | André Krammer
Akribische Recherche im alpinen Patt Die Schweiz – Ein städtebauliches Portrait | André Bideau
Das Universum als Modell Matt Mullican: model architecture im Lentos Kunstmuseum Linz | Andrea Domesle
Zur Politik der Straße – Wiener Straßenleben in der Fotografie von 1861 bis 1913 | Paul Rajakovics
Transitraumbilder Berlinale 2006 | Tina Hedwig Kaiser
Gemischtwarenhandlung Raum Von Pilgerwegen, Schriftspuren und Blickpunkten von Jörg Dünne, Hermann Doetsch, Roger Lüdeke (Hg.) | Andreas Rumpfhuber
Bei zukünftigen Museumsplanungen Fehler vermeiden Museen und Stadtimagebildung von Franziska Puhan-Schulz | Andreas Fogarasi
Der vergessene Stadtplan
Das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne zeigt die Ausstellung: Ort und Erinnerung - Nationalsozialismus in München. Vergeblich wird man in dieser Ausstellung des Architekturmuseums nach Grund-rissen, Schnitten oder Modellen von NS-Gebäuden suchen. Auch zur Form- und Material-Spezifik von Troosts und Speers Propagandabauten wird der Besucher hier nicht fündig werden. Diese architektonischen Aspekte sind auch irrelevant, da es de facto keinen einheitlich gebauten NS-Stil gab.
Diese Ausstellung geht einen anderen Weg – sie will die von den Nationalsozialisten gebauten oder angeeigneten Orte wieder zu Trägern von konkreten Ereignissen werden lassen. Zu lange haben deutsche und österreichische Städte ihre „braune“ Geschichte ignoriert. In den drei jeweils 200 m² großen Ausstellungsräumen geht es um den Umgang mit der Vergangenheit und um die Frage, ob Städte und Gemeinden ihre Geschichte sichtbar machen oder vertuschen. In den ersten vierzig Jahren nach Kriegsende hat man eigentlich nur der Opfer gedacht – und das zumeist auch noch auf deren Initiative. Denkmale, Mahnmale und Dokumentationszentren, die nicht unbedingt an konkrete Orte oder Gebäude gebunden sind, mahnen auf repräsentative, aber abstrakte Weise. Diese Orte sind symbolische, ganz artifizielle Räume, die, im phänomenologischen Sinn von Norberg-Schulz, den „Menschen Halt geben“(1). Sind sie aber nicht auch, gegensätzlich dazu, das was Foucault eine Heterotopie(2) nennt, nämlich die Utopie eines einzelnen Raumes, der für mehrere (oft völlig unterschiedliche) Räume steht?
So hat die Stadt München Mitte der achtziger Jahre einen Wettbewerb für ein „Denkmal für die Opfer der NS-Gewalt-herrschaft“ ausgeschrieben. Gewonnen hat der Deggendorfer Bildhauer Andreas Sobeck mit einer Basaltsäule auf der eine Gasflamme hinter einem Stahlgitter lodert. Diese steht auf der nachträglich zum „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ umbenannten Verkehrsinsel, schräg gegenüber der ehemaligen Gestapo-Zentrale.
Um solche Fauxpas in Zukunft zu verhindern und der politisch motivierten Geschichtsverdrängung entgegenzuwirken, zeigt die Ausstellung auf Tafeln, Karten, Projektionen und Fotografien einhundert konkrete Orte Münchens, die den dortigen Aufstieg und die Schreckenszeit des NS-Regimes lokalisierbar machen sollen. „Wer jedoch die vorgestellten Bauten, an denen er vielleicht häufig achtlos vorbeigegangen ist, mit Wissen um Zusammenhänge und Hintergründe betrachtet, der kann mit den Steinen Geschichte verbinden, der wird hinter die Fassaden geführt und über Ereignisse, Mechanismen und Strukturen informiert, die ihn auch heute noch betreffen können“ erklärt Museumsdirektor Prof. Nerdinger im ausführlichen Katalog(3). Denn München ist wie wenige andere Städte eng mit dem Nationalsozialismus verknüpft, ist sie doch die Stadt, in der alles begann: der Aufstieg Hitlers, die Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), der Sturmabteilung (SA) und der Schutzstaffel (SS) - die „Hauptstadt der Bewegung“. Viele dieser historischen Ereignisse sind mit bestimmten Gebäuden verknüpfbar und im Stadtraum, falls nicht im Krieg zerstört, noch sichtbar. Erst seit etwa zwanzig Jahren vollzieht sich ein Wechsel in der Forschung, da nun eine neue Generation von HistorikerInnen nicht mehr die Auseinandersetzung mit den TäterInnen scheut, von denen viele noch bis in die siebziger Jahre wichtige öffentliche Positionen besetzten.
In acht thematischen Schwerpunkten, vom „Aufstieg der NSDAP“ über „Verwaltung und Verbrechen“ oder „Zwangsarbeit und Lagersystem“ bis zu „Widerstand“, zeigen die ausgestellten Stadtpläne die Adressen der besprochenen Gebäude und Plätze. Man sieht beispielsweise in welchen Bierkellern die Partei gegründet wurde, von welchen Verlagshäusern die Nazis unterstützt wurden oder in welchen Stadthäusern Hitler ins Bürgertum eingeführt wurde.
Auf der Karte über die „Selbstdarstellung des Nationalsozialismus in München“ kann man den für München geplanten städtebaulichen Gigantismus Hitlers ablesen. Ein regelrechter Umbau der Stadt in die „Hauptstadt der Bewegung“ sollte nach dem „Endsieg“ das Stadtbild völlig verändern. Hierfür konnte das Architekturmuseum auf eine Diplomarbeit eines Architekturstudenten zurückgreifen, der diese nicht realisierten Planungen auf den aktuellen Stadtplan übertrug. Drei, jeweils in Autobahnen endende Achsen, sollten die Stadtstruktur verändern. Am äußeren Endpunkt der Achsen, als eine Art Stadttor waren jeweils ein Forum der HJ, der SA und der SS geplant, die die Stadt bewachen sollten. Nach Innen waren die Achsen auf symbolische Orte (Feldherrnhalle und Bürgerbräukeller) und Monumente (Denkmal der Erinnerung) ausgerichtet, um glorifizierend und als Mittel der Trivial-Interpretation auf die Massen zu wirken. Die Monumentalität und Maßlosigkeit der Formen als Machtdemonstration und das axiale Ordnungsschema als Zeichen der Unterordnung sind ja schon in ähnlicher Weise aus den Planungen für Nürnberg und Berlin bekannt. Ein wesentlicher Unterschied aber zu diesen beiden Städten war die realisierte räumliche Konzentration an Verwaltungsbauten auf dem Areal zwischen Königsplatz und Karolinenplatz. Nur zwei realisierten Neubauten von Hitlers Architekten Troost standen hier knapp fünfzig angemietete Gebäude gegenüber, in denen insgesamt ungefähr 5000 BeamtInnen des Terrorregimes arbeiteten. Ein eigenes Heizkraftwerk, eine eigene Post, ein Netz an unterirdischen Gängen und ein eigener Luftschutzbunker machte aus diesen Einzelbauten eine fast autarke Einheit. Der klassizistische Königsplatz von Leo von Klenze aus dem frühen 19. Jahrhundert wurde mit Granitplatten bedeckt und um zwei Ehrentempel ergänzt, die den Platz zur „nationalen Gedenkstätte“ veränderten. Die sechzehn „Blutzeugen“, denen Hitler schon „Mein Kampf“ gewidmet hatte, waren in gusseisernen Särgen in den offenen Ehrentempeln aufgebahrt und das seit 1933 jährlich stattfindende Marschritual fand vor diesen „Märtyrern der Bewegung“ statt.
Die Karte, die in der Ausstellung für die größte Verwunderung sorgt, ist sicherlich jene, in der Lager eingezeichnet sind. Seit Beginn des Krieges waren in München über 400 Lager auf die gesamte Stadtfläche verteilt. Diese Kriegsgefangenen-, Arbeiter- und KZ-Außen-Lager gehörten so offensichtlich zum Stadtbild, dass jeder Münchner die Häftlinge gesehen haben muss. In Vergessenheit scheint dies auch deswegen geraten zu sein, weil die ausbeutenden Firmen erst in den letzten fünfzehn Jahren zu Ausgleichszahlungen bereit waren. Paul Virilios Aussage „wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, gibt es auch keine Erinnerung mehr“(4) kommt einem in diesem Fall vor, wie eine bewusste Strategie der deutschen Wirtschaft im Umgang mit der eigenen Vergangenheit.
Aber nicht nur Opfer und Täter werden in dieser Ausstellung lokalisiert - es ist auch sehr interessant, Orte des Widerstands zu sehen. Von der „Weißen Rose“ weiß man zwar, dass deren Mitglieder ihr letztes Flugblatt in der Ludwig-Maximilians-Universität auslegten, aber dass sie sich im Atelier des Architekten Eickemeyer trafen, ist sicher für viele neu und Balsam für die Architektenseele. Im letzten Raum der Ausstellung sind aktuelle Farbfotografien von manchen der exemplarisch ausgewählten Orte auf die Wände tapeziert worden, um nach den historischen Dokumenten nun auf das aktuelle Stadtbild hinzuweisen.
Angesichts der Fülle an Texten und der kartografischen Übersetzung in den Stadtplan, gelingt es den Kuratoren der Ausstellung in einer nüchternen und rationalen Weise, dieses schwierige Thema frei von Emotionalisierung und Personalisierung zu vermitteln. Natürlich sind Gebäude unschuldig, aber das ist noch lange kein Grund zu vergessen, was sich in ihnen abspielte.
[ Ort und Erinnerung – Nationalsozialismus in München
Ausstellung: Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne, 22. Februar bis 28. Mai 2006.
Katalog: Winfried Nerdinger (Hg.) Salzburg: Verlag Anton Pustet, 2006, 225 Seiten, 24 Euro. ]dérive, Fr., 2006.04.14
1 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci. Mailand: Eclecta, 1979.
2 Michel Foucault, Andere Räume. In: Die Reparatur und Rekonstruktion der Stadt. Berlin: Senator für Bau- und Wohnungswesen, 1984.
3 Winfried Nerdinger (Hg.), Ort und Erinnerung - Nationalsozialismus in München. München: Verlag Anton Pustet, 2006.
4 Paul Virilio, Ereignislandschaft. München Wien: Carl Hanser Verlag, 1998.
14. April 2006 Mathieu Wellner
Visuelle Identität – Orte als Marken?
Dieses Schwerpunktheft von dérive beschäftigt sich mit dem Branding des Öffentlichen. In dem Maß, in dem sich das Selbstverständnis von Staaten, Regionen, Städten oder Stadtteilen zunehmend unternehmerisch definiert, ändern sich auch ihre visuellen Repräsentationen. Logos, Claims und Corporate Design ersetzen immer öfter traditionelle Insignien staatlicher Macht wie Wappen oder Flaggen. Der Tourismusbereich war der erste, der geografische Orte nach dem Vorbild von privaten Unternehmen als Marke zu positionieren suchte, mittlerweile gehen auch öffentliche Verwaltungen zunehmend dazu über, sich ihren BürgerInnen gegenüber als Marke zu präsentieren und damit nicht zuletzt ein Identifikationsangebot zu machen.
Von der Privatwirtschaft zu lernen – das scheint im gegenwärtigen Umbau öffentlicher Verwaltungen Konsens zu sein – ist gleichbedeutend mit Modernisierung. Ein Ausdruck dieser Ideologie ist die Vorstellung des Bürgers als Kunde. Der Kunde ist immerhin König und sollte daher möglichst wenig unter den Erschwernissen der Bürokratie zu leiden haben. Dieses Bild impliziert jedoch auch noch etwas anderes, nämlich, dass es bessere und schlechtere KundInnen gibt und damit BürgerInnen mit mehr oder weniger „Kaufkraft“ – d. h. Rechten? Wie jede Kundenbeziehung ist nun auch die zwischen Bürger und Staat theoretisch aufkündbar und verliert so ihre Spezifizität und Verbindlichkeit, wie Manfred Russo in seinem Beitrag erläutert. Russo spürt detailliert den Ideologien und Motiven dieser – wie er es nennt – Seelenwanderung vom Bürger zum Kunden nach und formuliert eine differenzierte Kritik an der letztlich den Rückzug des Staates befördernden Community-Rhetorik der Gegenwart.
Von der Privatwirtschaft zu lernen, das heißt auch im Wettbewerb zu stehen. Unter dem Konkurrenzdruck anderer Städte, Regionen oder Weltgebiete müssen einprägsame Images geschaffen werden, die auf dem globalen Markt für Sichtbarkeit sorgen. Images sollen die Unverwechselbarkeit eines Ortes vermitteln, seine Vorzüge zu Tage treten lassen und zudem möglichst widerspruchsfrei sein. Eine ziemliche Herausforderung etwa für postindustrielle, strukturschwache Mittelstädte ohne nennenswerte historische oder touristische Landmarks. So werden neue Themen gesucht, aus Stahlstädten werden Einkaufs-, Kultur- oder Freizeitstädte. Damit erschöpft sich aber auch schon das Arsenal an Themen, die positiv, produktiv und mehrheitstauglich sind. Die Idee der Positionierung von Eisenhüttenstadt als Seniorenstadt etwa stieß auf heftigen Widerstand in der Bevölkerung. Dieses Beispiel zeigt die Unmöglichkeit, die klaren Umrisse, die ein Image im Allgemeinen ausmachen, auf die Komplexität eines realen Gemeinwesens zu übertragen. Denn das würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass jeder Einwohner, jedes Gebäude und jeder öffentliche Raum mit dem Image kompatibel sein muss, soll das Image authentisch und glaubwürdig sein und damit als Marke erfolgreich. Im Tourismusbereich gibt es zahlreiche Beispiele für diese Unterordnung aller Teile unter das gemeinsame Imageziel, weshalb viele Tourismusdestinationen sich von Themenparks nur noch durch ihre vermeintliche, durch das tatsächliche Alter von Gebäuden und Gepflogenheiten garantierte Authentizität unterscheiden. Mit dem Unterschied, dass die Inszenierung in Themenparks Jobs beschreibt und an wirklichen Orten Lebensweisen. Jens Badura geht in seinem Text der Frage nach, welche Auswirkungen diese Schaffung eines kontrollierten Ambientes auf die BewohnerInnen eines Ortes hat, die eine behauptete Identität als Marke nach außen tragen müssen, und welche „Kollateralkosten“ dabei entstehen.
Zu den konstituierenden Bestandteilen einer Marke gehört die Corporate Identity und das Grafikdesign. Schrift, Typographie und Ikonografie sollen die Identität eines Unternehmens vereinheitlichen und nach außen sichtbar machen. Typographie ist aber immer auch schon selbst Bedeutungsträger. Am sichtbarsten ist das etwa bei folkloristisch geprägten Schrifttypen, wie den traditionellen baskischen Euskara-Schriften, von denen Hinrich Sachs’ Beitrag handelt. Im Zuge ihrer zunehmenden Verdrängung aus dem öffentlichen Raum durch einen internationalisierten Corporate Style initiierte Sachs eine Versteigerung der Rechte an den inzwischen digitalisierten Schrifttypen und löste damit eine Debatte um die Möglichkeit aus, lokale Identität grafisch zu fassen.
Der Markenpionier Hans Domizlaff forderte schon in den zwanziger Jahren Staaten und öffentliche Institutionen auf, sinnlich begreifbare Symbole zu schaffen, die dem Volk abstrakte Ideen wie den staatlichen Gemeinschaftsgedanken gegenständlich machen sollten. Hier sollte die Privatwirtschaft als Vorbild dienen, etwa im Entwurf von Flaggen, die ähnlich einem guten Firmensignet einer einprägsamen und erinnerungsstarken Bildidee folgen sollten. Richard Brems Text verfolgt Domizlaffs Theorien, die dieser 1932 in seinem Buch „Propagandamittel der Staatsidee“ vorgelegt hatte bis zum Standortwettbewerb der Gegenwart und zu den grafischen Inszenierungen anlässlich der US-amerikanischen Wahlen. Anette Baldauf beschreibt in Ihrem Artikel „The Brand of Freedom“ welche Werte besonders nach dem 11. September die Marke USA prägen. Hier sind die Attribute des guten Staatsbürgers besonders eng mit denen des guten Kunden verknüpft – frei nach dem Motto „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“ ist einkaufen zum patriotischen Akt geworden. Die Logik des Counterfeiting, der Fälschung von Markenartikeln, könnte – so Baldauf – den Weg einer möglichen Strategie des Widerstands gegen die bildkräftige Beschwörung von nationalem Schulterschluss und Konsumzwang weisen.
Tirol ist die stärkste Marke auf dem österreichischen Tourismusmarkt. Das in den siebziger Jahren vom Tiroler Grafikdesigner Arthur Zelger entworfene Logo, das typografisch geschickt die alpine Bergkulisse in einen kompakten modernistischen Schriftzug überführt, ziert inzwischen weit mehr als nur Tourismusbroschüren und Briefbögen. Es wird von der Tirol-Werbung in Lizenz an Unternehmen vergeben, die vom klar definierten Image der Marke Tirol profitieren wollen. Dieses Image – der sogenannte Markenkern – baut laut Eigendefinition auf folgenden Begriffen auf: eigenwillig – freiheitsliebend – echt – stark – stolz. Ein Katalog der Tirol-Klischees also, der zielgruppenspezifisch verfügbar ist, für Milchprodukte, Sportausrüstung oder Lodenbekleidung. Gleichzeitig funktioniert dieses Bild scheinbar auch hervorragend zur Identifikation der TirolerInnen mit ihrem Bundesland, viele haben das Logo als Aufkleber auf ihrem Auto. Diese Affirmation des Tourismusimage durch die Bevölkerung findet man auch in Kärnten, wo der handschriftliche Kärntnen-Schriftzug und die Tangram-Figur aus den Achtzigern sich besonders häufig zu den Typenbezeichnungen von Autos gesellt. Nachdem es noch einigen Aufruhr gab, als der Landeshauptmann vor einigen Jahren vom konfliktfreien Kärntenbild des Tourismusamtes profitieren wollte und den Schriftzug auf politischen Plakaten verwendet hatte, wurde das Logo inzwischen von der Landesregierung angeeignet und damit sowohl in der Kommunikation nach außen – zu UrlauberInnen –, als auch nach innen – zu den BürgerInnen – verwendet.
Damit wird das Logo wieder zum Hoheitszeichen und bleibt trotzdem frei zirkulierendes Icon, in direkter Konkurrenz zum Nike-Swoosh oder den Red-Bull-Stieren. Ganz im Zeichen des Logo-Fetischismus der neunziger Jahre kann so lokale Identität modisch präsent sein und fällt dennoch kaum auf. Denn so reduziert wie Logos sein müssen, um wiederkennbar und einprägsam zu sein, so austauschbar sind die meisten von ihnen, wenn sie nicht mit dem Werbebudget eines globalen Konzerns entwickelt und verbreitet werden. So sind die meisten Städtelogos ganz einfach schlechte Kopien des Real-Stuff und wirken schließlich genauso hilflos wie die dahinterstehenden Ideologien. Tone Hansen bemerkt in ihrem Artikel: „Auffällig ist, wie gleich alles wird, wenn das Ziel doch eine Differenzierung war.“ Sie verfolgt die Transformation norwegischer Staatsbetriebe und Institutionen zu ausgegliederten Wirtschaftsunternehmen und beklagt, wie damit wichtige Segmente der gesellschaftlichen Infrastruktur einer demokratischen Kontrolle entgleiten. Auch hier ist die grafische Repräsentation, die Corporate Identity, der sichtbare Ausdruck veränderter Ideologien und des Verlustes der Spezifizität eines Sozialstaates.
Andres Kurg beschreibt in seinem Beitrag eine Kampagne, die eigentlich den Zweck hatte, Estland auf der Weltkarte lokaler Klischees neu zu positionieren. Die Erinnerung an die Vergangenheit als Sowjet-Republik sollte Platz machen für einen aufstrebenden, von Informationstechnologien und nordischen Traditionen gleichermaßen geprägten skandinavischen Staat – „nordic with a twist“. Kurioserweise wurde die Kampagne schließlich nur innerhalb Estlands durchgeführt, der flotte Spruch „Welcome to Estonia“ war plötzlich an die eigene Bevölkerung gerichtet und diente wohl – ein Jahrzehnt nachdem die russischsprachigen Straßenschilder abmontiert worden waren – am ehesten der Umorientierung zur neuen, internationalisierten Leitkultur des Neoliberalismus,
Das Thema visuelle Identität ist nicht vollständig, ohne die gebaute Struktur einer Stadt mitzudenken. Dies sparen wir uns für einen möglichen zweiten Teil auf, in einem Artikel allerdings spielt gerade die Skyline einer Stadt eine wichtige Rolle. Sabine Gruber beschreibt anhand der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Wien die Rolle von Marketing als neuem Stadtplanungsparadigma. Ihr Text fokussiert auf die Wiener Hochhausentwicklung der letzten zehn Jahre, in denen es einer sozialdemokratischen Stadtregierung gelang, die kostenintensive und im Kern konservative Bauform Hochhaus auf breiter Basis akzeptiert zu machen und als wesentlichen Bestandteil einer modernen Stadt zu behaupten.
Die gegenwärtig unausweichlich scheinende und letztendlich homogenisierende Tendenz zum Branding von Orten verbirgt eine Vielzahl unterschiedlicher politischer Motive und Entwicklungen. dérive geht in den Beiträgen dieses Heftes den dynamischen Zusammenhängen von Stadtimage, Corporate Identity, Standortwettbewerb, touristischen Inszenierungen, Logoästhetik, Verwaltungsideologien und Identitätspolitik nach und schließt damit Lücken zwischen ebendiesen Feldern.dérive, Fr., 2006.04.14
14. April 2006 Andreas Fogarasi
Urbane Feldarbeiten in Prata Sannita
(SUBTITLE) Das Million Donkey Hotelprospekte
Trotz der vielbeachteten urbanen Leerstände, denen mit dem Diskurs über „shrinking cities“ ausgiebigst Aufmerksamkeit gewidmet wird, leben fast drei Viertel der Menschen Europas in Städten. Leerstand ist also kein rein urbanes Phänomen, sondern auch ein rurales Symptom. Dass dadurch auch im ländlichen Raum eine „urbane Strategie“ wirksam eingesetzt werden kann, beweist das Projekt Million Donkey Hotel“(1) von feld72.
Die ArchitektInnen wurden eingeladen, sich im Rahmen von Villaggio dell’Arte(2) in Italien mit Prata Sannita, einem Dorf in der Provinz Caserta im Parco del Matese, zu beschäftigen. Das Dorf hat eine bewegte Geschichte, die durch Migration und Mobilität bestimmt wird und wurde.
Prata Sannita ist als „Erfolg“ der Automobilisierung in zwei sehr unterschiedliche Teile getrennt: das am Hang liegende mittelalterliche Prata Inferiore, das auch „Borgo“ genannt wird, und das getrennt davon an einer Verbindungsroute den (auto)mobilen Ansprüchen entsprechend entstandene Prata Superiore. Durch die wirtschaftliche Entwicklung der Region ist seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eine stetige Fluktuation der BewohnerInnen festzustellen. Viele wanderten aus, manche von Ihnen besuchen jährlich im Sommer und zur Weihnachtszeit „ihr Dorf“ als Gäste, teilweise ziehen die Ausgewanderten im Alter wieder zurück und die Jungen sind noch da. Prata ist, wie auch die anderen an dem Projekt teilnehmenden Orte Capriati al Volturno, Fontegreca, Gallo Matese und Letino, durch seine erzwungenermaßen mobilen EinwohnerInnen ein „urban node“ geworden. Es gibt große Ortsgemeinschaften in New York oder der Schweiz. (Im benachbarten Dorf Gallo Matese wohnten 1921 noch über 3.000 Menschen, heute wohnen dort 800 Personen, in New York werden aber 1.500 Gallisti gezählt.) So findet in den Dörfern die Urbansisierung des ländlichen Raumes in den Handlungsweisen der „Zurückgekehrten“ statt.
Diese Situation des Ortes, dass die Migration – die Bewegung – das Verbindende sowohl zwischen den beiden Ortsteilen wie auch zwischen den BewohnerInnen ist, nahmen feld72 als Anknüpfungspunkt für ihr Konzept. Sie lasen das gesamte Dorf als Hotel, in dem noch Zimmer frei sind, um damit eine neue Bedeutungsebene der Migration einzuführen. Im Bereich des Borgo sollten „Zimmer“ eingerichtet werden, die sowohl für die „nicht sorgengetriebenen Nomaden“ genannten Touristen wie auch für die DorfbewohnerInnen neue Räume erschließen.
Dass dieses Konzept nur eine mögliche Form der Intervention darstellte, die Dimension und Ausformulierung jedoch vor Ort in einer Workshop-Situation entschieden wurde, verlieh dem Prozess eine kräftige Eigendynamik. Das Konzept wurde zum Selbstläufer. Durch die Wahl des Zeitraumes (1.-31. August 2005), des ferragosto(3), als Durchführungszeitraum, war die Grundvoraussetzung zur gemeinsamen Intervention gegeben. Täglich nahmen bis zu 43 Personen vier Wochen lang gemeinsam mit den ArchitektInnen die Transformation des Ortes selbst in die Hand. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn durch die Lage des Borgo am Hang sind die Gassen für Transportmaschinen zu eng. So fanden sonst nicht gemeinsam agierende BewohnerInnen mit verschiedensten Hintergründen eine Möglichkeit, mit vereinten Kräften einen Beitrag zum spielerischen Umdeuten zu leisten. Sie waren Bauherren und Bauarbeiter in Personalunion. Im Gegensatz zum solitären Heimwerker bot die permanente Diskussion mit den ArchitektInnen über das Konzept Entscheidungsmöglichkeiten über die Ausformulierung. Eine neue Verbindung entstand dadurch nicht nur zwischen davor einander distanziert begegnenden zurückgekehrten Alten und ausbrechenden Jungen, sondern auch zwischen ihnen und den ArchitektInnen. Der Wahnsinn der Anstrengung und der Wahnwitz der Entwürfe verbindet: „Ihr seid ja verrückt“ konnte feld72 mit „Ihr aber auch, denn ihr macht mit“ beantworten.
Das räumliche Ergebnis hat die Form eines lebhaften, widerspenstigen architektonischen Statements und widersetzt sich einer möglichen Kommerzialisierung. Die Zimmer sind alles andere als gemütlich – und doch stark in ihrer Ausdruckskraft. Silberraum, schwarzes Loch, das fliegende Bett oder das Bad mit 4,8 km Moschiera(4) wurden den fast verfallenen Leerräumen abgerungen. Sie bieten einmalige, mit dem Ort spielende Erlebnisse, aber keine gemütliche Atmosphäre zur distanzierten Erholung, wie sie einschlägige Hotelprospekte sonst versprechen. Der Gast muss sich mit dem Dorf und seinen BewohnerInnen auseinandersetzen. Er muss sich sein Hotel erarbeiten und es erforschen und kann sich nicht gemütlich in einem Transitraum abgekoppelt vom Umfeld niederlassen.
Nicht nur die Eingänge zu den Zimmern, auch der Ausgang des Projekts ist offen. In jedem Fall hat es einen positiven Impuls zur Annäherung doch so gegensätzlicher sesshafter „MigrantInnen“ geschaffen. Es hat wohl weniger Prata Superiore und Prata Inferiore verbunden als vielmehr Jung und Alt, wie auch Wohnende und Besuchende oder letztlich die DorfbewohnerInnen mit den ArchitektInnen.
Zukünftiges Konfliktpotenzial zwischen den WorkshopteilnehmerInnen und den anderen BewohnerInnen von Prata Sannita ist jedoch zu erwarten. Es sind die notwendigen gemeinsamen Definitionen der weiteren Schritte und die „alltägliche“ Betreuung, die ausdiskutiert werden müssen. Eine Gruppe der ortsansässigen Freiwilligen verwaltet als Verein das Hotel. Doch das verbindet sie auch wieder aufs Neue. Und dass nach dem Ende des Workshops noch ein weiteres „Zimmer“ durch die Dorfgemeinschaft ohne die ArchitektInnen errichtet wurde, ist ein Zeichen, dass das „frei von ...“ tatsächlich zu einem „frei zu ...“ umgedeutet werden konnte, wie es im Konzept erhofft wurde.
Mit dieser urbanen Strategie erarbeiteten feld72 mit den WorkshopteilnehmerInnen eine Situation, die das Anklingen einer spielerischen und gemeinschaftlichen Komponente in der Wiedererfindung des „Verlorenen“ beinhaltet und dadurch mehr Chancen bietet, die Leere in ein Potenzial zu verwandeln, als jedes durchkonstruierte „umfassende“ Projekt. Diese urbane Strategie, die vor allem aufgrund der im Dorf vorhandenen urbanisierten Handlungsweisen der BewohnerInnen einen Anknüpfungspunkt fand, kommerzialisiert den Ort nicht, denn das Million Donkey Hotel ist ein Hotel mit vielen Dauergästen.
Das „Million Donkey Hotel“ in Prata Sannita ist ein Projekt von feld72 im Themenbereich „memory“ des Villaggio dell’Arte 2005. Dieses ist ein Teil von PaeSEsaggio – Azione Matese.dérive, Fr., 2006.04.14
1 Der Titel des Projekts geht auf eine erste Veröffentlichung des Konzepts zurück, als ein Journalist der Tageszeitung „La Repubblica“ sich den Titel aus den Aussagen der ArchitektInnen herausfilterte. Dass das Projekt tatsächlich mehr auf Kraft- statt auf Geldeinsatz gegründet war, spiegelt sich darin gut wieder.
2 An Villaggio dell’Arte nahmen acht internationale KünstlerInnen bzw. KünstlerInnengruppen teil. Sie wurden eingeladen, sich mit den fünf teilnehmenden Dörfern der Region zu beschäftigen. Das Million Donkey Hotel ist dadurch Teil einer Route entlang verschiedenster Kunstinstallationen.
3 ferragosto ist der arbeitsfreie Urlaubsmonat in Italien. In dieser Zeit kommen auch die MigrantInnen in „ihre Dörfer“ zurück auf Besuch.
4 Moschiera sind die Schnüre, welche die offenen Eingänge in den südlichen Regionen Italiens gegen anfliegende Insekten abschirmen sollen.
14. April 2006 Erik Meinharter