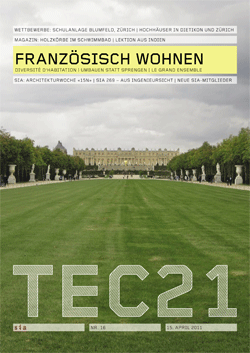Editorial
Frankreich zehrt vom Mythos, die Demokratie erfunden zu haben. Beim Bauen aber kennt es kaum Formen von Selbsthilfe, Mitsprache oder kollektiver Eigenverantwortung. Nur beim Einfamilienhaus ist Eigenbau verbreitet. Wohnbaugenossenschaften wie in der Schweiz, in denen Mitglieder ein weitgehendes Mitspracherecht haben, oder Bauprojekte selbstverwalteter Kulturzentren wie in Deutschland gibt es im Hexagon kaum. Kulturhäuser und bezahlbare Wohnungen erwartet man vielmehr vom Staat. Dieser tut denn auch viel. Er subventioniert etwa jede fünfte Wohnung im Land, und der König, pardon: der Präsident oder die Bürgermeister lassen berühmte Architekten bauen.
Die damit verbundenen Haltungen – passive Erwartung auf der einen Seite, paternalistisches Verordnen von technokratisch konzipierten, bürokratisch verwalteten und tausendfach angewandten architektonischen Grossformen auf der anderen Seite – geraten jedoch mehr und mehr in Widerspruch zum Gebot der Nachhaltigkeit. Denn diese verlangt eher angepasste, sensible, reversible und lokale Strategien, die das Wissen und die Erfahrungen der Benutzenden integrieren.
Umso erfreulicher sind die Entwicklungen, über die wir in dieser Ausgabe berichten können: Der soziale Wohnungsbau erlebt in Frankreich eine Blüte und zeigt neue ökologische und soziale Qualitäten. Zwei Ausstellungen in Paris haben uns zu einem Überblick über neue Tendenzen inspiriert.
Dann haben wir ein Projekt herausgepickt: Das Architekturbüro Lacaton & Vassal erneuert zusammen mit Frédéric Druot ein Hochhaus in Paris und lässt dabei die Bewohnerinnen und Bewohner mitplanen. Der Ansatz setzt auf Lowtech und soziale Kompetenz und könnte dem Umgang mit Wohnbauten der Nachkriegsmoderne einen neuen Impuls verleihen.
Den dritten Bericht verdanken wir Francesco Della Casa, der seit 1999 die Redaktion unserer französischsprachigen Schwesterzeitschrift «Tracés» in Lausanne leitet. Er verlässt uns Ende April, um seine neue Stelle als Genfer Kantonsarchitekt anzutreten. Der Beitrag «Le grand ensemble» ist sein journalistischer Abschiedsgruss an die Deutschschweiz. Dieser gilt Patrick Bouchain, dessen Schaffen er in «Tracés» seit Jahren begleitet hat. Der für seine Kulturbauten bekannte französische Architekt verfolgt einen radikal demokratischen Ansatz. Seine Baustellen sind Lebensorte: Hier wird gemeinsam geplant und gebaut, gekocht und gegessen, geprüft und bewilligt, gelernt und gefeiert. Am Ende ist die Siedlung erneuert, aber auch die Gemeinschaft, die sie bewohnt. Das ist Nachhaltigkeit, sagt Bouchain. – Das ist nun tatsächlich eine Erfindung aus Frankreich, finden wir.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neubau Schulanlage Blumfeld, Zürich | Hochhaus in Dietikon ZH | Hochhaus in Zürich Altstetten
12 PERSÖNLICH
Anthony B. Almeida: «Ein Architekt sollte Humanist sein»
15 MAGAZIN
Holzkörbe im Schwimmbad | Lektion aus Indien | Die Entdeckung der Nachhaltigkeit | Autarke Redaktionshütte
22 DIVERSITÉ D’HABITATION
Ruedi Weidmann Der Wohnungsbau erlebt in Frankreich eine Blüte als architektonisches Experimentierfeld des ökologischen und sozialen Stadtumbaus. Ein Überblick anhand zweier Ausstellungen.
26 UMBAUEN
STATT SPRENGEN
Ruedi Weidmann Moderne Grosssiedlungen würden besser erneuert statt ersetzt, finden Druot, Lacaton & Vassal. Am Hochhaus Bois le Prêtre machen sie vor, wie Nachkriegswohnungen grosszügig und umweltgerecht werden und dabei günstig bleiben.
30 LE GRAND ENSEMBLE
Francesco Della Casa Patrick Bouchain inszeniert Planen und Bauen als demokratischen und vergnüglichen Prozess. Nach zwanzig Kulturfabrik-Projekten überträgt er das Prinzip nun auf den Wohnungsbau.
38 SIA
Architekturwoche «15n» | Zukunftsperspektiven für die Welt | SIA 269 – aus Ingenieursicht | Beitritte zum SIA im 4. Quartal 2010 | Aktuelle Kurse SIA-Form
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Diversité d’Habitation
Der Wohnungsbau erlebt in Frankreich derzeit eine Blüte. Er ist zum architektonischen Experimentierfeld für den ökologischen und den sozialen Stadtumbau geworden. Eine kürzlich präsentierte und eine laufende Ausstellung in Paris geben einen Überblick über aktuelle Aufgaben und Umsetzungen.
Unter dem Titel «Habiter 10.09/09.10» zeigte das städtische Architekturforum Pavillon de l’Arsenal letztes Jahr die Resultate aus 40 Architekturwettbewerben für Wohnbauprojekte in Paris: die Modelle der 40 Sieger, dazu Pläne von 170 Eingaben. Ein Teil der Vorhaben ist über das ganze Stadtgebiet verteilt, die meisten liegen aber in Entwicklungsgebieten im Norden und Osten entlang des Boulevard périphérique. Dieser Autobahnring, der seit einem halben Jahrhundert Paris und seine Vororte trennt, wird an mehreren Stellen überdeckt, es entstehen Parks und damit neue Wohnlagen. Bisher von Verkehrsinfrastruktur dominiertes Niemandsland wird als Stadtraum gestaltet und mit einer Tram-Ringlinie erschlossen, Lagerhäuser weichen Wohnbauten. Paris mit seinen 2 Mio. Einwohnern und seine Vororte mit rund 12 Mio. sollen endlich zusammenwachsen.
Dagegen präsentiert die Ausstellung «Vers de nouveaux logements sociaux» in der Cité de l’architecture im Palais de Chaillot 16 besonders innovative Wohnbauprojekte aus ganz Frankreich in Modell, Bild und Text und dazu weitere 60 in einem Plakatpanorama.[1] Diese Ausstellung dauert noch bis zum 17. Juni 2011.
Wohnbau als ArchitekturLabor
Um die präsentierten Projekte zu beurteilen, hilft es, sich die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus in Frankreich zu vergegenwärtigen: Mehr als 11 Mio. Menschen leben in rund 4.5 Mio. Sozialwohnungen. Die Hälfte der Bauten ist von 1963 bis 1977 entstanden. Das nationale Klimaschutzprogramm verlangt, dass bis zum Jahr 2020 800 000 Wohnungen heutigen Umweltnormen angepasst werden. Ein im Jahr 2000 erlassenes Gesetz legt den Anteil der Sozialwohnungen in allen Gemeinden auf mindestens 20 % fest.[2] Weil diese Quote längst nicht überall erreicht wird, finanzierte der Staat von 2006 bis 2009 den Bau von 360 000 zusätzlichen Wohnungen. Schon damals standen über eine Million Menschen auf Wartelisten für eine Sozialwohnung; als Folge der Wirtschaftskrise ist die Nachfrage seither noch gestiegen. In grösseren Städten sind Normalverdiener mit Kindern darauf angewiesen. Private Bauinvestitionen gingen zurück, dafür investieren Staat und Gemeinden zur Stützung der Bauwirtschaft verstärkt in den Wohnungsbau.
+
Das bedeutet, dass heute in Frankreich laufend tausende von Wohnbauprojekten geplant und gebaut werden. Für die Architekturschaffenden gilt es, Umweltfreundlichkeit, nachhaltige Stadtentwicklung und gesellschaftlichen Wandel in Architektur zu übersetzen. Aus all diesen Gründen erlebt der Sozialwohnungsbau eine Blüte und dient, wie Cité-Präsident François de Mazières im Vorwort des Ausstellungskatalogs schreibt, einmal mehr als Labor der Architekturentwicklung.[3] Vor diesem Hintergrund kommt der Prämierung guter Projekte und der öffentlichen Diskussion ihrer Stärken und Schwächen enorme Bedeutung zu. Lässt sich dabei auch aus Schweizer Sicht etwas lernen?
Grundrisse und Städtebau
Alle gezeigten Projekte zeugen vom Bestreben, den sozialen Anspruch mit architektonischer Qualität zu verbinden, umweltbewusst zu bauen und veränderten Familienformen und Lebensstilen Rechnung zu tragen. Die Themen und Entwicklungsschritte der letzten Jahre sind die gleichen wie hierzulande, nur teilweise anders gewichtet und zeitlich etwas verschoben. Sehr verschieden sind aber die Rahmenbedingungen durch Gesetze und Baunormen. Überregulierung schränkt die Spielräume stark ein, vor allem bei den Wohnflächen (vgl. Kasten S. 22). Im Vergleich mit Schweizer Wohnungen wirken deshalb fast alle Grundrisse unpraktisch und beengend. Umso mehr Gewicht wird auf die äussere Form und einen spektakulären städtbaulichen Auftritt gelegt. Hier ist die formale Vielfalt und Lebendigkeit beeindruckend. Etliche Projekte wirken zwar effekthascherisch, aber es gibt auch Gegenbeispiele wie die Überbauung Quatuor an der Porte d’Auteuil. Anne Démians, Rudy Ricciotti, Francis Soler und LIN bauen hier je ein Mehrfamilienhaus. Weil alle vom gleichen Betonskelett ausgehen, entsteht ein wohltuend ruhiger Gesamteindruck (Abb. 1).
Ökologisch = grün = Bäume
Im Bereich des umweltfreundlichen Bauens, wo sich in Frankreich lange nichts bewegt hat, ist gegenüber der Schweiz ein Rückstand von zwei, drei Jahrzehnten aufzuholen. Wie in der Schweiz bis noch vor wenigen Jahren wird «umweltfreundlich» mit «grün» assoziiert und oft wörtlich umgesetzt. So sind viele Bäume und Büsche auf Dächern und Terrassen zu sehen und ostentative Holzelemente an Fassaden (Abb. 2– 6). Solche Gestaltung zeugt von einer intensiven Suche nach architektonischer Umsetzung des Nachhaltigkeitsgebots und reagiert wohl auch auf entsprechende Wünsche von Politik, Wohnbaugesellschaften und Publikum.
Mixité und Renaissance des Balkons
Das grosse städtbauliche Thema der 1990er-Jahre in Paris, die Stadtreparatur, ist weiterhin aktuell. Für das Bauen auf komplexen Parzellen im historischen Kontext gibt es einige schöne Beispiele. Neu daran ist die funktionale Mischung (Mixité): Eine öffentliche Erdgeschossnutzung hat sich durchgesetzt und bereits fest etabliert – aus ökologischen Überlegungen (Mischung von Wohnen und Arbeiten, um Pendlerverkehr zu vermeiden) wie auch aus gesellschaftlichen (lebendige und sozial durchmischte Quartiere) (Abb. 7– 8). Auch bei der Gestaltung der Fassaden in den Obergeschossen wird der Bezug vom Haus zur städtischen Umgebung thematisiert, in einigen Projekten auch durch eine komplex aufgebrochene Kubatur (Abb. 9). Der Balkon erfährt eine Renaissance: Fast bei allen Projekten sind die Fassaden raumhaltig geworden und öffnen sich auf vielfältige Arten gegen Stadt und Strasse. Grosse Terrassen und Wintergärten sollen im Zeichen verdichteten Bauens Einfamilienhaus-Qualitäten ins Mehrfamilienhaus bringen. Dieser Gedanke findet manchmal einen übertriebenen formalen Ausdruck (Abb. 10, 12). Doch zeigen solche Beiträge, dass sich ihre Verfasser nicht nur mit der Frage nach der zeitgemässen Sozialwohnung beschäftigen, sondern den Wohnungsbau als vielschichtigen Beitrag zu einer wieder ganzheitlicheren Stadtentwicklung begreifen.
Einige Projekte kommen gewissermassen von der anderen Seite: Sie fassen Einfamilienhäuser zu Anlagen zusammen, die mehr Qualitäten bieten als das übliche banale Nebeneinander. Freilich kann auch diese Idee allzu wörtlich umgesetzt werden (Abb. 13). Bei Projekten ohne Läden oder Café bleibt der Bezug Erdgeschoss / Strasse allerdings ungelöst. Auf das Pro- blem der Erdgeschosswohnung hat man oft keine bessere Antwort als das bekannte Gitter zwischen Trottoir und Haustür, das die formal-symbolische Öffnung der Fassade darüber ebenso konterkariert wie den plakativ kommunikativen Projektnamen (Abb. 6, 9, 11, 14). Alles in allem ist ein emsiges Suchen nach architektonischen Antworten auf heutige Bedürfnisse und Herausforderungen festzustellen und eine erfreuliche Vielfalt an ausprobierten Richtungen. Es ist zu hoffen, dass möglichst viel davon in die Massenproduktion einfliessen kann. Dazu aber müssen dringend die Baugesetze, Normen und Subventionsregeln vereinfacht werden.
Und umbauen?
Angesichts des enormen Sanierungsbedarfs beim Bestand erstaunt, dass in den beiden Ausstellungen nur ein einziges Projekt vorgestellt wird, das sich dem Umbau moderner Wohnbauten widmet. Dieses hat es allerdings in sich: Lacaton & Vassal haben zusammen mit Frédéric Druot einen Weg gefunden, wie bei Sanierungen die restriktiven Flächennormen umgangen und bestehende Wohnungen mit relativ wenig Geld massiv vergrössert, energetisch saniert und in der Wohnqualität aufgewertet werden können. Ihr Ansatz könnte dem Umgang mit dem umfangreichen und problembeladenen Erbe der Moderne auch über Frankreich hinaus einen Impuls geben. Bei der Renovation der Tour Bois le Prêtre in Paris wird das Prinzip zum ersten Mal in die Tat umgesetzt (vgl. «Umbauen statt Sprengen», S. 26).TEC21, Do., 2011.04.14
Anmerkungen:
[1] Kuration: Jean-François Pousse, Architekturkritiker, und Francis Rambert, Direktor der Cité
[2] In der Schweiz gibt es keine entsprechende Vorschrift; der Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus liegt unter 9 %, in Zürich ist er mit 25 % am höchsten
[3] Vers de nouveaux logements sociaux. Silvana Editoriale 2009
14. April 2011 Ruedi Weidmann
Umbauen statt sprengen
Moderne Grosssiedlungen sollten nicht ersetzt, sondern verbessert werden, fordern Frédéric Druot, Anne Lacaton und Philippe Vassal in einer Studie. Am Hochhaus Bois le Prêtre in Paris zeigen sie, wie es geht. Unter Umgehung einiger Normen entsteht für halb so viel Geld mehr Lebensqualität.
Unter den Baustellen in Paris ragt eine besonders heraus – nicht weil sie spektakulär wäre, im Gegenteil: Das eingerüstete Wohnhochhaus am Boulevard péripherique ganz im Nordwesten ist leicht zu übersehen. Doch die Sanierung der Tour Bois le Prêtre durch Druot, Lacaton & Vassal gehört im Moment zu den am aufmerksamsten beobachteten Bauprojekten in Frankreich. Denn der Eingriff könnte den Umgang mit den Wohnsiedlungen aus der Nachkriegszeit in Frankreich und darüber hinaus verändern.
Studie gegen den Ersatzneubau
Der Reparaturbedarf im sozialen Wohnungsbau in Frankreich ist riesig (vgl. auch «Diversité d’habitation», S. 22). Die vielen Siedlungen aus der Nachkriegszeit haben grosse ökologische und soziale Defizite. Seit 1990 besteht ein staatliches Programm zum Teilabbruch; 2007 wurden 6 Mrd. Euro für die Aufwertung von Grosssiedlungen gesprochen, unter anderem für den Abbruch und Ersatzneubau von 250 000 Wohnungen. Vor allem das schlechte Image der Grands Ensembles soll verschwinden.
Im Auftrag des Kulturministeriums haben Frédéric Druot, Anne Lacaton und Philippe Vassal dazu die Studie «Plus»[1] erarbeitet. Darin sprechen sie sich wegen der Wohnungsnot, der hohen Kosten, der Verschwendung grauer Energie und aus Respekt für die Bewohner vehement gegen Abbrüche aus. Man müsse die Wohnungen verbessern, nicht die städtebauliche Grossform der Siedlungen ändern. Mit den 167 000 Euro, die das Programm für Abbruch und Neubau einer Wohnung vorsehe, könnten zwei Wohnungen saniert und aufgewertet werden. In den Grosssiedlungen liessen sich mit wenigen Massnahmen grössere Wohnungen, neue Wohntypologien sowie Serviceeinrichtungen realisieren und die durchaus vorhandenen Qualitäten – Aussicht, Grünräume, frei nutzbare Raumreserven – weiterentwickeln.
Die Studie zeigt auf, wie sich die rigiden Flächennormen des Sozialwohnungsbaus mit dem Anbau grosser Wintergärten aushebeln lassen, da diese nicht als Wohnfläche zählen. Das machte Furore, denn der Vorschlag stammte von Architekten, die mit ihrem Beitrag zur Cité Manifeste in Mülhausen bereits bewiesen hatten, dass Sozialwohnungen dank Wintergärten gross, schön und günstig sein konnten (vgl. TEC21 6/2005). Lacaton & Vassal, die 2001 mit dem Umbau des Palais de Tokyo in Paris erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden, sind spätestens mit dem Bau der Architekturhochschule in Nantes und der Verleihung des Grand Prix National d’Architecture 2008 im Kreis der Erlauchten angekommen. Als Jean Nouvel 2009 – auf einen Aufruf des Staatspräsidenten hin – seine Vision eines nachhaltigen Grossparis veröffentlichte, liess er Lacaton & Vassal das Kapitel zum Wohnungsbau schreiben und ihre Umbauidee illustrieren – der weitaus konkreteste Beitrag in dem pathetischschönen Wälzer.[2] Mit der Tour Bois le Prêtre setzen sie die Idee nun erstmals in die Tat um.
Gross, hell und günstig
Das 17-stöckige Wohnhochhaus Bois le Prêtre gehört der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Paris. Es wurde 1958–1961 von Raymond Lopez erbaut und war einmal eine Ikone der Moderne (Abb. 1–8). Um 1990 erhielt es eine Aussendämmung, Eternitplatten und Kunststofffenster verpasst. 2005 gewannen Lacaton & Vassal mit folgendem Konzept einen eingeladenen Wettbewerb zum Umbau: Die Fassaden der Längsseiten werden durch Glasschiebetüren ersetzt. Davor wird ein selbsttragendes Stahlgerüst mit Betondecken aufgestellt, es enthält 2 m tiefe Wintergärten und einen 1 m tiefen Balkon, getrennt durch verschiebbare Sonnenschutzpaneele aus Polykarbonat. Das Gestell aus vorfabrizierten und Serienprodukten wird in wenigen Monaten aufgebaut; die Wohnungen bleiben dabei bewohnt.
Die neue Raumschicht halbiert den Heizaufwand, vergrössert die Wohnungen um über 50 %, lässt Licht hinein und gewährt mehr Aussicht. Einfache Thermovorhänge aus Alufolie, Schurwolle und Stoff dienen nachts als zusätzliche Isolation. An den Schmalseiten entstehen neue Zimmer und neue Lifte, damit alle Split-Levels rollstuhlgängig werden. Einige Wohnungen werden vergrössert, andere verkleinert. Die Neueinteilung wurde in Workshops mit den Bewohnerinnen und Bewohnern nach deren Bedürfnissen geplant. Denn sozial wirklich nachhaltige Projekte sind für Lacaton & Vassal nur möglich, wenn die Nutzenden weitgehend mitplanen können. Im Erdgeschoss entstehen nun verglaste Räume für Concierge, Kindergarten, Mietertreff, Sprachkurse und Aufgabenhilfe. Alle Massnahmen stärken vorhandene Qualitäten des Bauwerks, die sorgfältig und mithilfe der Bewohner analysiert wurden. Die Renovation kommt gut voran und wird im Sommer 2011 fertig sein. Funktioniert das Prinzip wie gewünscht und zu den vorgesehenen Kosten, dann könnte es schon bald Verbreitung finden. Manche «Problemsiedlung» in der Banlieue könnte durch diese Umbaumethode auch für den Mittelstand attraktiv werden. Das würde helfen, die soziale Durchmischung in Frankreichs Agglomerationen zu verbessern.
Légèreté, Liberté, Gnérosité
Am Anfang der Karriere von Lacaton & Vassal steht eine Art büroeigene Urhütte: das Haus Latapie von 1993 in Floirac bei Bordeaux. Alle späteren Projekte basieren auf Prinzipien, die bei diesem einfachen Einfamilienhaus mit riesigem Wintergarten erstmals ausprobiert wurden (Abb. 9–12). Im Zentrum steht die Lebensqualität der Nutzer. Für Lacaton & Vassal heisst das in erster Linie viel Raum für wenig Geld. Sie erreichen dies durch einen pragmatischen und witzigen Umgang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und eine innovative Nutzung vorhandener Materialien und Qualitäten. Die selbstgewährte Freiheit beim Einsatz günstiger Materialien resultiert in einer Ästhetik der Leichtigkeit und in grosszügigen, offenen, wenig definierten Räumen, die den Nutzern viel Freiheit für die individuelle Aneignung und (Um-)Nutzung lassen. Auch Energiesparen soll mehr Lebensqualität bringen. Eine zweite Isolationsschicht etwa wird dann sinnvoll, wenn sie so tief ist, dass man sie als Wintergarten bewohnen kann. Rein technische Lösungen interessieren Lacaton & Vassal nicht.
Normen sprengen, Stadt verdichten
Lacaton & Vassal brechen viele Konventionen. Vor allem aber lehnen sie Normen und Reglemente ab, wenn diese Baustandards reproduzieren, die für heutige und zukunftsfähige Lebensstile ungeeignet sind – weil sie Flächen monofunktional definieren, zu uniformen Grundrissen führen oder Komfort technisch statt räumlich und sozial definieren. Ihre Forderung nach mehr Wohnfläche muss vor dem Hintergrund der realen Verhältnisse in Frankreich verstanden werden. Einen Widerspruch zum verdichteten Bauen sehen sie darin nicht, vielmehr eine Bedingung dafür: «Wir müssen Wohnformen schaffen, die Dichte, Nähe, Qualität, Luxus und Genuss fördern. Es geht darum, neue Wohnverhältnisse zu schaffen, die bei den Bewohnern die Idee und die Lust wecken, zusammen in einer dichteren Stadt zu wohnen, indem wir das Bedürfnis nach Individualität und Privatheit berücksichtigen, das sich oft im Wunsch nach einem eigenen Haus äussert», sagte Anne Lacaton am Nationalen Wohnbaukongress 2007 in Zürich. Hier liegt die eminente städtebauliche Bedeutung des Projekts Bois le Prêtre: Wer in einer schönen Wohnung lebt, Haus und Gemeinschaftsräume gemeinsam mit den Nachbarn plant und betreibt und dies als positive Erfahrung erlebt, ist wohl eher bereit, eine höhere Dichte im Quartier zu akzeptieren. Lacaton & Vassal entwickeln das Prinzip dahin gehend weiter. In der Siedlung La Chesnaie in St-Nazaire wird das Renovationskonzept von Bois le Prêtre mit neuen Anbauten kombiniert (Abb. 13–15). In einem unrealisierten Projekt bei Poitiers schlagen sie zweistöckige Wintergärten vor und transportieren damit Einfamilienhausqualitäten in ein Hochhaus (Abb. 16–18). Damit zeigen Lacaton & Vassal günstige und einfache Wege zur Sanierung von Wohnbauten der Nachkriegszeit auf, die für viele Wohnbauträger – vielleicht sogar weltweit – gangbar sein dürften.TEC21, Do., 2011.04.14
Anmerkungen:
[1] Frédéric Druot, Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal: PLUS – Les grands ensembles de logements – Territoires d’exception. Gustavo Gili SL, Barcelona 2007
[2] Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal: «Plus, mieux» in: Jean Nouvel u. a.: Naissances et renaissances de mille et un bonheurs parisiens. Les éditions du Mont-Boron 2009, S. 310 f.
[3] www.lacatonvassal.com
[4] Bauwelt 27/2007, S. 24–29
[5] Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal: Lacaton & Vassal, Edition HYX 2009
[6] 2G Libros Books, Lacaton & Vassal, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2007
14. April 2011 Ruedi Weidmann