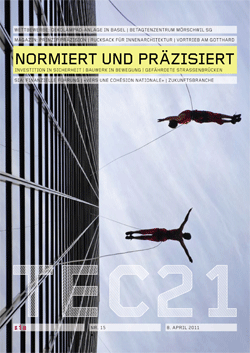Editorial
Die Wahrnehmung von Sicherheit ist subjektiv. Sie hängt von eigenen Erfahrungen und vom fachlichen Hintergrund ab sowie von plötzlich auftre-tenden Grossereignissen. Uns stockt der Atem, wenn Luftakrobaten an hohen Bauwerken ihre einstudierten und präzisierten Bewegungen ausfüh-ren; die Sportler hingegen fühlen sich sicher, weil sie ihre Haltevorrichtungen kennen.
Regelwerke wie Normen und Richtlinien grenzen diesen emotional geprägten «Streubereich» ein – auch im Bauwesen. Sie tragen objektiv dazu bei, die Personensicherheit zu garantieren und die uneingeschränkte Nutzung für den vorgesehenen Zweck zu gewährleisten. Hier müssen vielfältige architektonische Ansprüche mit dieser normkonformen Arbeitssicherheit und den technischen sowie nutzungsspezifischen Anforde-rungen zu einem Endprodukt zusammengeführt werden. Das kostet Planungszeit und Geld – diesem Umstand wird in vielen Neubauprojekten ein zu kleiner Stellenwert eingeräumt, bemängelt Roland Bärtschi in «Investition in Sicherheit». Denn Sparmassnahmen beim Neubau können zur Folge haben, dass der Erhalt der Bauwerke aufwendiger und kostspieliger wird. Fachfremde Personen sehen manche bauspezifischen Vorkeh-rungen als teuer erkaufte Überperfektion – sie tragen aber dazu bei, die Normen einzuhalten. So sind auch die aufwendigen Vermessungsarbei-ten an Hochhäusern bereits während der Bauphase unumgänglich für eine präzise ausgeführte Tragkonstruktion («Bauwerk in Bewegung»).
Bei aller Wichtigkeit der Normen, ihr Inhalt – es betrifft die Tragsicherheit ebenso wie die Gebrauchstauglichkeit – ist nicht absolut. Er ist abhän-gig vom fachlichen Wissensstand, der sie definiert. Und dieser verändert sich: Es wird geforscht, es werden neue Erkenntnisse gewonnen und Erfahrungen gesammelt. Dies führt dazu, dass der Normeninhalt aktualisiert werden muss. So geschieht es, dass bislang ausreichend sichere Bauwerke plötzlich nicht mehr als ausreichend sicher gelten. Die Untersuchungen, die das Bundesamt für Strassen (Astra) von verschiedenen Ingenieurbüros an bestehenden Brücken durchführen liess und Ende 2010 abgeschlossen hat zeigen auf, wie sich ein solcher Entwicklungspro-zess auswirken kann («Gefährdete Strassenbrücken»).
Clementine van Rooden, Katinka Corts
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Oekolampad-Anlage in Basel | Betagtenzentrum Mörschwil SG
10 MAGAZIN
Relaciones – Relações | Prinzip Präzision | Ein Rucksack für die Innenarchitektur | Der Vortrieb am Gotthard ist beendet
20 INVESTITION IN SICHERHEIT
Roland Bärtschi Gefühlte und statistische Sicherheit liegen oft weit auseinander. Sparen beim Neubau kann Sicherheit verringern und hohe Folgekosten bei Renovationen nach sich ziehen.
22 BAUWERK IN BEWEGUNG
Jörg Habenberger, Dorothée Braun Setzungen und Stauchungen spielen bei Hochhäusern während der Bauphase eine zentrale Rolle. Am Beispiel des Mobimo Towers in Zürich West zeigen die Autoren die Gründe dafür auf.
26 GEFÄHRDETE STRASSENBRÜCKEN
Stefan Kun Mit den steigenden Verkehrslasten auf Schweizer Strassen erhöht sich die Querkraftgefährdung einer ganzen Brückengeneration. Bauwerke, die nach den SIA-Normen von 1956 projektiert wurden, sind besonders kritisch.
31 SIA
Finanzielle Führung | Ausschreibung «Prix Acier 2011» | «Vers une cohésion nationale» | Einstieg in Zukunftsbranche | CAS Unternehmensfüh-rung
35 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Investition in Sicherheit
Gefühlte und objektive Sicherheit liegen oft weit auseinander. Auch im Bauwesen sollte die objektive Sicherheit so hoch wie vernünftigerweise möglich sein. Risiken sind dabei auf ein gesellschaftlich akzeptiertes Mass zu beschränken, unsinnig riskante Sparübungen hingegen zu vermeiden.
Menschen streben meist möglichst viel Sicherheit an. Dabei wird jedoch nicht unbedingt die wissenschaftlich fundierte, objektive Sicherheit, sondern die emotional gewichtete Sicherheit beachtet. So haben viele Menschen im Flugzeug Angst, fühlen sich aber hinter dem Steuer sicher. Objektiv gesehen müsste es umgekehrt sein. Subjektive und objektive Sicherheit können also sehr stark voneinander abweichen. Unsere Bauwerke beispielsweise sind sehr sicher, aber nicht absolut sicher. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Mit steigendem Aufwand können Risiken zwar reduziert, aber nie ganz eliminiert werden. Wie hoch das Sicherheitsbedürfnis in einer Gesellschaft ist, hängt stark von den kulturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Zwar ist ein Menschenleben in unserer Kultur unermesslich viel Wert, aber es stehen nicht unbegrenzte Mittel bereit, um Menschenleben zu schützen. Die heutigen Normen bieten einfache Regeln, die das von Bauwerken ausgehende Risiko auf ein gesellschaftlich akzeptables Mass beschränken sollen. Dabei sind aber grosse Unterschiede in den verschiedenen Aspekten von Bauwerken festzustellen. So werden Risiken, die von Elektroinstallationen ausgehen, ganz anders bewertet als Risiken infolge von Brand oder statische Risiken.
Bei den klassischen Tragwerksnormen werden die Einwirkungen mit Lastfaktoren versehen und die Tragwiderstände mit Widerstandsbeiwerten abgemindert. Mit erhöhten Lasten und reduzierten Widerständen wird dann der Nachweis geführt, der eindeutig zeigt, dass «es hält» oder eben nicht. In vielen Fällen, insbesondere bei der Erhaltung von Bauwerken, ist diese Methode aber kaum brauchbar. Hier empfiehlt es sich, die vorhandene Sicherheit mit der durch die Normen geforderten zu vergleichen und daraus abzuschätzen, wie dringend eine Massnahme ist. Der SIA hat mit dem Merkblatt SIA 2018 eine solche Risikoabschätzung für die Erdbebensicherheit bestehender Bauwerke dokumentiert. Hierzu wurde auf Grundlage von Artikel 58 des Obligationenrechts die Verhältnismässigkeit von Massnahmen zur Verbesserung der Erdbebensicherheit beurteilt. Als Kriterium wurde die auch beim Bau der Zürcher S-Bahn angewandte Regel verwendet, wonach eine Massnahme ergriffen werden soll, falls pro 10 Mio. Franken Investition statistisch gesehen mindestens ein Menschenleben gerettet werden kann. Heute bieten spezialisierte Ingenieurbüros auch für weitere Themenbereiche ein «Risk Based Design» an, bei dem probabilistische statt klassischer Nachweise geführt werden.
Unsichere Bauwerke?
Bei statischen Bewertungen von bestehenden Bauwerken zeigt sich oft, dass ein beträchtlicher Anteil nicht die Normsicherheiten aufweist. So erfüllen z. B. nur etwa 1⁄3 der untersuchten Einstellhallen die heutigen Normen. Einzelne weisen weniger als 50 % des von den heutigen Normen geforderten Tragwiderstands auf. Bei der Ermittlung der Erdbebensicherheit von Gebäuden sind gar Erfüllungsgrade von unter 10 % nicht selten. Das durchschnittliche Wohnhaus liegt im Bereich zwischen 30 und 50 % des Erfüllungsgrades.1 Bei Neubauten werden wirtschaftliche Aspekte stark in Betracht gezogen. Nebst der sinnvollen Suche nach günstigen Lösungen sind leider auch «Optimierungsmassnahmen» häufig, die die Sicherheit stark vermindern können. Wenn sich Ingenieure zu einer um einige Franken günstigeren Durchstanzlösung drängen lassen, kann der Bauherrschaft durch die reduzierte Robustheit ein erheblich höheres Risiko entstehen. Bei der Erhaltung solcher Bauwerke wird dann deutlich, dass durch Zusatzinvestitionen von wenigen hundert Franken beim Neubau spätere Sanierungskosten von mehreren hunderttausend Franken hätten vermieden werden können. Solche kurzsichtigen Fehlentscheide müssen in Zukunft weitsichtigeren Lebenszyklusbetrachtungen weichen.
Sicherheitsorientiertes Portfoliomanagement
Institutionelle Bauherren sehen sich angesichts veränderter Randbedingungen und begrenzter Unterhaltsbudgets grossen Herausforderungen im Portfoliomanagement gegenüber. Gängig sind etwa periodische Arbeiten an Gebäudehülle und Haustechnik oder Abdichtungsarbeiten und Korrosionsbehandlungen. Als Folge von neueren Erkenntnissen, die erst teilweise in die aktuellen Tragwerksnormen eingeflossen sind, müssen auch statische Gesichtspunkte vermehrt berücksichtigt werden. Daher suchen institutionelle Eigentümer nach Möglichkeiten, bereits in einem früheren Untersuchungsstadium unnötige Investitionen zu vermeiden und die verfügbaren Mittel gezielt auf besonders risikobehaftete Objekte im Portfolio zu lenken. Aufgeschlossene Eigentümer führen bereits heute Triagelisten, auf denen die Objekte nach statischem Risikopotenzial sortiert sind. Solche Listen können mit Aufwendungen von wenigen hundert Franken pro Objekt erstellt werden und helfen bei der sicherheitsorientierten Investitionsplanung.
Die jüngsten Ereignisse in Neuseeland und Japan weisen darauf hin, dass sich Art und Ausmass gesellschaftlich akzeptierter Risiken und die zur Gewährleistung der geforderten Sicherheit nötigen Vorkehrungen verändern können. Wissenschafter und Ingenieure sind gefragt, aufgrund von rationalen Sicherheitsüberlegungen zur Sicherheit beizutragen. Eigentümer und letztlich die Gesellschaft tragen die von Bauwerken ausgehenden Risiken. Diese Verantwortung sollte sich vermehrt auch in der guten Ausbildung und sorgfältigen Auswahl geeigneter Planer und in sicherheitsorientiertem Portfoliomanagement niederschlagen. Nur mit gemeinsamen, vorbehaltlosen Anstrengungen können Risiken soweit möglich reduziert werden.TEC21, Fr., 2011.04.08
Roland Bärtschi, Dr. sc. techn., dipl. Bauing. ETH/SIA/USIC, Urech Bärtschi Maurer Consulting AG, Ehrendingen
08. April 2011 Roland Bärtschi
Bauwerk in Bewegung
Gebäude bewegen sich, erfahren Setzungen, Stauchungen und werden durch Wind oder Erdbeben in Schwingungen versetzt. Je höher das Gebäude, desto stärker machen sich diese Bewegungen bemerkbar. Sie spielten auch beim Bau des Mobimo Towers in Zürich West eine zentrale Rolle. Um eine präzise Ausführung und eine sichere Umsetzung der planerischen Arbeit zu gewähren, berechneten und simulierten die Bauingenieure von Basler & Hofmann die Bewegungen akribisch und überprüften sie im Bauzustand kontinuierlich.
Bereits während der Bauzeit führen die grossen Eigenlasten von Hochhäusern zu Setzungen, Verkippungen und Stauchungen der Tragelemente. Ausserdem versetzen äussere Kräfte aus Wind und Erdbeben das Bauwerk in Schwingungen. Die Herausforderung für die Planenden besteht für solche Bauwerke darin, diese Bewegungen möglichst exakt zu prognostizieren und zu kontrollieren. Denn die Bewegungen können die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes zum Beispiel durch unzulässige Verformungen der Decken beeinträchtigen, und für die Tragsicherheit sind sie insofern relevant, als sie übermässige Zwangsbeanspruchungen in den Geschossdecken und der Bodenplatte verursachen können. Es stellen sich bei der Planung von Hochhäusern im Speziellen Fragen wie: Auf welche Weise interagieren Untergrund und Fundation unter der grossen Belastung? Wie stark werden die vertikalen Tragwerkelemente gestaucht? Welche Eigenschwingung zeigt das Gebäude? Und wie gross ist die Kopfbeschleunigung in den oberen Stockwerken?
Projektierende Ingenieure berechnen und simulieren die Bewegungen im Vorfeld. Doch erst in der Bauphase können die Prognosen überprüft und allfällige Korrekturen am Bauwerk vorgenommen werden. Den Überwachungsmessungen und Baukontrollen kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Auch bei den vor Ort durchgeführten Vermessungsarbeiten müssen die Gebäudebewegungen berücksichtigt werden, um Messfehler auszuschliessen. Die Ingenieure von Basler & Hofmann führten auch am 80 Meter hohen Mobimo Tower im Stadtteil Zürich West – er wird Mitte 2011 eröffnet – ebendiese erforderlichen Überwachungsmessungen und Baukontrollen bereits während der Bauphase durch.
Setzungen bereits während der Ausführung
Der Mobimo Tower ruht auf einer 30 bis 40 m mächtigen Schicht aus Limmatschotter. Die Fundation für das 65 000 t schwere Bauwerk besteht aus einer kombinierten Pfahl-Platten- Gründung mit einer 1.50 m starken Bodenplatte und 16 etwa 20 m langen, schwimmenden Bohrpfählen. Rund 40 % der Gebäudelast werden über Pfähle in den Untergrund abgetragen – dies haben Gleitmikrometermessungen an drei Pfählen bestätigt. Die restliche Gebäudelast trägt die Bodenplatte flach in den Schotter ab.
Die Ingenieure berechneten mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) eine mittlere Setzung für das Gesamtgebäude von etwa 50 mm und eine maximale im besonders belasteten Innenbereich von 65 mm (Abb. 7). Gegenüber den angrenzenden Erweiterungsbauten, die zeitgleich im Bau sind (Abb. 5), war mit einer Setzungsdifferenz von 20 mm zu rechnen. Der komplette Turm wurde deshalb ab Bodenplatte um 20 mm höher als die Sollkote gebaut. Während des Rohbaus bis zum 14. Obergeschoss musste mit den markantesten Setzungen gerechnet werden – etwa 50 % der gesamthaft prognostizierten. Deshalb war das Hochhaus ab Unterkante Bodenplatte bis Erdgeschoss vorerst von der benachbarten Parkgarage mit einer Setzungsgasse entkoppelt. Erst als sich ewa 90 % der Setzungen eingestellt hatten, wurde die Gasse zubetoniert.
Differenzielle Stauchung der Tragelemente
Neben der Setzung spielt die Stauchung der vertikalen Tragelemente eine zentrale Rolle für die Planung und Ausführung des Tragwerks. Die mit dem Baufortschritt zunehmende Last staucht den Kern aus 50 cm starken Ortbetonwänden, die vorfabrizierten Betoninnenstützen und die tragende Fassade mit den Betonaussenstützen. Am stärksten werden die Innenstützen belastet und verformt (Abb. 6). Um die differenzielle Stauchung und Setzung gegenüber anderen Bauteilen auszugleichen und um ein unzulässiges Deckengefälle in den Innenräumen zu verhindern – der Bemessung wurden die Werte für die Gebrauchstauglichkeit nach SIA-Norm 260 zugrunde gelegt –, sind die Innenstützen ab dem zweiten Stockwerk um 10 mm überhöht eingebaut worden.
Verschiebung der Fassadenelemente
Da sich ein Hochhaus nicht nur während des Baus, sondern auch nach der Fertigstellung infolge Windeinwirkung bewegt, darf die Fassade nicht steif wie ein Panzer sein – sie muss die Bewegung mitmachen können. Die errechnete Auslenkung infolge von Wind bestimmte beim Mobimo Tower die minimal mögliche Fugenbreite zwischen den Natursteinplatten, damit diese bei starkem Wind nicht gegeneinanderstossen, was zu Schäden an den Fassadenplatten führen würde. Die Fuge ist mit 8 mm Stärke über alle Stockwerke konstant, wobei sie in den unteren drei aus ästhetischen Gründen dauerelastisch verfugt und oben offen belassen ist. Entsprechend präzise muss die Fassade abgesteckt und montiert sowie die Deformation der Decken berücksichtigt werden.
Im Windkanal prüfen
Damit sich die künftigen Nutzerinnen und Nutzer im Hochhaus wohlfühlen, darf das Gebäude nicht zu sehr im Wind schwanken. Um diese Schwankungen abzuschätzen, bestimmten die Ingenieure mit FEM die Eigenfrequenzen des Mobimo Towers: f1 = 0.4 Hz, f2 = 0.5 Hz, f3 = 0.52 Hz, f4 = 2.03 Hz. Grundsätzlich gibt es keine Normvorgaben, doch weiss man, dass tiefe Eigenfrequenzen bezüglich Windeinwirkung problematisch sind. Die im Windkanal durchgeführten Versuche bestätigten aber, dass der Turm wenig schwingungsanfällig ist. Mit den zusätzlich durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen am Rohbau ermittelte man schliesslich die effektiven Eigenfrequenzen. Sie sind höher als prognostiziert, womit das Hochhaus weniger anfällig für dynamische Windeinwirkungen ist als vermutet.
Vermessung des Rohba us während ruhiger Stunden
Die Setzung der Bodenplatte sowie die Stauchung der vertikalen Tragelemente wurden mit jedem zweiten zusätzlichen Geschoss überprüft. Mittels Präzisionsnivellement vermassen die Ingenieure die Höhenkoten von insgesamt 16 Messpunkten bei den Kernwänden und Stützen. Die Stockwerkshöhen können wegen der Setzungen und Stauchungen nicht absolut über das Fixpunktnetz gemessen werden, da sich sonst die Raumhöhen veränderten. Die Vermessungsingenieure vermassen deshalb gegen einen sich mitbewegenden Fixpunkt auf der Bodenplatte des Bauwerks. Mit zunehmender Höhe galt es ausserdem, die Windeinwirkung zu berücksichtigen und die Vermessungsarbeiten in möglichst windstillen Phasen durchzuführen. Auch die Bauarbeiten setzen das Gebäude in Bewegung: Die am Bauwerk befestigten Krane führten zum Beispiel zu Auslenkungen der Gebäudeachse, und schwere Baugeräte verursachten Vibrationen. Die Vermessungsarbeiten liefen deshalb häufig in Randstunden, über den Mittag oder nachts. Bei der Interpretation der Messergebnisse spielt die Temperatur während der Vermessungsarbeiten eine entscheidende Rolle. Eine Temperaturdifferenz zwischen zwei Messungen von zum Beispiel 10 °C führt bei einem 80 m hohen Gebäude zu einer Differenz von 8 mm – was beim Mobimo Tower bereits etwa 25 % der gesamthaft prognostizierten Stauchungen der Innenstützen im obersten Geschoss bedeutet. Man zeichnete die Temperaturen deshalb während der Messungen auf. Ein weiterer Einflussfaktor sind Grundwasserbewegungen. Sie führen zu Setzungen oder zu Auftrieb und schlagen sich direkt in den Vermessungsergebnissen nieder. Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen diese Einflüsse herausgefiltert werden.
Während die Stauchungen von Stützen und Wänden im erwarteten Bereich lagen, erwies sich der Untergrund als steifer, denn die effektive Setzung betrug nur rund ein Drittel der aufgrund der Bodenkennwerte berechneten Werte. Die Bodenplatte setzte sich beinahe gleichmässig mit einer maximalen Neigung von 1:3000. Es waren somit keine Ausgleichsmassnahmen nötig. Dennoch waren die präzisen und ausführlichen, aber in dem für dieses Bauwerk üblichen Rahmen liegenden Vermessungsarbeiten und Bodenuntersuchungen gerechtfertigt, denn aus diesen Anstrengungen resultiert die erreichte Ausführungsqualität.TEC21, Fr., 2011.04.08
Jörg Habenberger, Dr.-Ing., Fachbereich Hochbau Basler & Hofmann AG Zürich, Dorothée Braun, M.Sc., Unternehmenskommunikation Basler & Hofmann AG Zürich
08. April 2011 Jörg Habenberger, Dorothée Braun