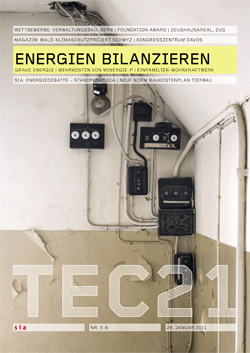Editorial
Dass Gebäude für einen grossen Teil des Energiebedarfs und der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, wissen mittlerweile auch Nichtfachleute. Aber wo muss man ansetzen, um diese Auswirkungen zu reduzieren? Da wird es auch für Fachleute schnell komplex. Wo zieht man die Systemgrenzen? Betrachtet man nur die Betriebsenergie oder auch die graue Energie, also die für die Herstellung der Baustoffe, die Erstellung und den Rückbau des Gebäudes aufgewendete Energie? Bezieht man gar noch die durch das Gebäude induzierte Mobilität mit ein, wie es der SIA-Effizienzpfad Energie tut? Dazu kommt, dass sich mit der Optimierung eines Energiebereichs möglicherweise ein anderer verschlechtert. Und dann gibt es auch noch den Nutzer als nicht «berechenbaren» Einflussfaktor, der oft nicht berücksichtigt wird. Für Bauherrschaften schliesslich stellt sich die Frage der Mehrkosten für Optimierungsmassnahmen.
Hilfreich für die Klärung solcher Fragen sind Vergleiche konkreter, gebauter Beispiele. Zwei Studien – zu den wichtigsten Einflussgrössen auf die graue Energie und zu den Mehrkosten für Minergie-P – stellen wir in diesem Heft vor («Graue Energie: wo optimieren?», «Mehrkosten von Minergie-P»). Bei den Gebäuden, deren Kennwerte diese Studien vergleichen, wurde mit verschiedenen Ansätzen versucht, den Energieaufwand zu minimieren. Das im November 2010 vom Departement Architektur der ETH Zürich veröffentlichte Positionspapier «Towards Zero-Emissions Architecture»[1] stellt diesen Fokus allerdings grundsätzlich infrage und fordert einen Paradigmenwechsel vom Energiesparen hin zur Emissionsfreiheit von Gebäuden. Das Bild der «Isolationshaft», aus der die Entwerfer befreit werden müssten, wurde in diesem Zusammenhang geprägt. In ihrer Stellungnahme («Energiedebatte – Standpunkt des SIA») erläutert die SIA-Energiekommission, warum weder ein einseitiger Fokus auf das Energiesparen noch auf Emissionsfreiheit sinnvoll ist, sondern dass es beides braucht. Ähnlich plädiert auch Werner Waldhauser dafür, sich gesamtheitlich mit dem Energieproblem auseinanderzusetzen («Gesamtbetrachtung wünschenswert»). Dass trotz «Isolationshaft» attraktive Gebäude entstehen können, zeigt ein Plusenergiehaus in Münsingen, das wir in einem weiteren Artikel vorstellen («Einfamilien-Wohnkraftwerk»). Aber auch bei Plusenergiehäusern stellt sich wiederum die Frage: Welche Ener-giebereiche betrachte ich, und wo ziehe ich die Systemgrenzen? Energien zu bilanzieren bleibt vielschichtig.
Claudia Carle
Anmerkung:
[01] Download Positionspapier:
www.arch.ethz.ch/darch/zero-emissions.php?lang=de
Hinweis der Redaktion
: Die für diese TEC21-Ausgabe ursprünglich geplanten und in der Vorschau angegebenen Themenartikel erscheinen aus produktionstechnischen Gründen in TEC21 15/2011 vom 8. April.
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Verwaltungsbau Schwanengasse, Bern | 1. Foundation Award | Zug: Vom Zeughaus-
areal zum Stadtgarten
14 MAGAZIN
Wald-Klimaschutzprojekt in Schwyz | Erweiterung Kongresszentrum Davos | Gesamt
betrachtung wünschenswert
18 PERSÖNLICH
Kurt Winkler: «Lawinenprognostik ist Handarbeit»
32 GRAUE ENERGIE: WO OPTIMIEREN?
Heinrich Gugerli, Yvonne Züger-Fürer Ein Vergleich von sieben Gebäuden der Stadt Zürich zeigt, welches die wichtigsten Faktoren sind, um die für die Erstellung benötigte Energie zu reduzieren.
36 MEHRKOSTEN VON MINERGIE-P
Armin Binz Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz quantifiziert die Mehrkos
ten von Minergie-P-Häusern auf Basis zweier beste-hender Gebäude.
39 EINFAMILIEN-WOHNKRAFTWERK
Tina Cieslik Ein Plusenergiehaus in Münsingen BE übersetzt die Themen Siedlungsplanung, Energie, Wohnkomfort, Ökologie und Ökonomie in einen auch architektonisch überzeugenden Bau.
44 SIA
Energiedebatte – Standpunkt des SIA | Neue Norm Baukostenplan Tiefbau | Aktivitäten im Energiebereich | «Leadership Erneuerung» nachgefragt | Vernehmlassung Teilrevision SIA 265 | Schülerworkshop «Saper vedere»
51 FIRMEN
Graue Energie: Wo optimieren?
Je niedriger der Betriebsenergiebedarf eines Gebäudes ist, umso mehr fällt die für die Erstellung eingesetzte Energie in einer Lebenszyklusbetrachtung ins Gewicht. Damit rückt die Optimierung dieser sogenannten grauen Energie ins Blickfeld. Welche Parameter eines Gebäudes dabei den stärksten Ausschlag geben, zeigt ein Vergleich von drei Neubauten und vier instandgestellten Gebäuden der Stadt Zürich.
53 % der gesamten durch ein neues Wohngebäude bestimmten Treibhausgasemissionen entfallen gemäss Merkblatt SIA 2040 SIA-Effizienzpfad Energie1 auf die Erstellung, lediglich 16 % auf die Betriebsenergie und 31 % auf die durch das Gebäude verursachte Mobilität (Abb. 11). Diese Richtwerte beziehen sich auf 2000-Watt-kompatible Gebäude. Betrachtet man anstelle der Treibhausgasemissionen die nicht erneuerbare Primärenergie, verschieben sich die Anteile, weil die Baustoffproduktion wesentlich mehr Treibhausgasemissionen je Energieeinheit verursacht als die Betriebsenergie. 25 % entfallen auf die Erstellung, 45 % auf die Betriebsenergie und 30 % auf die Mobilität. Ohne Optimierung der grauen Treibhausgasemissionen und der grauen Energie sind klimaverträgliche und ressourceneffiziente Häuser also kaum denkbar.
Herausforderung für das Planungsteam
Trotz der immensen Bedeutung mangelt es jedoch an Vorgaben für die Erstellungsenergie von Gebäuden, ganz im Gegensatz zur Betriebsenergie, die durch eine Vielzahl von Normen und Vorschriften geregelt ist. Im SIA-Effizienzpfad Energie werden erstmals entsprechende Richtwerte für graue Energie und graue Treibhausgasemissionen festgelegt.[1] Bei einer gesamtheitlichen Quantifizierung stellt sich die Frage, welcher Fachplaner damit beauftragt wird: die Architektin? Der Kostenplaner? Die Bauphysikerin? Davon unabhängig muss sichergestellt sein, dass der Gesamtleiter der Planung, also in der Regel die Architektin, die relevanten Parameter zur Optimierung der grauen Energie respektive der grauen Treibhausgasemissionen kennt. Diese Verantwortlichkeit ist insofern von Bedeutung, als der Erstellungsaufwand sehr stark vom Gebäudekonzept abhängig ist – also von der Form und der Kompaktheit eines Gebäudes, vom statischen Konzept und von der Materialisierung. Da mit einer zunehmenden Sensibilisierung von Bauherrschaften für dieses Thema zu rechnen ist, sind der Architekt und sein Fachplanungsteam gleichermassen gefordert.
Instandsetzung oder Neubau?
Aus energetischer Sicht kann die Frage, ob ein Ersatzneubau einer Sanierung vorzuziehen sei, nicht generell beantwortet werden. Zwar braucht die Instandsetzung nur rund die Hälfte an grauer Energie im Vergleich zum Neubau, weil der Aushub der Baugrube und die Primärstruktur des Gebäudes bereits als abgeschrieben gelten. Dies ist mit ein Grund, dass die 2000-Watt-Kompatibilität fallweise mit einer Instandsetzung günstiger erreicht werden kann als mit einem Neubau, obwohl die Betriebsenergie im sanierten Haus in der Regel grösser ist. Häufig halten sich aber bei einem Neubau der Mehraufwand an grauer Energie und der Minderaufwand im Betrieb gegenüber einer Instandsetzung die Waage. 2000-Watt-verträgliche Lösungen lassen sich demnach mit beiden Strategien verfolgen. Energieeffizienz alleine kann daher kein Grund sein, ein Gebäude abzureissen. Ausschlaggebend für die Abwägung zwischen Ersatzneubau und Instandsetzung sind vielmehr die Gebrauchstauglichkeit, Grundrisse mit hoher Flexibilität und das Erweiterungspotenzial eines Objektes, mitunter auch baurechtliche Fragen, beispielsweise Grenzabstände.
Instandsetzungen: Gebäudetechnik schlägt zu Buche
Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich hat von sieben städtischen Gebäuden – vier Instandsetzungen und drei Neubauten – den Erstellungs- respektive Instandsetzungsaufwand detailliert erhoben (Abb. 1 bis 7, 12).[2] Die Auswertung zeigt, dass die Baugrube und die Tragstruktur in einer Bilanz der Treibhausgase kräftig zu Buche schlagen. Bei den drei Neubauten entfallen gut ein Drittel bis knapp die Hälfte der Treibhausgasemissionen durch die Erstellung auf diese Positionen. Bei den Instandsetzungen sind diese Anteile naturgemäss sehr viel kleiner. Plausibel ist auch der Befund, dass der Aufwand für die Gebäudetechnik in ihrer absoluten Grösse weitgehend unabhängig davon ist, ob das Gebäude neu erstellt oder instandgesetzt wird. Durch diese Übereinstimmung in den absoluten Grössen ergeben sich bei Instandsetzungen grosse Anteile für die gebäudetechnischen Installationen, wie die Beispiele Dorflinde und Milchbuck illustrieren. Im Altersheim Dorflinde entfallen über 40 % der grauen Treibhausgasemissionen auf diese Position. Erheblich sind auch die durch die Herstellung der Fenster und den Innenausbau verursachten Treibhausgasemissionen.
Grosse Bedeutung von Ausmass und Materialisierung
Die Interpretation der Daten zeigt auch, dass die Materialisierung und das Ausmass der Bauteile, bezogen auf die Energiebezugsfläche, von grosser Bedeutung sind. Typisch dafür ist das Schulhaus Holderbach mit nur zwei Vollgeschossen, dessen Aussenbauteile, insbesondere das Dach, im Verhältnis zur Energiebezugsfläche ein grosses Ausmass haben. Das Objekt in der für die 1950er-Jahre typischen Pavillonbauweise ist wenig kompakt. Dass der Schulhaustrakt bei der Instandsetzung wiederum mit Aluminium eingedeckt wurde, akzentuiert diesen Effekt.
Der Stellenwert der Materialisierung – als Folge der gewählten Konstruktion – kommt auch in einem Vergleich der Aussenwände in der Wohnsiedlung Paradies und im Altersheim Dorflinde zum Ausdruck. Im «Paradies» fallen die Putzträgerplatten der hinterlüfteten Fassade und die Unterkonstruktion aus Aluminium ins Gewicht, während die 18 cm Steinwolle sich nur marginal auswirken. In der «Dorflinde» dagegen wird die Aussenwand raumseitig mit 14 cm Porenbeton nachgerüstet. Diese Lösung kommt ohne Verkleidung und Unterkonstruktion aus, was zu sehr tiefen Werten der grauen Energie führt (Abb. 8–10). Sofern die bauphysikalischen Bedingungen gegeben sind, erweist sich eine Innendämmung als vorteilhaft, umso mehr, als dadurch – wie im Fall «Dorflinde» – die Fassade keine grundlegenden Eingriffe erfährt und dadurch die architektonische Qualität erhalten bleibt.
Die Kompaktheit eines Gebäudes ist also einer der wichtigsten Faktoren bei der Optimierung des Erstellungsaufwandes. Die Daten zeigen aber auch, dass die im Effizienzpfad Energie dokumentierten Richtwerte bei Instandsetzungen – trotz grosser Eingriffstiefe – dank sorgfältiger Materialwahl erreicht werden können.[3]
Hilfsmittel zur Berechnung
Mit dem Merkblatt 2032 hat der SIA für die Planung eine praxisgerechte Methode zur Berechnung der grauen Energie nach einheitlichen Grundsätzen geschaffen.[4] Mit den «Ökobilanzdaten im Baubereich» ist eine aktuelle Datengrundlage mit repräsentativen Daten für den schweizerischen Baustoffmarkt vorhanden.[5]
Den interessierten Planenden und Auftraggebern stehen mittlerweile geeignete Hilfsmittel zur Berücksichtigung von grauen Daten bei der Erstellung oder der Instandsetzung zur Verfügung, beispielsweise die ECO-BKP-Merkblätter für Instandsetzungen und Neubauten[6] sowie die Zertifizierung nach Minergie-Eco. Geeignet für die Berechnung sind das webgestützte Tool www.bauteilkatalog.ch sowie – für eine grobe Orientierung in Vorstudien oder Vorprojekten – der Anhang D des SIA-Merkblattes 2032 Graue Energie von Gebäuden.
Wichtig ist dabei, dass die Datenerhebung und die Optimierung frühzeitig erfolgen. Bauten nach dem SIA-Effizienzpfad Energie, nach Minergie-Eco 2011 und nach dem neuen Standard Minergie-A, der Anfang März 2011 lanciert werden soll, bedingen ohnehin einen Nachweis der grauen Energie.
Anmerkungen:
[01] Merkblatt SIA 2040 SIA-Effizienzpfad Energie, in Vernehmlassung, Zürich 2010
[02] Fürer, Yvonne; Heinrich Gugerli: Graue Energie und Graue Treibhausgasemissionen von Instandsetzungen. 16. Status-Seminar, 2. und 3. September 2010, ETH Zürich
[03] Instandsetzung. Das Potenzial liegt im Bestand. Stadt Zürich, Hochbaudepartement, 2011. www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen
[04] Merkblatt 2032 Graue Energie von Gebäuden, SIA, Zürich 2009
[05] Empfehlung 2009/1 Ökobilanzdaten im Baubereich, KBOB, eco-bau, IPB, Bern 2009, www.kbob.ch
[06] Eco-BKP 2009. Merkblätter zum ökologischen Bauen nach Baukostenplan BKP, Verein eco-bau, Bern 2009, www.eco-bau.ch
Weitere Informationen:
www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauenTEC21, Fr., 2011.01.28
28. Januar 2011 Yvonne Züger-Fürer, Heinrich Gugerli