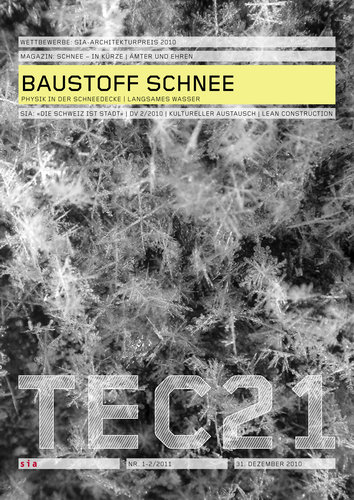Editorial
Schnee kommt und geht und steht sinnbildlich für den Winter. Hierzulande gehört er im Winter zum Alltag, und jeder hat seine ganz persönlichen Erfahrungen mit ihm: als Wintersportlerin, als Verkehrsteilnehmer, als Pisten- oder Schneeräumungspersonal.
Schnee ist ein filigranes Gebilde, das in verschiedenen Mengen, Formen und Qualitäten vorkommt. Auf natürliche Weise entsteht er in der Atmosphäre und fällt meist in Form von Flocken auf die Erde. Das sind Verkettungen von Schneekristallen – hexagonalen Eisgebilden, von denen keines einem anderen gleicht. Kenneth G. Libbrecht, Physikprofessor am California Institute of Technology in Pasadena, hat sie fotografiert, wofür er kürzlich in Stockholm mit dem Lennart-Nilsson-Preis für Wissenschaftsfotografie ausgezeichnet wurde. TEC21 zeigt eine Auswahl von Fotografien dieser makellos geformten «Kunstwerke» im Millimeterformat.
Eine verschneite Winterlandschaft ist für manchen der Inbegriff von Ruhe und Schönheit. Schnee hat einen speziellen Geruch, er knirscht, wenn man darauf geht, und er dämpft Geräusche. Doch die Stille wird vielerorts bereits während es schneit gestört. Schneepflüge und -fräsen räumen die weissen Strassen wieder schwarz, und die Diskussion um Streusalz entsteht jedes Jahr aufs Neue.
Für die Bergregionen bleibt Schnee jedoch wirtschaftlich unentbehrlich. Um Besucher bei Laune und Regionen attraktiv zu halten, werden immer neue Tourismusmagnete ausgedacht. So beginnen seit etwa 15 Jahren bereits im Herbst die Verantwortlichen, an verschiedenen Standorten Igludörfer zu errichten. Solche Bauten werden auf rudimentäre Weise erstellt. Berechnungsmethoden gibt es dafür noch nicht, vielmehr verlassen sich die Projektierenden beim Bauen auf ihr Gespür und ihre Erfahrung – wie sie sich die meisten bereits im Kindesal-ter aneignen (vgl. «Langsames Wasser»).
Diesem fast legeren Umgang mit der Genauigkeit steht die Präzision der Wissenschaft entgegen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist Schnee nicht nur ein filigranes Gebilde, sondern ein poröses Material aus Eis und Luft, das sich unter äusseren Einflüs
sen ständig verändert. Für die Beschreibung der Mikrostruktur von Schnee werden besondere experimentelle und theoretische Konzepte benötigt (vgl. «Physik in der Schneedecke»). Die Forschung rund um Schnee – insbesondere die Erforschung der Schneemikrostruktur – ist eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Lawinenvorhersage und der Klimaforschung. So wird ein fundiertes Verständnis bezüglich der Entstehung von alpinen Naturgefahren sowie der Wechselwirkung von Schnee und Klima erworben. Denn bei aller Schönheit: Schnee kann durch seine ständige Veränderung gefährlich werden und in Form von Lawinen zerstörerische Kräfte entwickeln.
Clementine van Rooden, Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
SIA-Architekturpreis 2010
10 PERSÖNLICH
Bernhard Russi: «Ich höre, was der Berg mir erzählt»
13 MAGAZIN
Schnee – in Kürze | Ämter und Ehren
16 PHYSIK IN DER SCHNEEDECKE
Martin Heggli, Martin Schneebeli Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (WSL) untersucht den Baustoff Schnee. Der Einsatz eines Mikro-Computertomografen ermöglicht es, die physikalischen Phänomene unter der Schneedecke zu beobachten.
22 LANGSAMES WASSER
Markus Schmid Architekten und Bauingenieure haben die Nische der Bauten aus Schnee noch nicht für sich entdeckt.
Igludörfer bergen aber Analysestoff und Forschungspotenzial.
27 SIA
«Die Schweiz ist Stadt» | Delegiertenversammlung 2/2010 | Austausch zwischen den Kulturen | Lean Construction Management
33 FIRMEN
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Physik in der Schneedecke
Fallen Schneekristalle auf den Boden und häufen sich zu einer Schneedecke an, entsteht ein komplexes Material. Anfangs noch puderartig, wachsen die Kristalle an ihren Berührungspunkten zusammen und bilden eine poröse Gesamtstruktur. Diese Struktur bleibt keineswegs erhalten. Die sich verändernden physikalischen Eigenschaften untersucht das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, um damit zum Beispiel Computermodelle zu verbessern, welche die Eigenschaften des Schnees vorhersagen und in der Lawinenprognose eingesetzt werden.
Natürlicher Schnee entsteht, wenn Wasserdampf enthaltende Luft in der Atmosphäre abkühlt. Bei einer gewissen druckabhängigen Temperatur ist die Luft mit Wasserdampf gesättigt. Eine weitere Abkühlung führt zu einer Übersättigung, sodass die Luft den enthaltenen Wasserdampf loswerden möchte. Dies wäre möglich, wenn der Wasserdampf zu Eiskristallen kondensieren könnte. Allerdings ist die spontane Bildung von Eiskristallen erst bei rund –40 °C möglich. Bei wärmeren Temperaturen gelingt dies nur, wenn Kondensationskeime vorhanden sind. Das sind in der Regel kleinste Teilchen in der Luft, sogenannte Aerosole. Ausgehend von diesen mikroskopisch kleinen Teilchen können sich auch bei Temperaturen über –40 °C Eiskristalle in der Luft bilden. Abhängig von den Umgebungsbedingungen wie Temperaturverhältnissen und Übersättigungsgrad der Luft mit Wasserdampf bilden sich verschieden geformte Eiskristalle. Ihnen allen gemeinsam ist der hexagonale Aufbau des Kristallgerüsts (Abb. 1 und 2).
Ganz anders entsteht der technische Schnee, im Volksmund auch als «Kunstschnee» bekannt. Bei Beschneiungsanlagen wird das Wasser durch feine Düsen in die Luft gespritzt. Die Tröpfchen gefrieren bei ausreichend langer Flugzeit durch die Luft, bevor sie auf den Boden fallen. Damit die technische Beschneiung schon bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt möglich ist, werden die Wassertröpfchen zusätzlich mit kleinen Eiskristallen aus sogenannten Nukleationsdüsen geimpft, sie dienen als Gefrierkeime. Mit Druckluft wird dabei gemischtes Wasser aus feinen Düsen versprüht. Durch die Expansion der Druckluft kommt es zu einer starken Abkühlung, wodurch diese Tröpfchen schon unmittelbar nach dem Austritt aus der Nukleationsdüse gefrieren. Die Schneekristalle aus den Schneimaschinen sind runder als natürlicher Schnee, deshalb hat Letzterer eine höhere Dichte und muss für die Pistenpräparation weniger bearbeitet werden.
Schneekristalle unter der Lupe
Es ist erstaunlich, dass Schnee weiss aussieht. Denn sowohl flüssiges Wasser als auch reines Eis – man denke an Eiswürfel in einem Getränk – sind durchsichtig und farblos. Tatsächlich sind auch die einzelnen Schneekristalle durchsichtig, wenn man sie mit einer Lupe oder unter dem Mikroskop betrachtet. Da die Schneedecke aber aus vielen übereinander geschichteten Einzelkristallen besteht, passiert das Licht immer wieder die Grenze zwischen Eis und Luft. An jedem dieser Übergänge wird das Licht gebrochen und ein Teil davon reflektiert. Da es dabei vom Schnee diffus in alle Richtungen gestreut wird, erscheint uns dieser letztlich weiss. Um die physikalischen Eigenschaften von Schnee im Allgemeinen zu verstehen, ist es somit wichtig, seinen Aufbau zu kennen. Denn beispielsweise die Wärmeleitfähigkeit oder die Festigkeit von Schnee hängen von der Struktur des Netzwerks ab, in dem die Eiskristalle angeordnet sind. Die Gruppe Schneephysik am WSL-Institut für Schneeund Lawinenforschung SLF in Davos erforscht deshalb die Struktur dieses Werkstoffes.
Röntgenbilder von Schneeproben
Die Forschenden untersuchen den Schnee im Labor mithilfe eines Mikro-Computertomografen (Mikro-CT). Bei dieser Methode, die vor rund zehn Jahren zum ersten Mal zur Untersuchung von Schnee angewendet wurde, macht ein Spezialgerät etwa 500 bis 1000 verschiedene Radiografien von einer Schneeprobe – das sind klassische Röntgenaufnahmen, wie sie auch in der Medizin für Knochen- und Gewebeuntersuchungen verwendet werden. Die Aufnahmen erfolgen aus einem immer wieder leicht veränderten Blickwinkel. Spezielle Computeralgorithmen berechnen und rekonstruieren aus dieser Information die dreidimensionale Struktur des Schnees. Die Aufnahmen zeigen, dass Schnee eine hochporöse, bikontinuierliche Struktur ist: Er besteht aus einem festen Eisgerüst und einem durchgehend verbundenen Luftporenraum, der einen sehr grossen Volumenanteil einnimmt. Bei Neuschnee kann der Luftanteil bis zu 95 Vol.-% ausmachen, aber auch älterer Schnee enthält noch etwa 70 Vol.-% Luft. Selbst der stark bearbeitete und verdichtete Schnee auf einer Rennpiste besteht noch fast zur Hälfte aus Luft (Abb. 3 bis 5). Der Vorteil des Mikro-CT ist, dass die Schneeprobe bei der Messung nicht beschädigt wird. Sie kann deshalb immer wieder untersucht werden. Dadurch ist es möglich, die Veränderung der Schneestruktur direkt zu beobachten. In Experimenten zeigte sich, dass sich zum Beispiel unter gewissen, in der Natur häufig vorkommenden Bedingungen – nämlich einem von der Schneeoberfläche zum Boden gerichteten Temperaturgradienten – die Mikrostruktur des Schnees rasch verändert. Schnee ist also nicht die vermeintlich ruhige Materie, die man vermuten würde, wenn man eine friedliche, verschneite Winterlandschaft betrachtet. Ganz im Gegenteil, in ihrem Inneren ist die Schneedecke ständig im Umbau. Man spricht von Schneemetamorphose.
Umwandlung und Neubildung von Schneekristallen
Eine langsame Veränderung der Schneestruktur findet statt, wenn der Schnee eine konstante Umgebungstemperatur hat. Die Schneemetamorphose – die Umwandlung der Schneekristalle – wird dabei lediglich durch das physikalische Prinzip der Energieminimierung angetrieben: Die zu Beginn stark verästelten Schneekristalle streben nach einer energieärmeren Form, indem sie sich in gröbere, rundlichere Kristalle mit einer kleineren Oberfläche verwandeln. Solche konstanten Temperaturbedingungen findet man vor allem in den tiefen Schichten einer polaren Schneedecke. In den oberflächennahen Schichten der saisonalen, alpinen Schneedecke sind es vor allem räumliche Temperaturunterschiede, die zu einer deutlich schnelleren Strukturänderung der Kristalle führen.
Ein Schlüsselbegriff, um diese raschen Veränderungen zu erklären, ist die «homologe Temperatur». Als homologe Temperatur bezeichnet man die Temperatur eines Werkstoffs relativ zur absoluten Temperatur seines Schmelzpunktes in Kelvin – für Festkörper liegt sie entsprechend zwischen 0 und 1. Schnee mit einer Temperatur von –5 °C hat zum Beispiel eine homologe Temperatur von 0.98 (268 K / 273 K = 0.98). Im Vergleich zu reinem Eisen würde dies einer Temperatur von etwa 1500 °C und bei Aluminium einer Temperatur von 640 °C entsprechen. Schnee muss also, obwohl er kalt erscheint, im physikalischen Sinn als eigentliches «Hochtemperaturmaterial» bezeichnet werden – als Festkörper, der sich sehr nahe bei seinem Schmelzpunkt befindet. Die Wassermoleküle im Eis bewegen sich deshalb relativ stark, und einzelne Moleküle können das Kristallgerüst leicht verlassen. Weil Eis ausserdem bei einer bestimmten homologen Temperatur im Vergleich zu anderen Substanzen einen hohen Dampfdruck aufweist, hat es eine starke Tendenz zu sublimieren, das heisst, es geht direkt vom festen in den gasförmigen Aggregatzustand über, ohne sich vorher zu verflüssigen. Durch diese Sublimation verschwinden Teile des Eisgerüsts und werden in Form von Wasserdampf durch die Luftporen an kältere Stellen, weil diese normalerweise höher oben liegen, in der Schneedecke transportiert. Dort kondensiert der Wasserdampf wieder und baut so neue Strukturen auf. Die Mikrostruktur des Schnees wird dadurch gröber, und kantige Kristallformen entstehen. Das Resultat dieser Schneemetamorphose hängt davon ab, wie die Temperaturverhältnisse in der Schneedecke sind; insbesondere ob grosse, kleine oder überhaupt keine Temperaturgradienten vorhanden sind; ob der Gradient immer in die gleiche Richtung zeigt oder seine Richtung im Lauf des Tages ändert. Denn der Dampfdruck des Eises ist von der Temperatur abhängig – je wärmer das Eis, desto höher der Dampfdruck.
Mechanische Eigenschaften von Schnee
Die Untersuchungen im Mikro-CT dienen nicht nur dazu, die Struktur des Schnees und seine Metamorphose zu untersuchen, sondern sie helfen auch dabei, die mechanischen Eigenschaften von Schnee besser zu verstehen. Dazu hat man am SLF in den letzten Jahren die mit dem Mikro-CT gemessene Mikrostruktur des Schnees analysiert und in ein Finite- Element-Modell umgewandelt. Es wurde aus Balkenelementen aufgebaut (Abb. 6), was die Anzahl der Elemente des Modells gegenüber tetraeder- oder würfelförmigen Elementen um zwei Grössenordnungen verringert. Das ermöglichte es, das Kriechen von Schnee numerisch zu simulieren. Die Kriecheigenschaften dieses Balkenmodells wurden ermittelt, wobei den einzelnen Modellbalken die Materialgesetze von monokristallinem Eis mit zufälliger Orientierung zugewiesen wurden. Es zeigt sich, dass die berechneten Deformationseigenschaften mit den im Experiment beobachteten übereinstimmen.
Visko-Elasto-plastisches Material
Zusätzlich zur temperaturgetriebenen Dynamik ist die Schneedecke ständig der Gravitation ausgesetzt, im einfachsten Fall führt dies zu einer Verformung der Eisstruktur. Der Schnee verformt sich durch sein Eigengewicht in Abhängigkeit von seiner Temperatur und seiner Dichte. Je kälter und dichter, desto viskoser ist der Schnee. Je nachdem, wie schnell der Schnee verformt wird, reagiert er unterschiedlich: Bei kleinen Dehnungsgeschwindigkeiten erfolgt eine plastische Verformung, bei hohen Dehnungsgeschwindigkeiten ist das Verhalten elastisch-spröd. In der Literatur werden oft besondere Mechanismen wie zum Beispiel Korngrenzen- Gleiten herangezogen, um die Deformation von Schnee zu erklären. Die neuen Untersuchungen des SLF zeigen jedoch, dass sich die Deformation von Schnee durch die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften seines Bauelements Eis hinreichend erklären lassen.
Schnee, vor allem lockerer Neuschnee, ist auch ein kompressibles Material. Seine Kompressibilität hängt in erster Linie von der Dichte, aber auch von Temperatur, Schneeart und Feuchtigkeit ab. Seine Festigkeit ist bezüglich Druck, Zug, Scherung und Penetration messbar. Die Festigkeit bezüglich Penetration wird als Härte bezeichnet. Die Bindungen sind der wichtigste Parameter bezüglich der Schneehärte. Je grösser die Anzahl und der Durchmesser der Bindungen ist, desto härter wird der Schnee. Ausserdem wird der Schnee härter, je kälter er ist. Neuschnee ist ein sehr poröses Material, dessen Dichte durch Kompression stark vergrössert werden kann. Da die Festigkeit des Schnees mit der Dichte in der Regel zunimmt, wird der Schnee verdichtet, um Skipisten zu präparieren oder Blöcke für den Iglubau auszusägen. Der verdichtete Schnee braucht eine gewisse Zeit, damit sich die Körner durch Sinterung verbinden können und so die endgültige Festigkeit erreichen.
Forschung an Einzelaspekten führt zum Gesamtbild
In der Natur wirken verschiedene Einflüsse gleichzeitig auf die Dynamik des Schnees ein und lassen sich nicht immer klar trennen. Deshalb werden im Labor einzelne Aspekte separat untersucht, um so Schritt für Schritt weitere Puzzleteile der mechanischen und thermischen Eigenschaften von Schnee zu identifizieren. So trägt die Schneephysik stufenweise zum nachhaltigen Fortschritt in Lawinenvorhersage, Wintersportindustrie und Klimaforschung bei. Die Ergebnisse werden in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Fachbüchern publiziert oder fliessen in Projekte mit Industriepartnern ein. Eine verschneite Winterlandschaft bietet also nicht nur einen wunderschönen Anblick, unter dem sanften Weiss verstecken sich interessante physikalische Phänomene.
[Martin Heggli, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos
Martin Schneebeli, Leiter Team Schneephysik, WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos]
Literatur:
Fauve, M.; Rhyner, H.; Schneebeli, M., 2002: Pistenpräparation und Pistenpflege. Das Handbuch für den Praktiker. Davos, Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung. 134 S.
Kerbrat, M.; Pinzer, B.; Huthwelker, T.; Gäggeler, H.W.; Ammann, M.; Schneebeli, M., 2008: Measuring the specific surface area of snow with X-ray tomography and gas adsorption: comparison and implications for surface smoothness. Atmospheric Chemistry and Physics
Pinzer, B.R.; Schneebeli, M., 2009: Snow metamorphism under alternating temperature gradients: Morphology and recrystallization in surface snow. Geophysical Research Letters – Weitere Informationen: www.slf.ch/forschung_entwicklung/schneeTEC21, Fr., 2010.12.31
31. Dezember 2010 Martin Heggli, Martin Schneebeli
Langsames Wasser
Tiefe Temperaturen verlangsamen den Rhythmus des Lebens auf der Erde. Das trifft insbesondere auch für das Element Wasser zu. In flüssigem Zustand passt es seine Form aufgrund der Erdanziehung augenblicklich der Umgebung an. In gefrorenem Zustand als Eis oder Schnee sind diese Bewegungen nicht aufgehoben, aber extrem verlangsamt. So sehr, dass sich mit diesen Materialien in unseren Breitengraden im Winter stabile Bauwerke erstellen lassen. Die Planung und Herstellung solcher Bauten basiert weitgehend auf Erfahrungswerten von einigen spezialisierten Fachfirmen.
Bauten aus Schnee werden weder in der Architektur noch im Ingenieurwesen wahrgenommen, behandelt oder gar bewirtschaftet. In unserer Region haben solche Objekte, abgesehen von Eiskanälen für Bobrennen oder Sprungschanzen für Skispringer, auch kaum Tradition. Doch seit gut 15 Jahren haben die Wintersportorte das Iglu als Touristenattraktion entdeckt. Pünktlich zu Saisonbeginn erstellen Fachleute jedes Jahr aufs Neue diese traditionell nordischen Inuit-Behausungen. Aus zu Beginn einfachen Schneehöhlen haben sich längst grosse Schneehotels mit Eventcharakter entwickelt. Zum Spannungsfeld zwischen Naturerlebnis, Hüttengaudi und Wellnesstrip gesellen sich vermehrt auch Fragen rund um die Themen Sicherheit, Bauauflagen, Naturschutz und Nachhaltigkeit.
Luft und Wasser
Der klassische Iglubau mit dem Aussägen und Stapeln von Schneeblöcken hat mit der heutigen Art des Schneehotelbauens wenig gemein. Professionelle Unternehmer haben eine Technik mit Ballonen erfunden und patentieren lassen. Das Prinzip ist simpel und effizient zugleich: Speziell geformte Kunststoffballone werden an Ort und Stelle aufgeblasen und platziert. Danach schieben Pistenfahrzeuge den Natur- oder Kunstschnee rings um den Ballonpark zu einem Widerlager zusammen. Wenn dieser Sockel fest steht, wird mit Fräsen weiterer Schnee auf die Ballone befördert. Nach und nach verdichtet sich die Schneedecke auf den spitzen Gewölbeformen. Sind die Gewölbe stark genug, kann das Pistenfahrzeug über das künftige Schneehotel fahren, ohne dass die Struktur einbricht. Anschliessend wird die Luft aus den Ballonen abgelassen, und die Kunststoffhüllen können durch Zugänge und innere Verbindungen herausgezogen werden. Danach werden die Ballone an andere Standorte transportiert oder gleich vor Ort wieder aufgeblasen, um weitere Räume am Schneehotelpark anzubauen.
Die Ballone haben keine Kugelform, sondern ähneln im Querschnitt einem gotischen Spitzbogen. Statisch bieten diese spitzen Kegelformen ideale Voraussetzungen, um mit einem Material zu bauen, das viel Druck, mässig Schub und kaum Zug zulässt. In der kurzen Geschichte der Schneehotels ist es noch nie zu einem Versagen der Gewölbe gekommen – und dies, obwohl keine rechnerischen Analysen der geplanten Tragwerke durchgeführt werden. Alles basiert auf Erfahrungswerten und der Einschätzung der Fachleute. Die fertigen Schneehäuser deformieren sich während ihrer Lebensdauer von November bis April mehr oder weniger stark, je nach Witterung und lokalem Klima. Daher werden die Innenräume permanent kontrolliert und nachbearbeitet. Die Stärken der Schalenstrukturen sind aber zu Beginn so stark, dass nie nachträglich Schnee aufgebracht werden muss, zumal auch der natürliche Schneefall nach und nach für eine zusätzliche Verdickung der Aussenform sorgt.
Luxus und Nachhaltigkeit
Das Erlebnis einer Übernachtung oder die Teilnahme an Events im modernen Igludorf wird heute von jeder grossen Wintersportregion angeboten. Die Nachfrage steigt ständig, und sowohl Einzelpersonen als auch Familien und Firmen schätzen das besondere Erlebnis in der Kälte. Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, werden zwangsläufig immer mehr Annehmlichkeiten in die Schneehotels integriert. Das beginnt bei Auflagen aus Dämmplatten auf Möbel und Betten aus Schnee, die mit Fellen abgedeckt werden, und endet bei Saunaräumen und Whirlpools im «Cabrioiglu». An einem abgelegenen Ort hoch in den Alpen in Badekleidern den klaren und eiskalten Winterhimmel zu geniessen, verspricht Genuss pur. Um diesen Luxus mit einem guten «Öko-Gewissen» in Einklang zu bringen, müssen plausible Pro-Argumente gefunden werden. Nachhaltigkeit bietet sich als perfekte Lösung an. Daher existieren bereits Nachhaltigkeitsberichte und -zertifikate der Fachfirmen für Iglubau.[1]
Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass eine Übernachtung im Iglu einen relativ kleinen «Klima-Fussabdruck» hinterlässt, allerdings unter Ausblendung der Frage, wie die Besucher angereist sind und welche Aktivitäten sie rund um das Igludorf ausüben. Reisen im Flugzeug und Aktivitäten mit Motorgeräten wie Skidoos oder Quads machen bekannterweise den Löwenanteil des CO2-Ausstosses aus. Der WWF Deutschland hat zu dieser Problematik einen interessanten Bericht2 verfasst. Auch warme Kleidung und die relativ einfache Kost tragen zur guten Bilanz bei, denn eine Übernachtung im vollbeheizten und beleuchteten Hotelzimmer mit der rund um die Uhr warmen Küche beansprucht mehr Energie. Dazu kommen noch die Verwendung von deklariertem Ökostrom zur Herstellung des Kunstschnees, zum Heizen von Sauna und Whirlpool sowie die Kompensation der Treibhausgasemissionen Scope I und Scope II entsprechend dem GHG-Protokoll (siehe Kasten).
Betrachtet man das Thema mit etwas Distanz, wird wirklich klar, dass Igludörfer in der heutigen Grösse vergleichsweise wenig Anteil am Problem Treibhausgasausstoss haben, egal ob mit oder ohne Ökostrom. Und das liegt wie erwähnt in der Natur der Sache. Somit bleibt nur die Frage: Ist es legitim, in den Alpen temporäre Herbergen aus Schnee zu bauen, um damit Umsatz zu generieren? Betrachtet man die lokale Grösse und die Einbettung eines Igludorfes in Bezug auf das gesamte Skigebiet, so ist die Zusatzbelastung gering, zumal im Frühjahr der Schnee schmilzt und die Bauten restlos verschwinden. Die Wertschöpfung für die Region, die vom Tourismus lebt, ist sicher höher mit solchen Anlagen. Und schliesslich werden dadurch Umweltprojekte in aller Welt finanziell unterstützt (Kompensation CO2-Ausstoss). Unter diesen Gesichtspunkten lassen sich Igludörfer durchaus vertreten.
Auflagen und Naturschutz
Mit der Zunahme von Anzahl und Grösse der Schneehotels und deren Bettenkapazität haben sich auch die Behörden des Themas angenommen, denn die Auswirkungen auf die umgebende Natur und die Risiken von Personenschäden steigen in gleichem Mass. In Bezug auf Personensicherheit existieren bereits einige Beispiele vom Kanton Bern. Neben den Auflagen zur Bestimmung eines Sicherheitsbeauftragten und zur Herstellung von Fluchtwegen werden auch Handfeuerlöscher vorgeschrieben. Nun möchte man annehmen, dass der Brandschutz in einem Bau aus Schnee und Eis kaum ein ernstzunehmendes Thema sein könnte. Doch vor zwei Jahren hat in einem Berner Igludorf eine Kerze die Reisetasche einer Touristin entzündet; die Qualmbildung forderte sieben Verletzte mit Verdacht auf Rauchvergiftung. Es ist anzunehmen, dass solche Fälle auch andernorts vorkamen, aber durch rechtzeitiges Entdecken niemand zu ernsthaftem Schaden kam. Deshalb werden keine Kerzen mehr in Schlafräumen und Verbindungsgängen zugelassen. Nachhaltigkeitsberichte haben dieses Verbot bereits aufgenommen und den Lichtersatz mit LED als CO2-Reduktion taxiert. Solche Entwicklungen müssen jedoch kritisch hinterfragt werden, denn die Fabrikation und der meist lange Transportweg von LED-Leuchten ist nach Expertenmeinungen nicht ökologisch.
Auch der Wildtier- und Naturschutz hat sich bereits mit dem Bau und dem Betrieb von Schneehotels befasst. Im Wesentlichen werden die Störung von Wildtieren, Lichtsmog und Lärm als Probleme erkannt und beurteilt. So dürfen von der Dämmerung bis zum Morgengrauen keine Outdoorevents rund um die Anlagen durchgeführt werden. Die Aussenbeleuchtung ist auf ein Minimum zu reduzieren, und Schneeschuhwanderungen sind nur nach Absprache mit dem zuständigen Wildhüter möglich. Die Initianten, Erbauer und Betreiber solcher Anlagen haben also einiges an Auflagen zu erfüllen. Aber dieses Gleichgewicht gilt es zu halten, um Naturschutz und Tourismus in Einklang zu bringen. Und die Macher haben den Begriff Naturschutz bereits als Marketinginstrument entdeckt, wie der Nachhaltigkeitsbericht[1] zeigt.
Schnee für Ingenieure und Architekten
Noch hat die Gilde der Former und Planer diese spezielle Art der Hochbauten nicht entdeckt. Doch diese Nische könnte technisch und wirtschaftlich durchaus interessant sein, um das Bauen mit Schnee und Eis weiterzuentwickeln. Denkbar sind etwa detaillierte Untersuchungen am Material, um Kennwerte zu erhalten, statische Analysen der Gewölbetragstrukturen oder die Entwicklung von Mischformen mit Druckelementen aus Schnee mit Schub- und Zugelementen aus anderen Materialien. Auch Studierende könnten das Thema in Semesteroder Abschlussarbeiten aufgreifen. In den Disziplinen Architektur, Bauingenieurwesen oder Bauphysik wären interessante Arbeiten und neue Erkenntnisse garantiert. Ein Aufruf, sich des langsamen Wassers anzunehmen.
Anmerkungen:
[01] Nachhaltigkeitsbericht Saison 2009/2010 der Iglu-Dorf GmbH:
www.iglu-dorf.com/pdf/ID_Nachhaltigkeitsbericht200910_lang_de.pdf
[02] Der touristische Klima-Fussabdruck, WWF Deutschland:
www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/Der_touristische_Klima-Fussabdruck.pdfTEC21, Fr., 2010.12.31
31. Dezember 2010 Markus Schmid