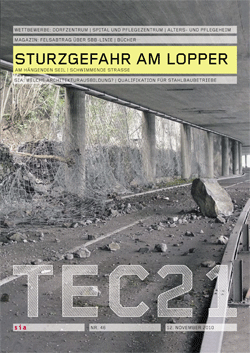Editorial
Am 12. Oktober 2010 stürzten 40 m³ Gesteinsmaterial auf die Kantonsstrasse zwischen Hergiswil und Stansstad. Die bestehenden Schutzbauten verhinderten nicht, dass grosse Felsbrocken bis auf die Fahrbahn gelangten. Der Verkehr war damit unvermittelt und lang-fristig unterbrochen. Die folgenden Analysen im Problemgebiet des Reigeldossen ergaben ein unerwartet grosses Sicherheitsrisiko für die regional wichtige Verbindungsstrasse. Seither wird am exponierten Gelände über dem Lopperviadukt intensiv gearbeitet. Die Siche-rungsmassnahmen und die notwendigen Felsräumungen («Am hängenden Seil», S. 20) sowie die Instandsetzung der Kantonsstrasse dauern vermutlich noch bis nächstes Frühjahr an – eine genaue Prognose ist nicht möglich, weil im Zuge der Arbeiten jeden Tag neue Erkenntnisse gewonnen werden, auf die individuell und unmittelbar reagiert werden muss.
Hergiswil und Stansstad sind zwar auch ohne Kantonsstrasse über die Autobahn miteinander verbunden, und ein Nauenbetrieb auf dem Vierwaldstättersee hatte den Personen- und den Fahrradverkehr aufrechterhalten, doch die Situation war vor allem für die Hergiswiler unbefriedigend. Diverse Betriebe klagten über Umsatzeinbussen bis zu 50 %. Der Durchgangsverkehr entlang dem Seeufer ist offensicht-lich eine wichtige Voraussetzung, um das örtliche Gewerbe am Leben zu erhalten. Deshalb kam die Idee einer Pontonbrücke ins Spiel («Schwimmende Strasse», S. 25). Doch der Nidwaldner Regierungsrat stand dem Bau der Brücke kritisch gegenüber: Zu wenig effizient, Behelfslösung und nicht nachhaltig, lauteten die Einwände. Doch auch das Bundesamt für Strassen (Astra) befürwortete den Weg über das Wasser, weil dadurch, bis auf wenige Ausnahmen bei Sprengungen und Sturmwinden, ein permanenter Regionalverkehr möglich ist. Als Alternative stand nur die Öffnung der bestehenden Werkausfahrt der A2 im Bereich der Pilatusstrasse zur Debatte. Doch wegen des erhöhten Unfallrisikos durch das Abbremsen auf der Autobahn, des geschätzten Mehrverkehrs von 800 bis 1000 Fahrzeugen pro Tag durch dichtbesiedeltes Wohn- und Schulgebiet sowie aufgrund der Staugefahr im Dorf wurde diese Variante als schlechtere Wahl taxiert und verworfen. So beteiligte sich der Kanton Nidwalden schliesslich mit 680 000 Fr., der Bund mit gut 2 Mio. Fr. und die Gemeinde Her-giswil mit 1.36 Mio. Fr. am Bau der Umfahrungsroute als schwimmende Strasse.
Man ist beim Anblick der Arbeiten am Loppernordhang fasziniert von den technischen Möglichkeiten, den Berg zu bändigen, um die Sicherheit der Kantonsstrasse wiederherzustellen. Dennoch kommt beim Nachdenken die Frage auf, ob sich der Aufwand zum Erhalt solch exponierter Verkehrsverbindungen rechtfertigt, denn ein Restrisiko von weiteren Felsabbrüchen wird immer bestehen bleiben.
Markus Schmid, schmid@tec21.ch, Clementine van Rooden
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Dorfzentrum Hochfelden | Spital und Pflegezentrum Zofingen | Alters- und Pflegeheim in Muttenz
12 MAGAZIN
Felsabtrag über SBB-Linie | Bücher
20 AM HÄNGENDEN SEIL
Pirmin Bossart Die Räumungs- und Sicherungsarbeiten am Reigeldossen sind spektakulär und gefährlich. Planer und Unternehmer ringen dem Berg mit grossem Aufwand ein akzeptables Mass an Sicherheit für die Nutzer der Kantonsstrasse zwischen Stansstad und Hergiswil ab.
25 SCHWIMMENDE STRASSE
Beat Plüss, Peter Henckel, Josef Kurath Die Bauingenieure von Staubli, Kurath und Partner konstruierten eine Strasse, die den Regionalver-kehr zwischen Hergiswil und Stansstad während der Felssicherungsarbeiten aufrechterhält. Die Umfahrungsstrasse treibt auf dem Wasser.
31 SIA
Welche Architekturausbildung? | Qualifika
tion für Stahlbaubetriebe
36 WEITERBILDUNG
37 FIRMEN
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Am hängenden Seil
Am Loppernordhang ist eine Plattform – einem Adlerhorst gleich – auf mächtigen Stützpfeilern in die steil abfallende Felswand namens Reigeldossen gebaut. 230 m weiter unten schimmert der Vierwaldstättersee. Die Pontonbrücke, die Hergiswil und Stansstad provisorisch verbindet, liegt wie eine Perlenkette im blauen Wasser. Aber es ist kein Aussichtspunkt zum Verweilen, sondern eine Baustelleninstallation für umfangreiche Felssicherungsarbeiten zum Schutz der darunterliegenden Kantonsstrasse.
Der Lopper war für den lokalen Verkehr zwischen Hergiswil und Stansstad, aber auch für die spätere Autobahn-Transitachse schon immer ein Problemgebiet. So ist es an diesem südöstlichen Ausläufer des Pilatus mit seinen steil abfallenden Flanken in den letzten Jahrzehnten regelmässig zu Steinschlägen gekommen. Die Schichten aus den Gesteinsarten Schrattenkalk oben, Kieselkalk unten und der Drusberg-Formation dazwischen sind in diesem Gebiet stellenweise instabil. In der Nidwaldner Fürio-Chronik und im Nidwaldner Ereigniskataster sind seit 1915 Steinschläge und kleinere Felsstürze am Loppernordhang festgehalten.1 1937 wurde ein Velofahrer von einem Stein erschlagen. 1951 verschüttete ein Felssturz die Strasse auf einer Länge von 60 Metern; die Felsbrocken gruben sich damals fast zwei Meter in die Strasse ein. 1958 folgte ein weiterer «Steinhagel». Mit der Eröffnung der Autobahn von Hergiswil nach Stansstad 1965 und später der des Gotthardtunnels wurde die Sicherheit in diesem Abschnitt ein vordringliches Thema. Das Gelände kam unter Beobachtung. Weil wiederholt Steinschläge niedergingen, wurden einzelne Felspartien gesichert, Steinschlagnetze und Galerien gebaut. Trotz diesen ersten Massnahmen fielen 1974 Felsbrocken mit Stückgewichten von mehreren Tonnen auf die Lopperstrasse zwischen der Achereggbrücke und Hergiswil. 1981 blockierten Steine die Autobahn auf dem Lopperviadukt. 1984 wurde das A8-Teilstück Alpnachstad–Hergiswil mit dem Loppertunnel in Betrieb genommen. Einen grossen Schritt für mehr Sicherheit vor Steinschlag bedeutete 2008 die Eröffnung des Kirchenwaldtunnels, der den offen geführten Abschnitt der A2 entlang des Nordhangs des Lopperberges ersetzt. Gleichzeitig wurden auch die A2 und die A8 unterirdisch miteinander verbunden. Die beiden Röhren kosteten 500 Millionen Franken. Erst mit dieser Verlegung der Autobahn in den Berg konnte am Loppernordhang eine umfassende Überprüfung und anschliessende Felsräumung in Angriff genommen werden. Hätte man diese Arbeiten früher durchführen wollen, wäre eine Schliessung der Autobahn und der Kantonsstrasse unabdingbar gewesen. Das hätte die wichtigste Nord-Süd-Verbindung für Monate unterbrochen.
Damoklesschwert
Im Juni 2009 beauftragte das Astra Spezialfirmen, beim A2-Achereggtunnel und beim Lopperviadukt Felssicherungsarbeiten durchzuführen. Es ging darum, Holz zu schlagen, Steinblöcke zu räumen, die Netze bei den Galerien zu leeren und neue Schutznetze zu montieren. Drei Monate nach Beginn der Arbeiten, am 12. Oktober 2009, lösten sich im Bereich Buchenloch am Lopper 40 m³ Gesteinsmaterial. Ein Teil der 100 t Stein und Geröll ging auf die Kantonsstrasse zwischen Hergiswil und Stansstad nieder. Dabei wurde ein Nidwaldner Förster, der an diesem Tag eine Geländebegehung machte, vom Steinschlag erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er hatte grosses Glück im Unglück: Zufällig waren an diesem Montag zwei Mechaniker mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Sie hörten die Hilferufe und konnten die Bergung des Verletzten organisieren. Dieses Steinschlagereignis bedeutete eine Zäsur in der Planung. Den Verantwortlichen wurde klar, dass die begonnene Säuberung des Geländes intensiviert und ausgeweitet werden musste. Probl emzone reigeld ossen Der Reigeldossen ist eine bis 150 m breite und 230 m hohe Felswand, direkt über dem Lopperviadukt, mit einer Neigung von 70 º. Bei einer ersten geologischen Überprüfung nach den Ereignissen vom Oktober 2009 wurden rund ein Dutzend absturzgefährdete Kluftkörper mit einem Volumen von 300 bis 600 m³ entdeckt. Wie hoch das Risiko von Stein- und Blockschlag tatsächlich ist und wie locker das Material in der Wand «klebt», wurde erst nach dem Beginn der Arbeiten am Fels klar. Am Reigeldossen dringen die Arbeiter buchstäblich in Neuland vor. Jede lokale Situation kann erst beurteilt werden, wenn die Arbeiter vor Ort das Gestein begutachten können. Eine Ferndiagnose ist kaum möglich und wäre sehr unsicher. Sämtliche «Sanierungsarbeiten» erfolgen ab der eingangs erwähnten Plattform auf der Schrattenkalkschicht. Hier lagern Wassertanks, Kompressoren, Armierungseisen, Dieseltanks, Notstromaggregate. In blauen Containern sind Büro, Aufenthalts-, Sanitäts- und Trocknungsräume eingerichtet. Die Versorgung wurde in den ersten Monaten, bis die Materialseilbahn erbaut war, mit Helikoptern sichergestellt.
Seit Ende Juli 2010 ist neben der Plattform auch ein grosser Baukran in Betrieb. Er scheint direkt aus dem Felsen zu wachsen, ruht aber auf einem 5 × 5 m grossen Fundament. Zur Stabilisierung der Bodenumgebung wurden Stahlanker versetzt, die mehrere Meter in den Untergrund eingebohrt wurden. Extensometer (Sensoren zur Messung von Längenänderung bzw. Dehnung) und Klinometer (Messinstrument zum Messen der Steigung bzw. Winkelmessung im Bauwesen) sorgen dafür, dass jede kleinste Bewegung registriert und dementsprechend Alarm ausgelöst wird. Die Kranelemente wurden mit dem stärksten Helikopter der Schweiz vom Typ Kamov KA32 A12 zum Standort geflogen und an Ort und Stelle zusammengebaut. Mit seiner Ausladung von 60 m bringt der Kran Personen und Material an die richtigen Stellen. Generell sind Personentransporte mit Hebemitteln nur in begründeten Einzelfällen möglich. Aufgrund der ausserordentlichen Situation am Reigeldossen haben das Bundesamt für Gesundheit und die Suva den Personentransport mit dem Turmdrehkran als Ausnahmefall taxiert und unter Einhaltung zusätzlicher Auflagen zeitlich befristet bewilligt.arbeiten am hängenden seil Jeder, der in der Felssicherung arbeitet, muss über eine entsprechende Ausbildung verfügen, denn das «Arbeiten am hängenden Seil» ist in der Bauarbeitenverordnung gesetzlich klar geregelt (vgl. Kasten S. 24). Arbeiten am hängenden Seil dürfen nur durchgeführt werden, wenn mindestens zwei Arbeiter sich gegenseitig überwachen und nötigenfalls retten können. Jede Person ist mit zwei getrennt voneinander befestigten Seilen gesichert, einem Arbeitsseil und einem Sicherungsseil für den Notfall.
Eine Felsräumung wird immer von oben begonnen. Dabei arbeiten sich die Ausführenden am Seil Meter für Meter abwärts, beklopfen mit dem Brecheisen den Fels, entfernen lose Steine oder sichern gefährliche Felspartien mit Felsnägeln, Stahlnetzen und Beton. Die Arbeitsschritte sind klar geregelt: Nur Steine, die nicht grösser als 1⁄8 m³ sind, dürfen gelöst und den Hang hinunterbefördert werden, um nicht weitere Zerstörungen an den Strassenbauwerken anzurichten. Grössere Steine oder Felspartien, die nicht stabil sind, müssen entsprechend fixiert werden. Bei heiklen Stellen wird zudem immer ein beratender Geologe beigezogen, was aktuell fast täglich notwendig ist.
Notfall- und Sicherheitskonzept
Dass die Felsräumungsarbeiten ihre Zeit brauchen, hat nicht zuletzt mit den Sicherheitsmassnahmen zu tun. Für jede Etappe müssen detaillierte Sicherheitsdispositive ausgearbeitet werden. Allein das Notfall- und Sicherheitkonzept für den Abschnitt Reigeldossen ist 30 Seiten stark. Es stuft für jede einzelne Baustelle im Fels das Risiko ein, ermittelt dessen Eintrittswahrscheinlichkeit und listet die standardisierten Abläufe auf. Es legt die Verantwortlichkeiten fest und beschreibt, unter welchen Bedingungen gearbeitet oder nicht gearbeitet wird. Bei starkem Regen, starkem Wind sowie bei Schnee und Eis wird auf Einsätze verzichtet. Das Konzept hält auch fest, wo und wie die diversen Installationen zu erfolgen haben. Es dauerte Monate, bis die Arbeiter überhaupt darangehen konnten, die spektakuläre Baustellenplattform im Fels einzurichten. Zunächst musste ein Pfad durch das unwegsame Gelände angelegt werden, um den Standort zu erreichen. Dann wurden die Bäume in der Umgebung gerodet, die oben liegenden Felspartien von Steinen gesäubert und als Schutz vor möglichen Spontanereignissen eine Steinschlagverbauung von 100 m Länge und 7 m Höhe errichtet.
Schliesslich brachten Helikopter mit Dutzenden von Flügen das nötige Baumaterial ins Gelände. Auch die Strassenbauwerke mussten geschützt werden. Sie waren teilweise bereits beschädigt und der Gefahr ausgesetzt, während der Reinigung noch heftiger durch Steinschlag in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Der Lopperviadukt wurde mit 300 Baumstämmen unterspriesst und die Brückenplatte mit einer meterhohen Pneuschicht geschützt. Auch die bergseitige Steinkorbmauer musste komplett hinterfüllt und um 2 m erhöht werden. Für diese gefährlichen Arbeiten, die knapp drei Wochen dauerten, haben die Projektverantwortlichen mehrere Sicherheitsdispositive erarbeitet und von der Suva genehmigen lassen.
Der Preis der Sicherheit
Nach dem grossen Steinschlag im Oktober 2009 mussten nicht nur die Felsräumungsarbeiten ausgeweitet, sondern auch die Kosten nach oben korrigiert werden. Im Mai 2009 ging das Astra für das ursprüngliche Sanierungsprojekt Achereggtunnel / Lopperviadukt / Schutzbank noch von 48 Millionen Franken aus. Inzwischen rechnet man mit 23 Millionen Franken Mehrkosten. Die aufwendigen Sicherheitsarbeiten, die ganze Felsräumung, die vielen Helikopterflüge, die unvorhergesehenen Ereignisse, die Erstellung der Notbrücke: All das kostet Geld. Ende Winter 2010, so hofft man, ist auch der Bereich Reigeldossen so gut wie möglich geräumt. Im Frühling 2011 sollen die Pontonbrücke abgebaut und die Seestrasse wieder geöffnet werden. Nach einem Unterbruch von etwa ein bis zwei Jahren werden dann die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten an den Galerien, am Lopperviadukt und am Achereggtunnel beginnen. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten ist nicht vor 2014 vorgesehen. In ein paar Jahren also wird am Lopper wieder der «courant normal» eingekehrt sein. Tausende von Arbeitsstunden und Dutzende Millionen von Franken sind nötig, um auf diesem kleinen Abschnitt der Nord-Süd-Achse eine akzeptable Sicherheit herzustellen. Zumindest den lokalen Verkehrsteilnehmenden, die dann wieder unter den ruppigen Felsabschnitten vorbeifahren, dürfte es bewusst sein, dass es nicht selbstverständlich ist, wie ungestört sie diese paar Kilometer zurücklegen können.TEC21, Fr., 2010.11.12
Anmerkung
[1] Link: www.astra.admin.ch/autobahnschweiz/01337/01347/02562
12. November 2010 Pirmin Bossart
Schwimmende Strasse
Die Kantonsstrasse zwischen Hergiswil und Stansstad am Vierwaldstättersee ist seit Oktober 2009 infolge eines Felssturzes gesperrt. Bis mindestens im Frühjahr 2011 stehen Sanierungsarbeiten am felsigen Steilhang über der Strasse an. Während dieser Zeit dient eine 500 m lange, schwimmende und sich bewegende Strasse dem Regionalverkehr als Ausweichroute. Das Bauwerk, das in kurzer Zeit von Staubli, Kurath und Partner geplant wurde, war bautechnisch und statisch ein komplexes Unterfangen.
Am 24. Dezember 2009 vergab das Astra den Totalunternehmerauftrag, die schwimmende Strasse zwischen Hergiswil und Stansstad bis zum 31. März 2010 zu bauen. Diese extrem kurze Planungs- und Bauzeit von knapp 3.5 Monaten – inklusive Weihnachtszeit – erforderte ein paralleles Vorgehen von Planung und Bau. Die notwendigen Bauteile mussten ausserdem möglichst frei verfügbar sein, und Unternehmung sowie Bauingenieure hatten dem zu wählenden System gegenüber ein grosses Vertrauen aufzubringen, da innerhalb von Tagen bestellt werden musste. Die Bestellung der Bauwerkselemente erfolgte vor der Dimensionierung der Brücke, sodass es nicht mehr möglich war, das System in einer späteren Planungsphase auszuwechseln. Eine unverhältnismässig aufwendige, nachträgliche Verstärkung hätte zu Zeitengpässen und hohen Mehrkosten geführt.
Auf dem Wasser und an Seilen gehalten
Die Planenden griffen für die 500 m lange schwimmende Strasse auf ein Bausystem zurück, das sich normalerweise für provisorische Schwimmplattformen eignet. Diese Art von Systemen besteht aus Einzelschwimmkörpern, die zu kleinen Arbeitsplattformen in der Grösse von etwa 20 × 30 m zusammengestellt werden können (Abb. 2 sowie Abb. 2 in «Am hängenden Seil», S. 21). Je grösser die Einheiten sind, desto stärker werden die Belastungen auf die einzelnen Elemente – vor allem dann, wenn die Plattformen hauptsächlich nur in eine Richtung zusammengesetzt sind. Das eingesetzte System Flexifloat besteht aus einzelnen Schwimmkörpern der Grösse 3.05 × 12 m, wobei zwei kleinere Zwischengrössen verfügbar sind. Die Elemente sind über ein Bolzensystem koppelbar, ohne dass dafür Taucher zum Einsatz kommen müssten. Die rund 115 notwendigen Stahlkastenschwimmer mit je einem Gewicht von 18 t wurden eingemietet und aus verschiedenen Ländern in Europa nach Stansstad transportiert. Sie werden nach Gebrauch wieder in die Depots zurückgebracht. Die Verankerung der Pontonbrücke erforderte eine einfach und schnell ausführbare Konstruktion. Die Bauingenieure von Staubli, Kurath und Partner entschieden sich noch vor der Bemessung des Bauwerks für eine Seilverankerung mit eingehängten Gewichten – eine Ausführungsweise, die der Situation angemessen schien (Abb. 8). Im Bereich der schwimmenden Strasse beträgt die Wassertiefe etwa 40 m, und erst in 60 bis 70 m Tiefe wird der Seeboden eben. Über die Seegrundbeschaffenheit ist wenig bekannt. Einzig aufgrund ihrer Erfahrung konnten die Beteiligten die Verhältnisse am Seegrund abschätzen – spätere Versuche bestätigten die Annahmen. Ohne die Ankerkräfte ermittelt zu haben, definierten die Bauingenieure die Seile, die Seillängen und die Gewichte der Ankersteine. Dies war möglich, weil trotz den sich dadurch ergebenden Einschränkungen noch genügend Freiheit für die Dimensionierung des Bauwerkes und der Verankerung vorhanden war.
Bewegungen der Perlenkette
Für die Dimensionierung der provisorischen Pontonbrücke waren Einwirkungen wie Windund Wellenkräfte, verschiedene Wasserstände, Steinschlag und Nutzlasten massgebend. Da die Mole nicht mit festen Lagern verankert werden sollte, entstehen durch die meisten dieser Einwirkungen Bewegungen, die zu teilweise grossen Verschiebungen des 2000 t schweren Bauwerkes führen. Bei extremen Lasten treten horizontale Verschiebungen von bis zu 1.5 m auf. Diese Bewegung muss abgebremst werden. Wird dies nicht auf eine sinnvolle Art getan, entstehen auf die Anker wirkende Kräfte, die nicht zu halten sind. Ausserdem darf die Mole bei periodisch wiederkehrenden Wellenkräften nicht aufschwingen. Die Bauingenieure überprüften dies mit dreidimensionalen Berechnungen.
Um die in der Mole entstehenden Kräfte auf die vom System vorgegebenen Tragwiderstände zu reduzieren, trafen die Planenden entsprechende Massnahmen. Sie teilten die Mole im Grundriss in zwei separate Schwimmkörper – einen L- und einen stabförmigen Abschnitt. Örtlich hängte man Zusatzschwimmer an, zur Beruhigung bei Wellenbelastung respektive um die Verdrehung durch einseitige, grosse Einzellasten zu minimieren. Bei den erforderlichen Zugangsrampen und der Übergangsbrücke (Abb. 3 und 4) galt es zu beachten, dass die getrennten Grossbauteile sich im Gebrauchszustand unter Nutzlast und anderen Einwirkungen gegeneinander verdrehen, in Längs- und Querachse verschieben und gegenseitig verwinkeln – die einzelnen Teile sollten sich daher wie eine Perlenkette beweglich und flexibel aneinanderreihen. Die Zugangsrampen können zum Beispiel eine Eigenverdrehung unter Nutzlast von über 6 ° aufnehmen. Ausserdem dimensionierten die Bauingenieure die Seillängen und -stärken sowie die teilweise mittig an den Seilen angehängten Gewichte so, dass die Molenbewegungen stark abgedämpft werden und somit die Seilkräfte nicht zu gross werden (Abb. 7). Normalerweise variiert man bei der Dimensionierung einer schwimmenden Mole auch die Masse. Dies war hier jedoch nicht möglich, da ein Molentyp vorbestimmt war.
Zusammenspiel von Ankerkräften und Molenbewegungen
Verschiedene Modelle simulierten die Einwirkungen und das statische System der Mole respektive berechneten die Kräfte und Bewegungen. Bei der hier gebauten Mole ist der Lastfall einer starken Windböe massgebend für die auf die Anker wirkenden Kräfte, für die maximale Verschiebung der Gesamtmole und die maximalen Querbeschleunigungen, wel- che auf die Nutzenden wirken; nicht aber für die Krafteinwirkungen im Molenkörper – hierfür massgebend sind der gleichzeitige Ausfall von nebeneinanderliegenden, landseitigen Ankerseilen, Wind und Wellen von Westen sowie Bauzustände mit grossen Einzellasten von 40 t plus gleichzeitig Wind und Wellen. Auch eine Einzelwelle, die durch starke, gleichmässige und lang andauernde Winde ausgelöst und auf die seeseitig projizierte Länge von rund 400 m gleichmässig und gleichzeitig auftreffen würde, ergäbe ähnliche Auswirkungen auf die Mole wie die Windböe. Dies ist bei der tatsächlichen geografischen Lage der Mole aber extrem unwahrscheinlich und darum hauptsächlich ein nur für die Tragsicherheit zu prüfender Lastfall.
Die Berechnung der Ankerkräfte gibt einen Einblick in die komplexe Problematik der statischen und dynamischen Ein- und Auswirkungen auf das Bauwerk: Bei den dynamischen Modellberechnungen für die Verankerungen wurden die Seile mit Theorie dritter Ordnung berechnet. Bemisst man nicht nach ihr, kommt man auf ungenaue Resultate und unter- oder überschätzt die entstehenden Kräfte teilweise wesentlich. Dies kann zu einem Versagen des Bauwerks führen. Die Berechnungen berücksichtigen die Seilverlängerung und die Seilform infolge von Eigengewicht, Zusatzlast und Seilspannung. Auch zusätzliche Kräfte infolge von Beschleunigung sowie die Wasserwiderstände der Seile und der Mole flossen in die Dimensionierung ein. Letztere Effekte sind gerade bei den Seilverankerungen wesentlich, da bei der Seilstreckung – nicht aber beim Erschlaffen – teilweise relativ hohe Seilgeschwindigkeiten entstehen. Der Widerstand und der Ablauf der Bewegung des Seiles im Wasser sind nicht genau bekannt. Sie sind zu komplex, als dass man sie präzise erfassen könnte, und aufschlussreiche Versuche wären zu zeitintensiv gewesen – Kosteneinsparungen wären ausserdem klein. Mit der Grundlage der Theorie für schlanke Bauteile in Fliessgewässern legten die Ingenieure Konstanten für untere und obere Grenzwerte fest, um diese Effekte in die Berechnung mit einzubeziehen. Bei jedem Zeitschritt suchten sie ein Gleichgewicht für die Kombination aller Einflüsse.
Für die Bestimmung der Querschnittswerte wie Steifigkeit und Widerstand der Mole spielen die Verhältnisse in den Schwimmelementkupplungen eine Rolle. Deren Steifigkeit und vor allem auch deren Spiel bestimmen die Werte des Gesamtbauwerks, und sie sind schliesslich die entscheidenden Versagensgrössen. Je weicher die Kupplungen in den Berechnungen definiert sind, desto kleiner fällt der Tragwiderstand der Mole aus. Dass die Schwimmkörper versetzt angeordnet sind, erhöht zwar die Tragfähigkeit, es entstehen aber infolge normaler Biegemomente Torsionskräfte, die nicht zu vernachlässigen sind. Die ausgeführte Architektur der Verankerungen und die Teilung der Mole in zwei Hälften reduzieren die auf den Molenkörper einwirkenden Momente und Querkräfte, sodass die Normal- und Querkräfte in den Kupplungsnocken genügend klein ausfallen.
Um schliesslich die Querschnittkräfte zu bestimmen, wurde das aus den Detailanalysen ermittelte Kraft-/Verformungsverhalten der Mole in ein dreidimensionales Modell integriert. Dabei flossen die grossen Nichtlinearitäten aus der Verankerung und das dynamische Spiel der Wellen im Verhältnis zur Trägheit der Mole in das an sich linearelastische Berechnungshilfsmittel schrittweise ein. Die Seilkräfte verhalten sich nicht proportional zur Molenverschiebung (Abb. 5). Wie entscheidend eine genaue Simulation der Verankerung ist, zeigt die Vergleichsrechnung mit reduzierten Gewichten im Seil. Reduziert man die im Seil eingehängten Gewichte auf etwa einen Drittel – von 540 auf 170 kg –, so vergrössert sich die Seilkraft markant (Abb. 6). Nachdem die Windböe abgeklungen ist, vergrössert sich die Seilkraft aufgrund der Streckung der Verankerungsseile sprunghaft von rund 2 auf 50 kN. Verglichen mit optimierten Gewichten beträgt die Kraftsteigerung im Seil zum selben Zeitpunkt rund 300 %. Auch die Querbeschleunigung steigt auf das Doppelte des maximalen Wertes an. Reduziert man das eingehängte Gewicht noch mehr, verringert sich zwar die Querbeschleunigung wieder, aber es zerreisst die Ankerseile, und das Gesamtsystem versagt.
Die detaillierte Dimensionierung der Seilverankerung ermöglichte eine genügend grosse Dämpfung und verhinderte, dass die Mole mit den Wellenbelastungen in Resonanz kommt. Die Kräfte und Verschiebungen infolge von regelmässig ankommenden Wellen bleiben so relativ klein.
Bauwerk wird ständig Überwacht
Die Planung und Realisierung des Sicherheits- und Überwachungskonzeptes forderte alle Planenden heraus, weil sich bei dieser schwimmenden Brücke nicht nur die Nutzlasten bewegen, sondern in einem erheblichen Masse auch das Bauwerk selbst. Der 2000 t schwere Ponton kann sich bei Wellengang und Sturm bis zu 1.5 m in alle Richtungen bewegen. Gerade bei den Zugängen zum und vom Ponton erforderten diese Umstände kreative Lösungen, denn auch unter Betrieb müssen grosse Bewegungen des Bauwerkes möglich sein. Spezielle Probleme wie die auf Radfahrer wirkende Querbeschleunigung durch das Bauwerk, das Verhalten bei Steinschlag durch Sprengungen in der Felswand oder die Frage, wie die Brücke bei zu hohem Wellengang in der Nacht zu sperren sei und wann die Gebrauchstauglichkeit des Pontons nicht mehr gewährleistet ist, mussten überlegt und Lösungen dafür gefunden werden.
Das Bauwerk wird mit automatischen geodätischen Messungen in seiner Lage und Höhe überwacht, ein schwimmendes Wellenmessgerät und ein Windmesser kontrollieren automatisch die äusseren Einflüsse. Sobald vorgegebene Grenzwerte überschritten werden, startet das vorbereitete Alarmdispositiv. Es regelt die Interventions- und Alarmgrenzwerte. Die Messwerte werden permanent in der Zentrale der Kantonspolizei Nidwalden überwacht. Bei einer Überschreitung des Alarmgrenzwertes sperrt die Kantonspolizei nach Rücksprache mit den Projektverantwortlichen unverzüglich die Brücke. Ein eingerichteter Sicherheitsdienst sorgt ausserdem für die Sperrung der Brücke während Sprengarbeiten. Diese gilt für jeglichen Verkehr und dauert maximal zehn Minuten.TEC21, Fr., 2010.11.12
12. November 2010 Beat Plüss, Peter Henckel, Josef Kurath