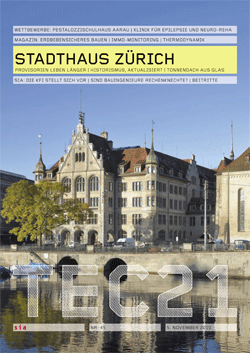Editorial
Das Stadthaus ist das wichtigste Amtsgebäude von Zürich und ein wertvoller Zeuge seiner Zeit. Im Zuge der urbanen Umgestaltung des Lim-matufers und der grossen Eingemeindungen im ausgehenden 19. Jahrhundert geplant, widerspiegelt es die Selbstwahrnehmung der erstarkten Bürgergesellschaft: Ein erstes, von Arnold Geiser erbautes Stadthaus (1885) erwies sich bereits wenige Jahre nach Fertigstellung als zu klein; der grössere Erweiterungsbau von Gustav Gull (ab 1895) verleibte sich nicht nur den Geiser-Bau ein, sondern – im Geiste einer «schöpferischen Denkmalpflege» – auch wichtige Teile des Fraumünsterklosters. Für die damalige Zeit fortschrittliche Bautechniken, kunstreiche Details, einzig-artige Spolien und unterschiedliche historistische Stile kennzeichnen deshalb seit je das selbstbewusst am Limmatufer stehende Gebäude. In den letzten hundert Jahren hat sich der Kon-flikt zwischen pragmatischen Nutzungsansprüchen und räumlicher Repräsentation jedoch verschärft. Das Gebäude hat Umbauten und Trans-formationen erlitten, die seine architektonischen Qualitäten entweder stark verunklärten oder ganz zerstörten. Zudem war das Stadthaus immer weniger in der Lage, den Standards eines dienstleistungsorientierten, modernen Amtsgebäudes zu genügen. Insofern verkörpert es beispielhaft eine ebenso häufige wie individuelle Bauaufgabe: die Anpassung wertvoller historischer Substanz an veränderte Sicherheits-, Energie- und Nutzungsanforderungen.
Die soeben abgeschlossene Sanierung durch Pfister Schiess Tropeano Architekten reagiert feinfühlig auf die unterschiedlichen Aspekte des Bestands, ohne das Gesamtkonzept aus den Augen zu verlieren. Dabei galt es auch, betriebliche Randbedingungen zu berücksichtigen. So wurde nur ein Teil der Stadthausbelegschaft während der Bauphase in externe Provisorien umquartiert; in vielen Büros, die von Etappe zu Etap-pe in andere Gebäudeteile transferiert werden mussten, herrschte weiterhin Betrieb. Die Komplexität der Bauaufgabe umfasste also sämtliche Bereiche, von der Analyse über Planung und Ausführung bis hin zur Baustellenlogistik – ein Lehrstück.
Judit Solt
In eigener Sache
TEC21 freut sich, diesen Herbst einen Heftetausch mit der deutschen Architekturfachzeitschrift «db» durchzuführen. In Süddeutschland wurde TEC21 42-43/2010 mit der Novemberausgabe der «db» an deren Abonnenten und Abonnentinnen verschickt; dieser Ausgabe von TEC21 liegt – bei einem Teil der Auflage – die aktuelle «db» bei. Wir hoffen, mit dieser Aktion unseren Lesern und Leserinnen zusätzliche Inspiration zu bieten – zumal die «db» als eine von ganz wenigen Architekturzeitschriften in Europa auch Fragen aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften thematisiert und den interdisziplinären Anspruch von TEC21 gewissermassen teilt. Die Novemberausgabe widmet sich dem Material Glas und seinen vielfältigen Anwendungen. Wir wünschen eine anregende Lektüre!
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Pestalozzischulhaus Aarau | Klinik für Epilepsie und Neuro-Reha
16 MAGAZIN
Erdbebensicheres Bauen bewährt sich | Immo-Monitoring | Thermodynamik gegen Thermodynamik | Krank durch Kollegen – oder Strukturen | Frank O. Gehry seit 1997
28 PROVISORIEN LEBEN LÄNGER
Theresia Gürtler Berger Denkmalpflege: Die aktuelle Sanierung des Stadthauses Zürich vereinbart moderne Nutzungsanforderungen mit denkmalpflegerischen Anliegen.
34 HISTORISMUS, AKTUALISIERT
Michael Hanak Architektur: Nach der Sanierung durch Pfister Schiess Tropeano Architekten präsentiert sich die historische Architektur des Stadthauses in neuem Stadthaus Zürich nach der Sanierung, Oktober 2010
42 HISTORISCHES TONNENDACH AUS GLASBAUSTEINEN
Judith Russenberger, Anna Ciari Ingenieurwesen: Die Bauingenieure von Synaxis analysierten das historische Glastonnendach im Stadthaus. Es kann belassen bleiben.
48 SIA
Die KfI stellt sich vor | Sind Bauingenieure Rechenknechte? | Nachhaltigkeitsbeurteilung | Beitritte zum SIA im 3. Quartal 2010
56 MESSE
Hausbau- und Energiemesse in Bern mit Kongress, Sonderschau und Herbstseminar
60 FIRMEN
61 PRODUKTE
69 IMPRESSUM
70 VERANSTALTUNGEN
Provisorien leben länger
Das Zürcher Stadthaus entstand im Zuge der Transformation des linken Limmatufers im 19. Jahrhundert, als grosse Teile der mittelalterlichen Stadt repräsentativen Verwaltungs- und Geschäftshäusern weichen mussten. Stadtbaumeister Arnold Geiser errichtete das erste Stadthaus im Stil der Neorenaissance, wenige Jahre später integrierte es sein Nachfolger Gustav Gull in einen neugotischen Erweiterungsbau. Beide Etappen enthalten Spolien aus abgebrochenen Bauten. Die aktuelle Sanierung hat die vielfältigen architektonischen Qualitäten des denkmalgeschützten Gebäudes wiederbelebt und mit neuen Nutzungsanforderungen in Einklang gebracht.
1898 erschien es mehr als konsequent, das Zürcher Fraumünsterkloster bis auf die Kirche niederzulegen, um Platz für ein grösseres Stadthaus zu schaffen: 1524 hatte Katharina von Zimmern, die letzte Äbtissin des Fraumünsterklosters, alle «Freiheiten und Rechte» des «königlichen Eigenklosters Ludwig des Deutschen von 853»1 an die Stadt Zürich übergeben. Sie beendete damit die jahrhundertelange Vorrangstellung des «hofeigenen» adligen Damenstifts gegenüber der Stadt. Schon Jahre vor der Reformation war die Stadt politisch und wirtschaftlich so stark, dass sie Teile des Klosters unter anderem als städtischen Werkhof umgenutzt hatte. Doch bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert blieb die Stadtverwaltung in den Konventsbauten des «Fraumünsteramtes» einquartiert. Erst mit der Industrialisierung und dem Anwachsen der Stadtbevölkerung in der Gründerzeit und spätestens mit der Eingemeindung 1893 kam es zur Überformung des Fraumünsterklosters wie in der übrigen Altstadt.
Schon 1859 hatte Stadtingenieur Arnold Bürkli bei der Planung der neuen Seequaianlagen eine grossmassstäbliche Blockrandbebauung für das kleinräumige Kratzquartier samt Fraumünsterkloster vorgesehen. Das Gebiet um das Kloster war mit seiner Nähe zur gerade umgesiedelten Post inmitten zukünftiger Geschäftshäuser für öffentliche Bauten prädestiniert. Folgerichtig sahen zeitgenössische Wettbewerbsbeiträge, wie derjenige von Gottfried Semper, hier ein Stadthaus vor. Erst im September 1881 fiel indes der Entscheid, Bürklis Quaianlagen auszuführen. Vier Jahre später war das Bauhaus samt Steinhütte, das seit 1803 als Stadthaus gedient hatte, abgebrochen. Doch statt ein monumentales Stadthaus als Mittelpunkt des neuen Quartiers zwischen Schanzengraben, Limmat und der Seequaianlage zu bauen, reduzierte man das Raumprogramm aus Kostengründen auf den blossen Ersatz der verloren gegangenen Verwaltungsräume.
Arnold Geisers erstes Stadthaus
Vorgängig musste Stadtbaumeister Arnold Geiser (1844–1909) das Potenzial für Umbau und Vergrösserung der bestehenden Gebäude des Fraumünsterklosters abklären. Erst dann entschloss sich der Stadtrat, das Eckgrundstück zwischen Fraumünsterstrasse und Kappelergasse im Südwesten des Klosterareals für den «ersten Neubau eines Verwaltungsgebäudes» der Stadt Zürich frei zu räumen (Abb. 1). Nach wie vor galt Geisers Stadthaus als Provisorium, das «auch zu Privatzwecken seine Nutzung finden konnte», falls der gewünschte Monumentalbau doch realisiert würde; andererseits sollte es «ausgedehnt werden» können. 1885 war das Stadthaus, ein Neorenaissancebau in der Formensprache der italienischen Stadtrepubliken, bezugsbereit (Abb. 3).2 Aus dem abgebrochenen Schirmvogteihaus, dem Sitz der Vormundschaftsbehörde an der Adresse In Gassen 14, liess Geiser die spätgotische Fenstersäule und die Wappendecke als Spolien in das Sitzungszimmer des 1. OG einbauen. Er nahm damit die «schöpferische Denkmalpflege» von Gustav Gull (1858–1942), die Übernahme regionaler Bautraditionen, vorweg.
Geiser leitete den Abbruch grosser Teile der mittelalterlichen Stadt auf der linken Limmatseite ein. Er setzte die Neuschöpfung des Zürcher Stadtzentrums im Sinne Bürklis und des 19. Jahrhunderts fort. Die innerstädtische Umformung gipfelte in romantischen Heimatstilvisionen des «planenden» Stadtbaumeisters Gustav Gull zu einem grossräumigen Zürcher Verwaltungskomplex. Doch Gulls Plan- und Bautätigkeit Limmat-abwärts auf dem Oetenbachgelände, dem Gelände des ehemaligen Dominikanerinnenklosters, endete abrupt mit dem Ersten Weltkrieg. Der Komplex blieb Stückwerk und Gulls repräsentatives Stadthaus Fiktion.
Gustav Gulls Erweiterungsbau
Spätestens 1893, mit der ersten Eingemeindung, war das Geiser-Stadthaus für die Verwaltungsaufgaben der wachsenden Grossstadt bereits zu klein. Ab 1895 projektierte Gull ein zweites, nun dreimal so grosses Stadthaus: erneut auf dem Fraumünsterareal, wieder ein Provisorium, nun die Erweiterung des ersten Stadthauses.
1900 waren dafür alle Klostergebäude bis auf die Kirche abgebrochen (Abb. 2). Neben Johann Rudolf Rahn, einem der Begründer der Schweizer Denkmalpflege, dokumentierte unter anderen auch Gull die abgetragenen Konventsbauten. Selbstbewusst setzte er sein Stadthaus vor die Flucht der Fraumünsterkirche an den Stadthausquai. Ein hanseatisch norddeutscher Treppengiebel stand für den Zürcher Bürgerstolz. In fünfjähriger Bauzeit verleibte sich das zweite Stadthaus ungeniert den jungen, architektonisch gerade aus der Mode geratenen Vorläufer ein.
Geisers Neorenaissancebau war in den Raumstrukturen, den Proportionen und in der Materialität bis hin zur Polychromie der Farben von Geisers Lehrer Gottfried Semper geprägt; Gull jedoch ordnete ihn seinem eigenen Farb- und Formenkonzept unter. Die Dekorationsbemalung verschwand unter beigen Anstrichen, die Türen wurden hölzern. Der Eingang von der Kappelergasse her wurde mit einem Fenster zugesetzt, die Eingangstreppe unter einer hölzernen Bodenkonstruktion verborgen, und die Wandpilaster wurden abgeschlagen. Den für Zürich einzigartigen, mit Säulen und Wandvorlagen gegliederten Lichthof dagegen erhielt er.
Die Spuren der Zeit – und der Umgang damit
Im Laufe der Jahrzehnte geriet Geisers repräsentativer Neorenaissancebau in Vergessenheit. Nachdem 1968 der Lichthof für Archivräume zugebaut worden war, verschwand mit dem Licht auch die architektonische Qualität des Hauses endgültig. Auch Gulls Erweiterungsbau wurde im Laufe der Jahrzehnte durch Um- und Neunutzungen, Unterhaltsmassnahmen sowie technische und räumliche Anpassungen verunklärt und im Erscheinungsbild banalisiert. Die aktuelle Instandsetzung sah Raumoptimierung und haustechnische Erneuerungen vor – nur scheinbar harmlose Eingriffe, denn mittlerweile waren die Häuser am Rande ihrer Nutzungskapazität angelangt. Nach der Instandstellung der Fassaden versuchte man, die räumlichen und architektonischen Qualitäten im Inneren wieder sichtbar zu machen. Das Zürcher Büro Pfister Schiess Tropeano Architekten musste zudem bei fortlaufendem Betrieb über Etappierungen einen «flächeneffizienten, optimal genutzten Verwaltungsbau» schaffen – eine grosse logistische Herausforderung. Gestiegene Anforderungen an Sicherheit, Brandschutz, Infrastruktur und Energiebedarf sowie an die Repräsentation galt es mit dem begrenzten Potenzial der historischen Häuser in Einklang zu bringen. Dies alles musste denkmalpflegerisch angemessen und mit einer eigenständigen, einheitlichen architektonischen Handschrift erfolgen. Das architektonische und das denkmalpflegerische Konzept waren daher eng miteinander verknüpft.
Mit der ersten Bauetappe kehrten Licht, Farbe und Architekturformen ins Geisers Stadthaus zurück. Der Lichthof konnte bis zur gläsernen Staubdecke unterhalb des Dachgeschosses wieder geöffnet werden (Abb. 15 sowie Abb. 17 und 18, S. 40). Mit der Öffnung der Eingangshalle auf der Seite Kappelergasse gewann das Treppenhaus seinen räumlichen Auftakt wieder. Der originale erste Stadthauseingang von der Kappelergasse her kommt feuerpolizeilichen Anforderungen entgegen und dient, behindertengerecht ausgebaut, der Entlastung des Eingangs am Stadthausquai. Zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Geschichte setzt sich Geisers Stadthaus vom Erweiterungsbau Gulls gestalterisch ab: Es sind zwei Stadthäuser in einem.
Alte Qualitäten wieder sichtbar gemacht
Die originale Ausstattung in Gulls Stadthaus wurde direkt am Bau und über zeitgenössische Literatur «befundet». Gull arbeitete mit nur wenigen Elementen: Pigmentierte Lasuren, Beizen und Lacke betonten die Hölzer der Lamberien, Türen und Bänke, beige Leimfarbe an Wänden und Decken steigerte die Holzfarben, hob das warme Rot der Tonplatten und das Graugrün der Sandsteine hervor. Die Sterne im Gewölbe der offenen Eingangshalle fehlen noch, aber im Eingangsoktogon ist die spätgotisch inspirierte Rankenbemalung im Gewölbe freigelegt. In der Halle sind die bemalten Brüstungsfelder der Zünfte und die beiden Stadtansichten an den Stirnwänden unter der Glastonne gereinigt und wo erforderlich retuschiert worden (inneres Titelbild S. 27 und Abb. 13). Spielerisch übernimmt die Malerei von 1900 in den Brüstungsfeldern der Umgänge Farben und Formen des spätgotischen Klosters; Ranken, Blüten und Tiere illustrieren jedoch nicht das ausgefeilte theologische Programm der Stiftsdamen, sondern die Zürcher Zünfte. Ein mittelalterliches Christusemblem, der Knabe im Blütenkelch, ist weltlich konnotiert.
Ein Besuch im Basler Bauamt zeigte Leistungsfähigkeit und Reparaturmöglichkeiten der in Vergessenheit geratenen Falconnier-Gläser3 der Glastonne über der Halle (vgl. «Historisches Tonnendach aus Glasbausteinen», S. 42 ff). Die wuchtigen Leuchter der 1970er-Jahre sind aus der Tonne verschwunden. Neben den originalen floralen Wandleuchtern belichten runde Wandleuchten die Halle über den umlaufenden Galerien. Verborgen über der Glastonne und noch unter dem jetzt verschattbaren gläsernen Satteldach erbringen Strahler die nötige Grundbeleuchtung der Halle.
Anpassungen an neue Anforderungen
Das Stadthaus zählt zu den meistfrequentierten Amtshäusern der Stadt. Dem trägt ein Stadtbüro als erste, offen gestaltete Anlaufstelle in der Schalterhalle Rechnung. Für die Denkmalpflege war dies ein schwerer Eingriff: Die bisher umlaufende geschlossene Schalterfront ist über fünf Bögen für das Stadtbüro neu gestaltet beziehungsweise geöffnet (Abb. 1, S. 35). Der Stadtratssaal, der einige Jahre zuvor durch Arthur Rüegg und Silvio Schmed renoviert, neu möbliert und «technisiert» worden ist, war von der Sanierung ausgenommen. Neu eingefügt wurde ein Konferenz- und Medienraum. Trauzimmer und Musiksaal mussten dagegen technisch, unter anderem mit einer Lüftung, optimiert werden. In beiden Räumen fand sich ein Patchwork aus originaler Ausstattung und jüngeren Einbauten. Hier setzt das Sanierungs- und Gestaltungskonzept ein: Im Trauzimmer macht ein dunkler, rötlich pigmentierter Lack die von den spätgotischen Äbtissinnenzimmern inspirierten Flachschnitzereien der Wand- und Deckentäfer wieder lesbar. Tapeten fügen die isolierten Täferflächen wieder zu einem Raum. Die moderne Möblierung und Beleuchtung ist auf einer Teppichinsel konzentriert und besetzt die Raummitte, der Teppich nimmt die floralen Muster des originalen Linoleums auf. Der Musiksaal wiederum erneuerte zum dritten Mal sein Innenleben (vgl. Kasten S. 30–31). Das Stadtbüro im Erdgeschoss der Halle, die Cafeteria im Dach (Abb. 19, S. 41), die Weiterführung der Gull’schen Treppe ins Dachgeschoss (Abb. 9, S. 37) und die Brandschutztüren in den Korridoren sind nüchtern gestaltet; Metall bestimmt die architektonische Erscheinung. Daneben wurden viele technische Erneuerungen versteckt geführt. Komplexe Eingriffe für Sicherheit und Brandschutz integrierte man gestalterisch oder nahm sie optisch zurück: an sich die Quadratur des Kreises.
Aus denkmalpflegerischer Sicht ist es dem Team von Handwerkern, Restaurateuren, Ingenieuren und Architekten um Rita Schiess gelungen, hochkomplexe Nutzungsanforderungen mit architektonischer Feinarbeit in den historischen Bestand einzufügen. Es ist zu hoffen, dass umsichtiger Unterhalt der hohen architektonischen Qualität des «Dauer-Provisoriums Stadthaus» – nach nun 486 beziehungsweise 115 Jahren am gleichen Standort – auch in den kommenden Jahren gerecht wird.TEC21, Fr., 2010.11.05
[ Theresia Gürtler Berger, Projektleiterin, Praktische Denkmalpflege, Amt für Städtebau der Stadt Zürich ]
05. November 2010 Theresia Gürtler Berger
Historismus, aktualisiert
Als moderner Dienstleistungsbetrieb bedient die Stadtverwaltung Zürichs ihre Bewohner und Bewohnerinnen wie Kunden; in den Verwaltungsbauten sollte der betriebliche Wandel der letzten Jahre zum Ausdruck kommen. Das hundertjährige Stadthaus, Abbild der Stadt und ihres Selbstverständnisses, musste altersbedingt instand gesetzt und gebäudetechnisch erneuert werden. Nach der durchgreifenden Sanierung durch Pfister Schiess Tropeano Architekten präsentiert sich die historistische Architektur teils in wiederhergestellter, teils in den aktuellen Ansprüchen angepasster Gestalt. Im Vordergrund standen Fragen nach Bürgernähe und Repräsentation.
Für die Erneuerung des rund hundertjährigen, denkmalgeschützten Stadthauses von Zürich wurde im Jahr 2000 ein Planerwahlverfahren ausgeschrieben. Es begann eine langfristige, in Etappen durchgeführte Gesamtsanierung. Nach der vorausgegangenen Vorprojektstudie und in den ersten vier Jahren durchgeführten Ad-hoc-Eingriffen wurden die weitreichenden Sanierungsarbeiten in den Jahren 2007 bis 2010 unter halbem Betrieb realisiert. Das Stadthaus markiert den Anfang der Entwicklung Zürichs zur Grossstadt. Im Jahr 1893 hatte sich die Bevölkerung mit der Eingemeindung der elf Vororte auf einen Schlag vervierfacht. Umgehend beauftragte der Stadtrat den Architekten Gustav Gull für ein repräsentatives Verwaltungszentrum, wovon einige Amtshäuser um den Werdmühleplatz gebaut wurden. Das gross angelegte Stadthaus allerdings, das den Kern der opulenten Anlage bilden sollte, blieb Vision. Als Notbehelf erweiterte Gull, unterdessen zum «planenden» zweiten Stadtbaumeister ernannt, 1898–1901 das existierende Stadthaus neben der Fraumünsterkirche, das Stadtbaumeister Arnold Geiser 1883/84 errichtet hatte.
Reaktivierung des vereinnahmten Geiser-Baus
Bei der jetzigen Sanierung des Stadthauses mussten sich die Architekten der Geschichte des Gebäudes, seines Standortes und seiner Bedeutung stellen. Zunächst brachte eine gründliche Bestandesaufnahme und Analyse genaue Erkenntnisse über die überlieferte Bausubstanz. Die verwischten Grenzen zwischen dem ersten Stadthaus von Geiser und dem Vollausbau von Gull wurden aufgedeckt. Gemäss zutage geförderten Spuren hatte Gull den damals bestehenden Geiser-Bau richtiggehend vereinnahmt; spätere Innenumbauten nahmen der Neorenaissancearchitektur und seiner zeittypisch dekorierten Innenausstattung jeglichen Charme. Zusammen mit der Denkmalpflege entschied man daher, die wiederentdeckten Qualitäten zu reaktivieren. So wurde der auf ein Fenster reduzierte Haupteingang auf der Seite Kappelergasse wieder geöffnet, und der von Einbauten befreite Lichthof vertreibt die miefige Atmosphäre der dunklen Korridore. Beim Vergleich der Baueingabepläne Gulls mit den Ausführungsplänen wurden zwei wesentliche Unterschiede deutlich: Sowohl die frei stehende Treppe am südlichen Ende der gebäudehohen Halle als auch die Fortführung der Haupttreppe ins vierte Obergeschoss wurden weggelassen. Offensichtlich beurteilte die Stadtverwaltung das Gull’sche Projekt nun doch als zu umfangreich.
Klärung der Strukturen und Hierarchien
In ihrer Analyse des Istzustandes registrierten die Architekten zunächst alle hinzugefügten und entfernten Teile, die das Bauwerk während der ersten hundert Jahre Gebrauch verändert hatten. Ab 1950 hatte man massiv in die Gebäudestruktur eingegriffen, abgehängte Decken und eingezogene Böden verunklärten die ursprüngliche Raumwirkung. Die vielen Zwischenwände, die in den folgenden Jahrzehnten Grossraumbüros in Einzelbüros unterteilten, beurteilten die Architekten als «Atomisierung» der Raumstrukturen. Typologisch unterschieden sie zwei Gebäudehälften: das Hofgebäude mit der glasüberdachten Innenhalle zur Limmat hin und das Hofgebäude mit einem offenen Innenhof gegen den Paradeplatz. Während der vordere, flussseitige Gebäudebereich repräsentative Räume und einen hohen Öffentlichkeitsgrad aufweist, ist der hintere durch weniger repräsentative Räume und eine geringere Öffentlichkeit charakterisiert. Gemäss dieser Hierarchie liegen die bedeutenderen Räumlichkeiten an der Front zur Limmat, zudem sind die wichtigsten Grossräume in der Mittelachse angeordnet. Diesen Prinzipien sollten auch alle anstehenden Umwandlungen gehorchen.
Aufwertung durch erneuernde Eingriffe
Im Erdgeschoss der stimmungsvollen Oberlichthalle befanden sich die verschiedenen Schalter. In ihrem Wettbewerbsprojekt beabsichtigten die Architekten zunächst, die ehemaligen Schalterräume an der Flussseite auf Strassenniveau abzusenken und darin ein grosszügiges, frei zugängliches sogenanntes Stadtbüro einzurichten (Abb. 1). Da die Kellerräume nicht disponibel waren, situierten die Architeken das Stadtbüro schliesslich gegenüber dem Haupteingang. Trotz der Zugänglichkeit der rückwärtigen Informationstheken blieben die Schalter funktionell bestehen, doch wurden ihre Fronten mit brüniertem Messingblech verkleidet. Diese golden schimmernde Veredelung wird durch mehr oder weniger Berührungen schnell Patina annehmen, eine einberechnete Anpassung der Aufwertung an den gealterten Bestand.
An der Südwestecke der Halle implantierten die Architekten einen zusätzlichen, gut sichtbaren Lift. Die Haupttreppe in der Nordwestecke verlängerten sie bis ins oberste Geschoss; ausgeführt wurde diese Komplettierung des Gull’schen Projekts in einer reinen Stahlkonstruktion, die sich deutlich von den steinernen Treppen unterscheidet. Als neues Element erkennbar ist das Zwischenpodest frei im Stiegenraum aufgehängt, und ein eingefügter Lichtschacht sorgt für eine helle Rauminszenierung (Abb. 9, S. 37). Die Neumöblierung des Trauzimmers im ersten Obergeschoss war eine der vorgezogenen Massnahmen (vgl. «Provisorien leben länger», S. 28). Während des Umbaus wurden nun Lüftungsgitter geschickt in die Füllungen des Holztäfers eingefügt und Tapeten in einer der historischen Ausstattung angepassten Art ergänzt.
Im zweiten Obergeschoss richtete man in der Mittelachse gegenüber dem Stadtratssaal – der schon 1999 von Silvio Schmed und Arthur Rüegg neu gestaltet worden war – durch die Zusammenlegung zweier Büros einen grösseren Konferenzraum mit entsprechender technischer Ausrüstung ein. Hier sind unter den Stichbogenfenstern die Sitzbänke, unter denen sich die Radiatoren und Kühlungsgeräte verbergen, mit ihrem dunkelbraunen Lederbezug wiederum als zeitgenössische Zutat diskret, aber deutlich erkennbar. Der barocke Musiksaal im dritten Stock schliesslich, den Gull samt Stuckdecke und Deckengemälde aus dem Fraumünsteramt übernommen hatte, sollte auch belüftet und zeitweise gekühlt werden können. Die in den 1950er-Jahren als Resonanzkörper eingefügten Wandverkleidungen wurden ersetzt und zur Zuluft führenden Schicht umfunktioniert. In der umlaufenden Brüstungsschicht sind nebst den Luftquellflächen alle Medien inklusive Projektionswände integriert. Für die luftdurchlässige hölzerne Abdeckung erfand der Tüftler mathematisch generierter Formen Urs B. Roth ein abstraktes, auf dem Kreis basierendes gitterartiges Fries, das zu den floral verzierten, ringförmigen schmiedeisernen Kronleuchtern passt (vgl. Kasten S. 30–31).
Neue Fenster, Türen, Oberflächen
Geisers und Gulls historistische Fassaden wurden soweit nötig denkmalpflegerisch renoviert. Am vorgeblendeten Sandsteinmauerwerk mussten einige Quader und Simse ersetzt werden, anderes wurde ausgebessert. Am Gull-Bau waren sämtliche Fenster original und in gutem Zustand erhalten. Wie ehemals ist das Lärchenholz wieder aussen braun gestrichen, innen rötlich braun gebeizt und transparent lackiert. Die Holzrollläden auf der Strassenseite und die Markisen auf der Hofseite wurden instandgesetzt oder wiederhergestellt. Jede Türe ist einzeln auf ihre funktionalen und gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften getrimmt. Für die hinzugekommenen Brandabschnittstüren entwickelten die Architekten eine kastenförmige Konstruktion, halb standardisiert, halb massgeschneidert, die auch Installationen aufnimmt. Im Innern wurden die Böden, Decken und Wände freigelegt, aufgefrischt, überholt oder ausgewechselt. Von all dem hinterlassen die Räume nach Beendigung der Bauarbeiten nur noch eine leise Ahnung, so selbstverständlich wirken sie. Unter den Oberflächen ist die verlangte Haustechnik so unauffällig wie möglich integriert.
Signaletik und Leuchten
Von Beginn weg waren sowohl ein neues Beschriftungs- als auch ein Beleuchtungskonzept gefordert. Daher bildeten die Architekten schon im selektiven Projektwettbewerb eine Arbeitsgemeinschaft mit entsprechenden Fachplanern. Das Atelier Markus Bruggisser entwarf die gesamte Signaletik. Diese leitet die Besucherinnen und Besucher vom Eingang über die Erschliessungswege bis zu den gesuchten Räumen. In dem Gebäude, das mehrere Departemente und Amtsstellen mit rund 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beherbergt, die pro Jahr 250 000 Kundenbesuche abwickeln, ist eine einheitliche visuelle Kommunikation von hoher Bedeutung. Vor jedem Raum sorgt eine hochformatige dunkelgraue (Geiser-Bau) beziehungsweise schwarze (Gull-Bau) Tafel mit weisser Beschriftung in ruhiger und klarer Weise für die nötige Information.
Die Neue Werkstatt Winterthur bearbeitete die Lichtplanung vor allem der öffentlichen Gebäudebereiche. Nebst Serienprodukten kamen auch Sonderanfertigungen zum Einsatz. Die verbliebenen historischen Wandleuchter von Gull wurden von alten Farbschichten befreit und neu elektrifiziert. Im Erdgeschoss der Halle und im Haupttreppenhaus verströmen sie eine einmalige, die alten Zeiten heraufbeschwörende Stimmung. Speziell für den Ort entwickelt wurden die runden dimmbaren Wandleuchten in der Arkadengängen: Sie sind mit fotografierten Bildausschnitten der alten Leuchter bedruckt (Titelbild S. 27 und Abb. 1, S. 35).
Zeitgemässe Repräsentation
Viele Forderungen waren zu erfüllen, um den Sitz der Stadtregierung den heutigen Anforderungen anzupassen: Brandschutz, Energieeffizienz, Medieninstallationen, Personensicherheit etc. Den Architekten ist es gelungen, die mannigfachen Bedürfnisse zu bündeln und der wieder herausgearbeiteten ursprünglichen Atmosphäre, die über die vielen Jahrzehnte des Gebrauchs stark getrübt worden war, stimmig unterzuordnen – und mit den Erneuerungen eine eigene Linie zu hinterlassen. «Mit den eingefügten Installationen haben wir den Spielraum des Gebäudes absolut ausgereizt», erklärt Gesamtprojektleiterin Rita Schiess. «Wir sind aber froh, dass das Tragwerk, das beim Gull-Bau zum Grossteil aus Stahl besteht, nirgends einschneidend zerstört werden musste. Insofern konnten wir die historische Substanz der Nachwelt erhalten.» Sowohl Geisers als auch Gulls Gebäudebereiche haben sich über die Generationen hinweg in ihrer flexiblen Struktur bestens bewährt und vermögen nach der Gesamtinstandsetzung auch kommenden Generationen zu dienen. So wie ihre historistische Architektur typischer Ausdruck zürcherischer Repräsentation ist, so wirken auch alle verändernden Eingriffe der Sanierung selbstbewusst zurückhaltend.
[ Michael Hanak, Kunst- und Architekturhistoriker ] hanak@swissonline.chTEC21, Fr., 2010.11.05
Literatur:
S. Widmer: Das Stadthaus in Zürich und seine Umgebung, Schweizerische Kunstführer 260. Basel 1979
I. Beckel, D. Kurz (Red.): Drei Umbaustrategien. Die Zürcher Verwaltungsbauten von Gustav Gull. Zürich 2004
05. November 2010 Michael Hanak