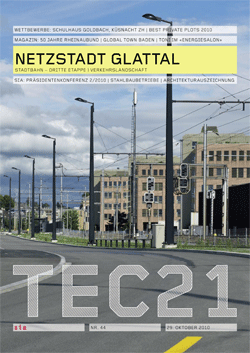Editorial
Ich steige am Bahnhof Stettbach aus der S-Bahn, vor mir eine von Zweckbauten gesäumte Strasse, im Hintergrund mischen sich Kuhglo-ckengeläut und Verkehrslärm. Durch eine Baulücke sehe ich einen Traktor auf dem Feld, darüber im Minutentakt die grössten Flugzeuge der Welt. Wo bin ich? In der Stadt? Auf dem Land? – Ich bin an der künftigen Endhaltestelle der dritten Etappe der Glattalbahn; zehn öV-Minuten vom Zürcher Bellevue.
Ab dem 12. Dezember 2010 wird die Glattalbahn die Städte und Gemeinden der nördlichen Agglomeration Zürichs, der sogenannten Netzstadt Glattal, tangential verbinden.1 Das heisst: Sie führt nicht vom Glattal in die Zürcher Innenstadt oder von dort in die Agglomeration, sondern durch das Glattal, ein dicht besiedeltes Gebiet, das von mehreren Autobahnen und Bahntrassees durchzogen ist.
Die einheitlich und architektonisch ansprechend gestalteten Fahrleitungsmasten, Haltestellen und weiteren Module der Bahninfrastruktur machen die neue Verkehrsanlage sichtbar. Die durchgestylten Elemente wirken im Chaos der Agglomeration noch fremd. Doch die Be-völkerung und die Zahl der Arbeitsplätze wachsen in diesem Gebiet überdurchschnittlich schnell, und jeder verfügbare Quadratmeter wird überbaut, seit bekannt ist, dass das Projekt Glattalbahn realisiert wird.
Offen ist die Maschenweite der Netzstadt. Bleibt nur Platz für Grossprojekte? Haben auch bestehende Kleinode oder Subkulturen eine Chance? Hilft die Glattalbahn, aus dem chaotischen Agglo-Konglomerat eine Stadt zu machen?
Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schulhaus Goldbach in Küsnacht ZH | Best Private Plots 2010
12 MAGAZIN
50 Jahre Rheinaubund | Global Town Baden| Toni im «Energiesalon» | Freigelegtes Mauerwerk
22 STADTBAHN – DRITTE ETAPPE
Andreas Flury, Hannes Schneebeli Im Norden von Zürich führt eine neue Stadtbahn tangential zur Kernstadt durch das Glattal.
Der Bau der dritten Etappe im dicht besiedelten Gebiet war eine besondere Herausforderung.
29 VERKEHRSLANDSCHAFT
Andreas Hofer Die Entwicklung der Glattstadt ist seit je eng mit der Einführung neuer Verkehrssysteme verbunden. Die neue Stadtbahn wird die Region weiter verändern.
37 SIA
Präsidentenkonferenz 2/2010 | Qualifikation für Stahlbaubetriebe | Architekturauszeichnung Solothurn | Sind Wohnhäuser die Lösung?
40 PRODUKTE
41 FIRMEN
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Stadtbahn – Dritte Etappe
Die Glattalbahn führt als Tangentiallinie zur Kernstadt Zürich durch die Städte und Gemeinden im Glattal. Seit den ersten Ideen für ein neues Verkehrssystem in der Netzstadt Glattal sind 20 Jahre vergangen, in denen geplant, projektiert und realisiert wurde. Mit der Inbetriebnahme der dritten Etappe ist die Erschliessung vorerst beendet. Die besonderen Herausforderungen beim Bau waren das dicht besiedelte Gebiet und die Forderung, den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.
Wo und wie sollte sich eine neue Stadtbahn im aufstrebenden Gürtel von Arbeits- und Wohnstätten des Mittleren Glattals ins System und in die Netze der bestehenden Grob- und Feinverteiler einreihen? Sollte sie mehr als S-Bahn, mehr als Tram oder sogar als vollkommen konfliktfreie Hochbahn ausgestaltet werden, wie es erste Ideen im Jahre 1988 propagierten? Die zuständigen Gremien entschieden sich für eine Bahn auf Stadtniveau, die auch auf dem Tramnetz der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) verkehren kann. Gegenüber einer Hochbahn hat dies den Vorteil, dass die Passagiere ebenerdig ein- und aussteigen und die Linien umsteigefrei durchgebunden werden können.
Flexibler als eine S-Bahn, schneller als Tram und Bus
«Mittelverteiler» – der erste Name des neuen Systems brachte die Idee auf den Punkt. Es sollte sich weder um eine S-Bahn noch um ein Tram handeln. Geplant wurde vielmehr eine Stadtbahn, die den Raum rasch, sicher und zuverlässig erschliesst und an die Bahnhöfe der Region anbindet. Rasch bedeutet, dass das System mit einer Beförderungsgeschwindigkeit von 25 km/h verkehrt und damit konkurrenzfähig zu den übrigen Verkehrsträgern ist. Sicher und zuverlässig heisst, Konflikte mit den übrigen Verkehrsträgern zu vermeiden und Kreuzungen zum Beispiel mit Lichtsignalanlagen oder Schranken zu sichern. Um beides zu erreichen, ist ein hoher Anteil Eigentrassee nötig; bei der Glattalbahn liegt dieser bei 96 %. Lediglich auf 4 % der Strecke teilt sie sich den Raum mit den übrigen Verkehrsteilnehmenden. Sie erhält ihr Trassee während beschränkter Zeit priorisiert. Im Umkreis von 400 m um die Haltestellen soll das Nachfragepotenzial möglichst hoch sein. Diese Vorgabe zur Standortwahl wurde unter anderem mittels GIS-Analysen optimiert und verifiziert. Daneben gab es in der Planung viele Randbedingungen zu beachten, unter anderem die Vorgabe des Regierungsrates des Kantons Zürich auf Wahrung der Leistungsfähigkeit des Strassennetzes oder die Querung von bestehenden SBB-Gleisen und Autobahnen (vgl. Kasten Seite 25).
Auf GrossBohrpfählen über die Autobahn
Wenn immer möglich verläuft die Glattalbahn auf der Stadtebene, wo sich auch ihre Fahrgäste bewegen. In einigen Bereichen war dies aufgrund verschiedener Faktoren nicht möglich. Etwa 20 % der Neubaustrecke befinden sich deshalb auf Brücken. Der Viadukt Glattzentrum in Wallisellen ist mit 1200 m die längste Brücke im Netz der Glattalbahn. Er steht auf knapp 100 Grossbohrpfählen von 90 oder 120 cm Durchmesser und bis zu 35 m Länge. 10 000 m³ Beton wurden verbaut und 1500 t Lehrgerüstmaterialien verwendet. Ausgeführt ist die Hohlkastenbrücke in Spannbetonbauweise. Die mittleren Abstände zwischen den Stützen betragen 35 m, die maximale Spannweite liegt bei 47 m. Der Viadukt überquert die SBB-Linie Wallisellen–Winterthur/Uster und die Nationalstrasse A1 Zürich–Winterthur. Genau über der SBB-Linie und der Nationalstrasse befinden sich die Gleisabschnitte mit der grössten und nach Gesetz maximal zulässigen Querneigung von 105 mm. Die Steigungen der Rampen von 58 und 55 ‰ liegen dagegen unter dem gesetzlichen Maximum von 70 ‰. Zwischen der Überlandstrasse und der Glatt durchquert das Trassee ein Grundstück, für das zurzeit ein Gestaltungsplan erarbeitet wird. Der Eigentümer beabsichtigt, beidseits des Trassees Hochbauten zu erstellen und diese mit einer Einstellhalle unter dem Bahntrassee zu verbinden. Um gute Voraussetzungen für dieses Vorhaben zu schaffen, wurde anstelle des ursprünglich vorgesehenen Dammes die zweite lange Brücke der dritten Etappe erstellt. Mit dieser Lösung konnten gleichzeitig Probleme mit dem schlechten Baugrund an dieser Stelle gelöst werden.
Technische Sonderkonstruktionen
Bei der Projektentwicklung der Viadukte musste eine Lösung für die Kraftübertragung zwischen Gleis und Brückenbauwerk sowie für die Brückenisolierung gefunden werden. Verformungen der Brückenüberbauten und ein allfälliger negativer Einfluss auf das Gleis mussten verhindert werden. Des Weiteren stand eine gebrauchstaugliche Ausführung der Dilatationen und der Schienenauszüge zur Diskussion sowie die Schnittstellen zwischen dem Brückentragwerk und dem Gleisoberbau einschliesslich Entwässerung. Die Realisierung eines schotterlosen Gleisoberbaus, einer sogenannten festen Fahrbahn, auf langen Brücken ist für die Schweiz neu. Aus diesem Grund musste bei der Projektierung eng mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) als Bewilligungsbehörde zusammengearbeitet werden. Die Interaktionen zwischen Brücke und Gleisoberbau mussten dargestellt werden, und es waren verschiedene rechnerische Nachweise notwendig, damit das Gleisoberbauprojekt definitiv genehmigt werden konnte. Die Viadukte weisen grosse Abschnittslängen zwischen den Dilatationsfugen auf. Die Längsverschiebungen der Brücke werden durch Schienenauszüge aufgefangen. Diese sind die sichtbarsten technischen Sonderkonstruktionen als Resultat der Projektierung.
Verkehrsführung beim Arbeiten in dicht bebautem Gebiet
Der Bau der Glattalbahn fand in intensiv genutzten städtischen Räumen statt. Bereits vor Baubeginn staute sich in den Spitzenstunden der Verkehr auf dem Strassennetz. Es wurde angenommen, dass sich insbesondere während des Baus der dritten Etappe die Verkehrssituation weiter verschärfen würde. Die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) hat deshalb Spezialisten beauftragt, ein Verkehrsführungskonzept für die Bauzeit auszuarbeiten. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der betroffenen Städte und Gemeinden sowie den Spezialisten erarbeitete periodisch Lösungsvorschläge, um die Verkehrsführung während der lokalen Bauphasen optimal zu gestalten, Voraussetzungen für einen möglichst störungsfreien Busbetrieb zu schaffen und den Ausweichverkehr in sensible Quartiere zu unterbinden. Hauptbestandteil des übergeordneten Verkehrsführungskonzeptes war ein Informationskonzept. Via Internet, News-Mails, Informationsschreiben und Medienanlässe wurden Anrainer und Verkehrsteilnehmende über bevorstehende Bauphasen oder aktuelle Behinderungen informiert und erhielten Tipps zum Verkehrsverhalten.
Bei Fragen, Kritik oder Anregungen konnten die Betroffenen über ein Formular auf der Internetseite sowie über ein Infotelefon rund um die Uhr mit der VBG Kontakt aufnehmen. Ergänzend zu den lokalen Massnahmen empfahlen die Verkehrsspezialisten, das Baugebiet grossräumig zu umfahren und bevorzugt die Autobahnen zu benutzen. Zur Unterstützung dieser Empfehlung wurden die ursprünglich vorgesehenen Baustellen auf den Zufahrtsachsen zu den Autobahnanschlüssen zurückgestellt.
Die Stadt unter der Stadt sanieren
Die Bevölkerung ist gewohnt, dass der Verkehr trotz Bau oder Unterhalt von Strassen fliesst. Genauso selbstverständlich sind praktisch ununterbrochen funktionsfähige Werkleitungen. Es ist undenkbar, dass ein Quartier oder ein Haus auch nur für Tage vom Wassernetz getrennt, eine Erdgashochdruckleitung zu einem Heizwerk in der kalten Jahreszeit oder eine Fernsehstandleitung während eines Grossanlasses unterbrochen werden. Im Perimeter der Glattalbahn befindet sich die normale Bandbreite von Ver- und Entsorgungsleitungen wie Abwasser, Wasser-, Strom- und Erdgasversorgung, Telecom und diverse Steuerkabel. Im Gegensatz zum Strassenbau ist es bei Werkleitungen kaum möglich, Trassees temporär zu verschieben oder Querschnitte zu verengen. Der Platz der bestehenden, noch in Betrieb stehenden Werkleitungen steht nicht zur Verfügung. Daraus resultiert die Herausforderung, zwischen den «wild» verlegten, bestehenden Werkleitungen genügend Platz für die neuen Trassees zu finden.
In einem durchschnittlichen Tiefbauobjekt der Glattalbahn betrug der Kostenanteil der Werkleitungen bis zu 25 % der Gesamtobjektsumme.1 Die Realisierung der Werkleitungen ist mit viel Handarbeit verbunden; der Einsatz von Baumaschinen ist selten möglich. Dieser Umstand erklärt die oft gehörte Meinung, dass nach Baubeginn auf der Stadtebene kaum mehr etwas passiert. Die Herausforderung, genügend Platz für die neuen Trassees zu finden, ist noch nicht bewältigt, wenn im Untergrund physisch Platz für die Leitungen gefunden ist. Es gilt zu prüfen, ob Projekte an der Oberfläche die getroffene Wahl zulassen. Beispielsweise ist es nicht zulässig, über eine Erdgashochdruckleitung Bäume zu pflanzen. Auch der Bau von Fundamenten für Signalisationen ist nicht zulässig, wenn sie in den Nahbereich einer Erdgashochdruckleitung zu liegen kämen. Wenig sinnvoll ist es, Leitungen längs und unterhalb des Bahntrassees zu platzieren: Die Zugänglichkeit für die erforderlichen Unterhaltsarbeiten wäre durch den Bahnbetrieb extrem beeinträchtigt.
Bewohner und Umwelt respektieren
Es ist offensichtlich, dass nicht nur der künftige Betrieb der Glattalbahn Konsequenzen für die Umwelt haben wird, sondern schon die Bauzeit Auswirkungen auf Umwelt und BewohnerInnen der Region mit sich brachte. Bereits in der Bauphase mussten die umweltrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Aus diesem Grund verfügte das BAV als Genehmigungsbehörde Umweltauflagen. Diese betreffen zum Beispiel Massnahmen zur Begrenzung der Luftbelastung, zur Schonung von Gewässern und Boden, zum Schutz von Biotopen und zur Beseitigung von Altlasten. Als System leistet die Glattalbahn einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Umweltqualität. Für Fahrten, die bisher mit dem Auto durchgeführt wurden, bietet die neue Glattalbahn- Linie eine attraktive Alternative. Bestehende Buslinien werden durch die Stadtbahn abgelöst.
Sie verkehrt mit «naturemade basic»-zertifizierter Energie (sofern vom energieversorgenden Werk angeboten). Das heisst, der Bezug besteht aus mehrheitlich blauem Strom aus zertifizierten Wasserkraftanlagen und einem Anteil Ökostrom von rund 5 %. Das Einzugsgebiet der Glattalbahn stellt hohe Anforderungen bezüglich Erschütterungsund Körperschallschutz. Zahlreiche Unternehmungen aus der Hightech- und der Dienstleistungsbranche haben sich neben dem Trassee angesiedelt.
Wo nötig, wurden daher sogenannte «Masse-Feder-Systeme» eingebaut. Die mindestens 22 cm dicken, armierten Gleistragplatten sind mit Elastomer- oder bei geringeren Anforderungen mit Mineralwollmatten unterlegt. Dieses System reduziert die Erschütterungen und den Körperschall markant. Die Wirkungsweise beruht auf einfachen physikalischen Prinzipien: Je grösser die abgefederte Masse und je weicher die Federn, desto grösser ist die Wirkung.
Das Standardgleis der Glattalbahn ist mit einem Schotterrasen verfüllt, der rund 3 Dezibel Lärm schluckt. Garant für die Minimierung der Lärmausbreitung ist jedoch in erster Linie das Rollmaterial. Auf der Linie 12 wird der Fahrzeugtyp «Cobra» eingesetzt. Dank den Einzelradaufhängungen quietscht dieser in den Kurven nicht.
Umgang mit der Dynamik im Umfeld
Nirgends hat sich das Umfeld um das Glattalbahntrassee derart stark verändert wie entlang der dritten Etappe. Vor allem zwischen dem Bahnhof Wallisellen und Giessen in Dübendorf ist das Trassee in Gestaltungspläne eingebunden, die erst nach Abschluss des Bauprojekts der Glattalbahn im Jahr 2001 erstellt wurden. Um der Gefahr zu begegnen, ein veraltetes Projekt in ein dynamisches Umfeld zu bauen, wurde die Linienführung der dritten Etappe nach der Freigabe zur Realisierung im Jahr 2007 auf den Prüfstand gehoben. Insgesamt 22 Projektänderungen wurden unter Einbezug der Standortgemeinden und der Anrainer prozesshaft entwickelt. Elf davon mussten dem BAV zur Plangenehmigung eingereicht werden. Da sowohl der Kostenrahmen als auch der Ablaufplan für die dritte Etappe vorgegeben waren, mussten die Lösungen immer mit Blick auf Kosten und Termine entwickelt werden.
Vielen Unkenrufen zum Trotz kann das Projekt Glattalbahn Ende 2010 seinen Abschluss feiern. Es zeigt sich, dass der Bau und Betrieb einer Stadtbahn in sehr dicht bebautem Umfeld möglich ist. Die Projektziele Leistung (Quantität und Qualität), Kosten und Termine sind im ganzen Glattalbahnprojekt mit grosser Wahrscheinlichkeit im vereinbarten Rahmen erreicht; in den ersten zwei Etappen ist diese Aussage gesichert, in der dritten entspricht sie der aktuellen Prognose.
[ Andreas Flury, Dr. sc. techn., dipl. Kultur-Ing. ETH/SIA; Direktor VBG und Gesamtprojektleiter Glattalbahn
Hannes Schneebeli, dipl. Geomatik-Ing. ETH/SVI, Exec. MBA; Leiter Infrastruktur VBG und stv. Gesamtprojektleiter Glattalbahn ]TEC21, Do., 2010.10.28
Anmerkung:
[1] Das Bundesgericht entschied mit Urteil vom 27. April 2005 (BGE 131 II 420 ff.), dass die Anpassungen von Werkleitungen, die durch den Bau der Glattalbahn verursacht werden, von der VBG zu tragen sind. Vorbehalten bleibt die Abgeltung der Vorteile, die den Leitungseigentümern aus den Neuanlagen entstehen (Mehrwertabgeltung)
28. Oktober 2010 Andreas Flury, Hannes Schneebeli
Verkehrslandschaft
Der Aufbau der nationalen Verkehrsinfrastruktur hat den Raum Zürich Nord erschlossen und seine Entwicklung geprägt. Mit der Glattalbahn, die zum ersten Mal interne Verbindungen schafft, könnte eine eigene, die politischen Grenzen überwindende Identität entstehen.
Die vom ehemaligen ETH-Dozenten Martin Geiger1 entwickelte Standort-, Nutzungs- und Landwerttheorie (SNL-Theorie) kennt nur zwei Faktoren für die Güte eines Standorts: sein «Beziehungspotenzial» und den «umweltbedingten Eigenwert». Einfacher formuliert: «Wie nahe bin ich an möglichst vielen anderen Orten?» und «Habe ich Seesicht?». Diese beiden Faktoren bestimmen die Standortentscheide von Betrieben ebenso wie die Nachfrage nach Wohnraum, wobei die Wohnungssuchenden die weichen Faktoren bei der Standortwahl höher gewichten. Da ein gutes Beziehungspotenzial lärmige und zerschneidende Verkehrsinfrastruktur braucht, gibt es einen latenten Widerspruch zwischen guter Erreichbarkeit und hoher Wohnqualität.
Verkehr und wirtschaftliche Kräfte prägen den Raum
Mit der SNL-Theorie kann die räumliche Entwicklung seit der Industrialisierung erklärt werden – so etwa die Bildung von Westends in den meisten europäischen Metropolen (nah an den Schalthebeln der Macht, aber durch die vorherrschenden Westwindlagen vom Rauch aus den Schloten der Fabriken abgewandt), durchgrünte Vororte um die Endstationen des städtischen öffentlichen Verkehrs und schlussendlich Nebenzentren um S-Bahn-Stationen, Autobahnkreuze und Schnellzughalte. Die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz und die räumliche Nähe verleitete die Landesplanung, über Jahrzehnte vom föderalismuskompatiblen Konzept der Schweiz als Netzwerk von intakten kleinen Städten in einer agrar geprägten Landschaft zu träumen: das Mittelland statistisch und wirtschaftlich eine international konkurrenzfähige Grossstadt – aber in der Erscheinung ländlich, provinziell.
Die wirtschaftlichen Kräfte führen aber nicht zu einer demokratisch austarierten Homogenität, sondern sie differenzieren Räume, lassen Knoten wachsen, reissen Peripherie in den Wachstumsmahlstrom oder hängen sie von der Entwicklung ab. Die Nähe und die Erreichbarkeit von vielen Standorten im schweizerischen Mittelland spannen jeden Ort in ein Beziehungsgefüge mit mehreren Nachbarn. So schuf der Nationalstrassenbau im Dreieck Basel, Bern und Zürich, um das Autobahnkreuz Härkingen, einen Knoten mässiger, aber kumulierter Attraktivität mit einer eigenartigen Mischung aus Distributionszentren, Grossmärkten, Sexclubs und Tankstellen. Solche Orte gibt es mittlerweile entlang der Ausfallachsen aller grösseren Städte in der Schweiz und bei wichtigen Verkehrskreuzungen. Zusammen mit den in einigem Abstand wuchernden Wohnsiedlungen sind sie das Mittelland, die Agglomeration. Der Norden von Zürich war in seiner Geschichte mehrmals umkämpfter Ort für Verkehrsinfrastrukturen, bezüglich ihrer Linienführung und Lage. Dabei standen bis zum Bau der Glattalbahn nie Entwicklungsziele für den Raum selber im Vordergrund, sondern Zürich Nord war der Schauplatz von übergeordneten technischen, politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. In ihrer Summe und Zufälligkeit gestalteten sie das heute dynamischste Wachstumsgebiet der Schweiz, oder – leicht vorgreifend – in den Worten Martin Geigers: Der Knoten mit dem höchsten Beziehungspotenzial der Schweiz war damit von Zürich weg in ein «Niemandsland» verschoben, aus dem sogleich eine neue Stadt zu wachsen begann
Der Kampf um die nationale Verkehrsinfrastruktur
Mitte des 19. Jahrhunderts tobte zwischen verschiedenen privaten Gesellschaften der Kampf um die Erschliessung der Schweiz mit der Eisenbahn. Die Konkurrenz um Strecken, Linienführungen und die möglichst schnelle Anbindung von Gütern und potenziellen Passagieren verhalfen der Schweiz zu einem der weltweit dichtesten Netze, dessen Elemente aber in wichtigen Punkten nicht aufeinander abgestimmt waren und das ökonomisch verhängnisvolle Parallellinien aufwies. Schauplatz einer dieser Kämpfe war Oerlikon. Nachdem 1856 eine von Zürcher Freisinnigen finanzierte Verbindung zwischen Zürich, Winterthur und Romanshorn über Oerlikon in Betrieb genommen war (Nordostbahn NOB), versuchten Winterthurer Industrielle durch das Furttal eine Konkurrenzlinie vom Boden- an den Genfersee zu bauen (Nationalbahn S.N.B).
Erbitterte wirtschaftliche Machtpolitik verhinderte den Anschluss von Zürich an diese Strecke und trieb die Nationalbahn nach wenigen Jahren in den Konkurs. Es blieb der Eisenbahnknoten in Oerlikon, der die damals wichtigsten Industriestädte Zürich, Winterthur und Baden verband. Industriebetriebe nutzten die strategische Lage; Oerlikon, das erst mit der zweiten Eingemeindung 1934 zu Zürich kam, wuchs vom Bauerndorf zum Fabrikstandort.2 Der nächste und wohl folgenschwerste Infrastrukturentscheid war die Standortwahl für den internationalen Zivilflughafen während des Zweiten Weltkriegs. Der Bund plante diesen «Schweizerischen Zentralflughafen» in Utzensdorf zwischen Bern und Solothurn. In den Zeiten der Anbauschlacht wog jedoch das Argument der lokalen Bevölkerung, dass für den Bau gewaltige Mengen wertvolles Ackerland geopfert werden müssten, schwerer. 1945 fiel der Standortentscheid für den Waffenplatz Kloten. Dieser lag in einem landwirtschaftlich ungenutzten Ried und gehörte praktischerweise bereits dem Bund.
Der letzte planerisch-politische Prozess, der das Schicksal von Zürich Nord prägte, war die Nationalstrassenplanung. Nachdem sich in den 1960er-Jahren in der Stadt Zürich massiver Widerstand gegen die Verknüpfung der Ost-West-Achse mit der Abzweigung in den Süden im Gebiet des Hauptbahnhofes von Zürich (das sogenannte Ypsilon) formiert hatte, wichen die Planer gegen aussen aus und trieben die Realisierung eines Autobahnrings voran. Der erste Sektor dieses Rings ist die 1985 fertiggestellte Nordumfahrung mit dem Gubristtunnel, der zweite die kürzlich eröffnete Westumfahrung (vgl. TEC21 17/2009). Während 25 Jahren erschloss also die Ringautobahn nicht Zürich, sondern die nördliche Peripherie. Zürich Nord liegt zwischen City und Flughafen, ist mit der wichtigsten Autobahnachse der Schweiz erschlossen und mit dem Bahnhof Oerlikon an den Fern- und S-Bahn-Verkehr angebunden. Bezüglich Beziehungspotenzial gibt es keinen besseren Standort in der Schweiz. Wie sieht es mit dem zweiten Faktor, dem umweltbedingten Eigenwert, aus?
Fehlende Identität
Zwischen den Katzenseen und dem Greifensee, der Glatt und Riedlandschaften und um den Hardwald als «Central Park» der Region liegen acht Gemeinden und zwei städtische Kreise, die sich von Bauerndörfern zu Subzentren entwickelt haben. Eingestreut sind Einkaufszentren, Fachmärkte für jedes Bedürfnis, Multiplexkino, Messezentrum, Sport- und Freizeitanlagen, Parks und Grünräume, Arbeitsplätze in allen Branchen, ETH-Institute und Hochschulen. Die städtischen Wohnquartiere sind durchgrünt und bestens ans Zentrum angeschlossen. Die Gemeinden liegen steuerlich im kantonalen Mittelfeld und wachsen stark, viele von ihnen haben gute Wohnlagen, zu Zeiten der Swissair Pilotenhänge genannt. Der Fluglärm ist ein grosses Thema, das aber die Entwicklung zu einem attraktiven Wohnort nicht bremsen konnte.
Die Anzahl der Arbeitsplätze entspricht ungefähr der Anzahl Menschen, die im Gebiet wohnen – das gleiche Verhältnis wie in der Kernstadt Zürich. Zürich Nord ist also nicht eine Schlafstadt, sondern ein Wirtschaftszentrum mit grossen Zupendlerströmen.3 Was dem Raum im Gegensatz zur Kernstadt fehlt, ist eine eigene Identität. Weder in Schwamendingen noch in einer der Glattal-Gemeinden würde sich ein Bewohner als «Glattaler» bezeichnen. Die Gründung des Standortmarketing-Labels «Glow. das Glattal» im Jahr 2001 konnte an diesem Umstand wenig ändern. Das Netzwerk blieb zu unverbindlich, und die einzelnen Gemeinden sind nicht bereit, zugunsten eines grösseren Ganzen ihre Eigenständigkeit einzuschränken. Näher an der Realität liegt das ebenfalls 2001 erschienene Buch «Annähernd perfekte Peripherie»4, das an der ETH erarbeitet und von Mario Campi, Franz Bucher und Mirko Zardini verfasst wurde. Die Autoren nähern sich dem Gebiet auf vielschichtige Weise, sie zeigen die Brüche, die widersprüchlichen Strukturen und die Inseln im Raum. Sie reden von einer neuen, autonomen urbanen Wirklichkeit: der Glattalstadt. Durch die Verdichtung und Beschleunigung eines weitgehend ungesteuerten Urbanisierungsprozesses wachsen die Gemeinden an der Peripherie zu einem Raum zusammen.
Agglomeration 2.0
Dieser Raum wird nun zum Pionierprojekt für die Zukunft der Agglomeration, einer Wirklichkeit, welche die Schweiz bei anhaltendem wirtschaftlichem Wachstum immer stärker prägen wird und die sich mit unabsehbaren Folgen zwischen die festgefügten Wahrnehmungsbilder von Stadt und Land zu schieben beginnt. Zaghaft nehmen Hochschulen, die Kunst und politische Instanzen in den letzten Jahren diesen Ball auf. Agglomeration ist zwar noch nicht trendy, aber immerhin Gegenstand von Fotoarbeiten von Fischli/Weiss, von Nationalfondsprojekten und Entwurfssemestern an Hochschulen. In Neu-Oerlikon ist zurzeit ein Gewerbegebäude mit dem verspielten Namen «Noerd» im Bau, das neben der Produktion der Freitag-Taschen auch Platz für kreatives Gewerbe bieten wird, und die Szenegastronomen der Gasometer AG betreiben seit diesem Jahr als erstes Lokal ausserhalb der Trendquartiere in Zürich West die Ziegelhütte in Schwamendingen. Dies sind starke erste Zeichen. Die Eröffnung der Glattalbahn könnte als Veredelung der Agglomeration zur traditionellen Stadt gesehen werden. Wo ein Tram fährt, ist nicht Dorf, sondern Quartier. Doch dies wird ein widersprüchlicher und langfristiger Prozess sein. Der neue Verkehrsträger überlagert bestehende Strukturen, schafft mit seinen Stationen häppchenweise Zentralität im Niemandsland und fördert den Trend zu Grossprojekten mit einer postmodernen, synthetischen Identität. Der Glattpark, der seinen umweltbedingten Eigenwert mit einem See steigerte, war hier nur der Anfang. Das Richti-Areal, Mittim und Integra Square in Wallisellen, der InsiderPark und die Bebauung Giessen in Dübendorf behaupten alle, neue Zentren zu sein. Es besteht die Gefahr, dass diese professionell vermarkteten Grossinvestitionen zu taubstummen, ein bisschen zu dicht geratenen Wohnsiedlungen werden, die beziehungslos im Raum stehen. Und es besteht einmal mehr die Hoffnung, dass ein nur mässig durch politische Instanzen regulierter Prozess uns mit etwas Neuem überraschen wird, dass die schiere Menge des Wachstums schliesslich doch so etwas wie Identität produziert: wohl nicht Stadt, aber vielleicht Agglomeration 2.0.
5Die Baugenossenschaft Kraftwerk 1 auf dem Zwicky-Areal
Die Totalunternehmung Senn BPM hat sich ein Teilgebiet des Zwicky-Areales in Dübendorf für die Entwicklung gesichert. Anfang 2009 lud sie über Wüest & Partner die Genossenschaft Kraftwerk1 (vgl. TEC21 42/2001) ein, sich als potenzielle Investorin am Prozess zu beteiligen. Die drei Partner erarbeiteten in der Folge die planerischen Grundlagen (das Baufeld ist Teil eines Gestaltungsplans) und führten einen Studienauftrag mit fünf eingeladenen Architekturbüros durch. Das Areal ist schwierig, lärmig und gross. Das Zürcher Büro Schneider Studer Primas gewann die Konkurrenz. Zurzeit läuft das Bewilligungsverfahren für den abgeänderten Gestaltungsplan. Der Baubeginn ist im Jahre 2012, der Bezug für das Jahr 2014 geplant.
Das circa 25 000 m² grosse Teilgebiet bietet Platz für 250 Wohnungen, Gewerbe- und Verkaufsräume. Unter Einbezug der angrenzenden – in Wohnungen und Gewerberäume umgenutzten – alten Fabrik und der benachbarten Baugebiete entsteht in den nächsten Jahren ein neues Quartier an der Grenze von Wallisellen und Dübendorf, durch dessen Mitte auf der Neugutstrasse die Glattalbahn fährt. KraftWerk1 beabsichtigt, etwa die Hälfte des Teilgebiets zu übernehmen. Weitere Flächen sollen an institutionelle Anleger und als Eigentumswohnungen verkauft werden.
Das Projekt von Schneider Studer Primas überrascht mit einer radikalen Haltung. An einem Standort, der sich auch vorstädtisch interpretieren liesse, schlagen die Architekten eine hochurbane Struktur vor, die sich an Bildern von Industriearealen orientiert. Ein Ring aus dünnen, geknickten Scheiben schirmt das Areal vom Lärm ab. Hier sind in einer flexiblen Struktur kleinere Wohnungen möglich, bei denen alle Zimmer lärmabgewandt gelüftet werden können. In den Sockeln der Scheiben gibt es zweigeschossige Hallen für Gewerbe, Wohnateliers und Grosswohnungen. Schliesslich besetzen grosse, allseitig orientierte Wohn- und Gewerbeblocks das Arealinnere.
Das Areal und das Architekturprojekt haben das Potenzial für vielschichtige Interpretationen der Arbeitenden und Wohnenden. Günstige Mieten und möglichst rohe Räume sollen einen Cluster aus Gewerbe-, Wohn- und Kulturprojekten ergeben – eine Art neu gebauter Freiraum, wie er im Raum Zürich durch die Verwertung der letzten Brachen rar geworden ist.TEC21, Do., 2010.10.28
Anmerkungen
[1] Die Standort-, Nutzungs- und Landwerttheorie wurde in den 1970er-Jahren vom Architekten Martin Geiger an der ETH Zürich entwickelt und später gelehrt. Zur SNL-Theorie vgl. TEC21 10/2007 und www.snl-geiger.ch
[2] H.-P. Bärtschi: Industrialisierung, Eisenbahnschlachten und Städtebau. Birkhäuser, Basel 1983
[3] Die Definition des geografischen Raumes Zürich Nord und der Glattalregion ist uneinheitlich. Der regionale Zusammenschluss «glow. das Glattal» umfasst acht Gemeinden mit circa 100 000 Arbeits- und circa 100 000 Wohnplätzen (www.glow.ch). In den städtischen Kreisen 11 und 12 wohnen weitere 100 000 Menschen und befinden sich 40 000 Arbeitsplätze (Statistik Stadt Zürich: Bevölkerung [2. Quartal 2010])
[4] M. Campi, F. Bucher, M. Zardini: Annähernd perfekte Peripherie. Glattalstadt/Greater Zurich Area. Birkhäuser, Basel/Bosten/Berlin 2001
[5] Für das Internet bezeichnen die Begriffe Web 2.0 und «Social Media» die Verlagerung der Inhaltsproduktion von den Medienkonzernen zu den Mediennutzern. Eine ursprünglich aus dem militärischen und dem elitären Forschungskontext entwickelte Technologie wird von den Nutzenden übernommen und mit deren Inhalten gefüllt. Die Unterscheidung in Produzent und Konsument verwischt sich. Für städtische Räume könnte dieser Prozess die demokratische Aneignung und gestalterische Überformung der gebauten Strukturen durch die Nutzenden im Raum sein
28. Oktober 2010 Andreas Hofer