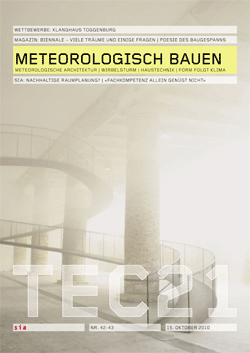Editorial
«[...] das Winterzimmer [...] wo wir dank dem die ganze Nacht hindurch unterhaltenen Kaminfeuer in einem grossen Mantel aus warmer, rauchiger Luft schlafen, durch den der Schein frisch aufflammender Scheite dringt, in einer Art von ungreifbarem Alkoven, von warmer Höhle, die sich im Inneren des Zimmers auftut, einer heissen Zone mit veränderlichen thermischen Konturen, durchzogen von Luftzügen, die uns das Gesicht erfrischen und aus den Ecken kommen, von Stellen nahe dem Fenster oder fern vom Feuer, die sich schon abgekühlt haben; [...].»
Marcel Prousts Beschreibung der klimatischen Atmosphäre evoziert auch die Stimmung, die in dem Raum der Kindheit herrschte. Die Höhle vermittelt ein Gefühl des vor der Unbill der Natur Geschütztseins. Damals wurde im Haus geheizt, und ausserhalb herrschte die natürliche Temperatur. Heute erwärmen wir auch die Umgebung, die Erdatmosphäre, sodass Peter Sloterdjik konstatiert, der ganze Planet sei ein Innenraum geworden – ebenso künstlich wie jener. Der Architekt Philippe Rahm will den Prozess umkehren, den Innenraum natürlicher machen als die Umgebung.
Im Brandfall einen Wirbelsturm zu verursachen ist eine Extremform dieser Idee («Rettender Wirbelsturm»). Mittels Luftströmungssimulationen wird bei der Planung der Haustechnik die Natur in gewisser Weise nachgeahmt («Haustechnik beeinflusst Architektur»). Das Ziel von Philippe Rahm ist es, Temperatur, Licht, Feuchtigkeit als «Baustoffe» zu verwenden. Er konzipiert Räume so, dass sie zu meteorologischen Atmosphären, zu fühlbaren Wetterkarten mutieren. Ihre Bewohner sollen sich zwischen verschiedenen Klimazonen bewegen, zwischen «Kontinenten» migrieren («Form und Funktion folgen dem Klima»). Das klingt wie die Renaissance des Garten Eden. Doch unsere Körper dem Einfluss unsichtbarer Elemente auszusetzen, die fremdgesteuert werden können, birgt auch Gefahren. Ákos Moravánszky («Meteorologische Architektur») hat sie an einem Vortrag Rahms an der ETH Zürich benannt: Die Dichotomie zwischen hedonistisch und medizinisch, zwischen der Freiheit des Garten Eden und der totalen Kontrolle über unsere Körper evoziert die Parabel von Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Klanghaus Toggenburg
08 PERSÖNLICH
Rolf Schneider: «Tanz ist ein biomechanischer Prozess»
10 MAGAZIN
Viele Träume und einige Fragen | Poesie des Baugespanns | Die Krise macht Sinn
18 METEOROLOGISCHE ARCHITEKTUR
Ákos Moravánszky Wegen der Klimaerwärmung bauen Architekten meteorologische Atmosphären: Umwelt nicht mehr nur zum Betrachten, sondern zum Einatmen.
21 RETTENDER WIRBELSTURM
Rüdiger Detzer Für das Mercedes-Benz -Museum in Stuttgart entwickelten die Ingenieure ein Entrauchungskonzept, das im Brandfall einen Wirbelsturm erzeugt.
24 HAUSTECHNIK BEEINFLUSST ARCHITEKTUR
Kurt Hildebrand Eine thermische und strömungstechnische Gebäudesimulation erlaubt, das «Verhalten» eines Gebäudes vorausschauend zu beurteilen.
26 FORM UND FUNKTION FOLGEN DEM KLIMA
Rahel Hartmann Schweizer Philippe Rahm proklamiert die meteorologische Architektur. Mit den «Materialien» Temperatur, Licht und Feuch-tigkeit kreiert er Atmosphären.
33 SIA
Nachhaltige Raumplanung? | Neuer Rahmenlehrplan Bauplanung | Andreas Flury: «Fachkompetenz allein genügt nicht» | Ingenieurtage 2010 | Aktuelle Kurse SIA-Form
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Meteorologische Architektur
Unter dem Eindruck der Klimaerwärmung schaffen Architekten künstliche Natur-Inszenierungen. Sie signalisieren eine Abkehr vom Erschaffen von Bildern und Erfüllen von Funktionen und plädieren stattdessen für das Bauen von meteorologischen Atmosphären. Umwelt wird nicht mehr nur als betrachtet, sondern auch als eingeatmet gedacht. Das visuell Wahrnehmbare wird unterlaufen vom Fühlen unsichtbarer Ingredienzien.
Der Publikumserfolg von immersiven künstlichen Umwelten – wie Peter Zumthors Thermenbad in Vals, Diller Scofidios blur building (bekannt als «die Wolke») an der Expo.02 in Yverdon-les-Bains, Olafur Eliassons Weather Project in der Londoner Tate Modern (2003) oder Philippe Rahms Beitrag Digestible Gulf Stream zur Architekturbiennale in Venedig (2008) – zeigt die wachsende Empfindlichkeit für künstliche Natur-Inszenierungen, für Atmosphären als Ergebnis von diffusen, den Körper umgebenden Arrangements.
In der psychologischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts bezeichnete der Begriff Einfühlung die Projektion der Gefühle des betrachtenden Subjektes ins Kunstwerk, eine Art Beseelung der Objekte der Wirklichkeit, Sympathie zwischen Betrachter und Kunstobjekt. Wir können jenen kollektiven Projektionsakt, mit dem die Gesellschaft auf Artefakte wie die genannten atmosphärischen Räume reagiert, als soziale Einfühlung bezeichen. Diese soziale Einfühlung hat ihre Wurzel in der politischen und kulturellen Sphäre der Zeit: Ein Grund für die Popularität der Atmosphären liegt bestimmt im Suchtpotenzial, das immer perfektere 3-D-Projektionen und virtuelle Räume freisetzen.
Blasen, Globen, Schäume
Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk vermutet allerdings einen tieferen Zusammenhang zwischen dem neuen Bewusstsein für die Atmosphäre und der Kondition des «In-der- Welt-Seins» im technischen Zeitalter.[1] Die Philosophen, behauptet Sloterdijk, waren bisher mit Objekten und Subjekten beschäftigt und haben kaum bemerkt, dass wir uns im Inneren von atmosphärischen Blasen, Globen und Schäumen befinden. Erst seit der ökologischen und Bankenkrise ist uns diese Kondition bewusst geworden: Wir sind Teilnehmer in einem kollektiven Experiment von globalen Dimensionen, dessen Ursachen, Zusammenhänge und die vorgeschlagenen Lösungsansätze uns nicht klar sind. In der Architekturgeschichte erscheinen Visionen von atmosphärisch-meteorologischen «Blasen» als Antworten auf Situation, die als bedrohlich wahrgenommen werden; so etwa Richard Buckminster Fullers Vorschlag für eine gigantische Kuppel über Manhattan (um 1960), gedacht als Schutz gegen radioaktive Bestrahlung im Falle eines Atomkrieges (Abb. 2).
Die Verbindung der Ästhetik der Atmosphären mit einem neuen Umweltbewusstsein – wo Umwelt nicht nur als betrachtet, sondern auch als eingeatmet gedacht ist – erscheint so einleuchtend, dass wir uns kaum Gedanken über ihre Anfänge machen. Indem vor allem die sinnliche Erfahrung der Atmosphären hervorgehoben wird, erscheinen diese als eine Alternative zum Verständnis der Architektur als Sprache, was noch ein allgemein akzeptierter Grundsatz in den Architekturdiskussionen der sogenannten Postmoderne war.
Meteorologische Aspekte als neue Paradigmen der Architektur
In Statements von jungen Architekturschaffenden finden wir heute denn auch radikalere Forderungen nach einer nicht semantisch aufgeladenen Architektur. Philippe Rahm stellt in seinem Manifest «Meteorological Architecture» fest: «The tools of architecture must become invisible and light, producing places like free, open landscapes, a new geography, different kinds of meteorology; renewing the idea of form and use between sensation and phenomenon, between the neurological and the meteorological, between the physiological and the atmospheric. These become spaces with no meaning, no narrative; interpretable spaces in which margins disappear, structures dissolve, and limits vanish. It is no longer a case of building images and functions, but of opening climates and interpretations; working on space, on the air and its movements, on the phenomena of conduction, perspiration, convection as transitory, and fluctuating meteorological conditions that become the new paradigms of contemporary architecture.»[2]
Philippe Rahm provoziert, indem er Architektur zur Meteorologie erklärt. Er will, dass wir die Defizite unserer obsessiven Suche nach Bedeutung zeigen, wenn diese Suche nur in der Sphäre des visuell Wahrnehmbaren geführt wird. Zugleich macht er auf Manipulierbarkeit des Körpers und der Wahrnehmung durch unsichtbare Ingredienzien (Temperatur, chemische Substanzen, Hormone) aufmerksam.
Zwischen Hedonismus und Asepsis
Viele Philosophen der Aufklärung haben versucht, moralische Qualitäten des Menschen durch die Einflüsse des lokalen Klimas zu erklären. Das tropische Klima, zentral für Rahms Projekte, bedeutete damals nicht nur paradiesische Fruchtbarkeit, sondern war als Ursache eines dekadenten Hedonismus gesehen. Rahm verwendet die laboratoriumartige Atmosphäre seiner künstlichen Tropen als das Technologisch-Erhabene, als eine zweite Natur. Seine Werke legen es nahe, dass er diese Tropen als Räume konstruiert, wo die Grenzen des hedonistischen Einsatzes von Atmosphären erkenntlich werden, wo die künstliche bläuliche Dämmerung gleichzeitig Erinnerungen an den künstlichen Sonnenschein eines Solariums und die fluoreszente Beleuchtung eines Autopsiesaals hervorruft, wie in der ersten Szene von Matteo Garrones Film «Gomorrha».
Atmosphäre und Klima sind primär naturbezogene Kategorien, tragen jedoch andere, soziale und kulturelle Bedeutungen. Deshalb scheint die Ästhetik der Atmosphären dazu geeignet zu sein, den Boden für einen verantwortungsvolleren Einsatz von Ressourcen vorzubereiten. Dies ist keinesfalls mit der Inszenierung eines angenehmen Wellness-Ambiente gleichzusetzen, sondern verlangt nach einem Verständnis der Atmosphären als eine Kondition der Unvorhersagbarkeit und des Experimentierens, als Aufforderung, mit den Konditionen unseres Lebens zu experimentieren, anstatt alles von den Architekten und Ingenieuren zu erwarten, ohne etwas an unserer Lebensweise zu ändern. Die diffuse Leere («blur») im Kern dieser Werke sollte die Gesellschaft auffordern, den modernen ökonomischen Steigerungsimperativ durch neue Modelle zu ersetzen und nicht auf rein technische Lösungen zu warten, die uns immer dickere Dämmschichten, effizientere Motoren und nebenbei kunstvolle atmosphärische Inszenierungen schenkt.
[ Prof. Dr. Ákos Moravánszky, Titularprofessor für Architekturtheorie an der ETHZ ]TEC21, Fr., 2010.10.15
Anmerkungen:
[1] Peter Sloterdijk, Sphären (Frankfurt am Main: Suhrkamp, Bd. I. 1998, Bd. II. 1999, Bd. III. 2004), und ders., Luftbeben (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002)
[2] Philippe Rahm, Meteorological Architecture, manuscript
15. Oktober 2010 Ákos Moravánszky