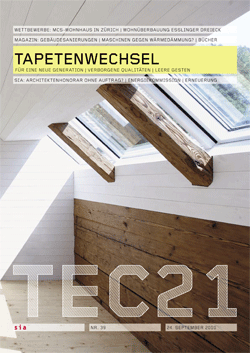Editorial
Dieses Heft ist den Interieurs gewidmet: Innenräumen, die aus den Bedürfnissen und dem Zeitgeist der jüngeren und älteren Vergangen-heit heraus entstanden sind; Interieurs, die Geschichten erzählen, aber in der Regel eine weit kürzere Lebensdauer besitzen als die um-gebende Architektur.
Was also passiert, wenn es neue Anforderungen an die Räume gibt, wenn ein Tapetenwechsel nötig wird? Welche Elemente bleiben, was wird neuen Bedürfnissen angepasst, was komplett entfernt?
Die gezeigten Beispiele spannen den Bogen über die Regionen vom ländlichen Gebiet im Kanton Uri über die Stadt Zürich bis zur Mega-city Los Angeles und analog dazu vom privaten über den halböffentlichen bis zum öffentlichen Raum. Die Methoden beim Umbau sind dabei oft die gleichen: Strukturen werden übernommen, Überflüssiges wird entfernt, einzelne Objekte, die vielleicht wertvoll, aber momen-tan nicht passend sind, werden mit dem Verweis auf eine allfällige spätere Nutzung aus dem Kontext gerissen und eingelagert. Variierend ist dabei lediglich die Eingrifftiefe, die Radikalität der Anwendung.
Den Anfang macht ein Bürger-Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert, dessen Status als denkmalgeschütztes Objekt lange einer zeitge-mässen Nutzung entgegenstand. Ein Umdenken bei der Denkmalpflege, aber auch das Entgegenkommen der Bewohnerinnen und Be-wohner sorgten dafür, dass der Bau heute mit seinen Qualitäten, seinen Ecken und Kanten ganz selbstverständlich als Wohnhaus für zwei Familien dient («Für eine neue Generation», S. 22ff.). Weniger sanft, aber ebenso sorgfältig gingen die Architekten die Sanierung des Altersheims Wildbach in Zürich an. Die Raumstruktur aus den 1970er-Jahren und die architektonisch, konstruktiv und bauphysikalisch besondere Verbindung von mehrstöckigem Parkhaus und Altersheim forderten ein beherzteres Eingreifen. Das Ergebnis: lichtdurchflutete, abwechslungsreich, aber stimmig materialisierte Interieurs, die den Bewohnerinnen und Bewohnern spannende Räume im besten Sinne bieten («Verborgene Qualitäten», S. 26ff.). Im Gegensatz dazu steht das «Hotel Ambassador» in Los Angeles – neben mehreren Oscar-Verleihungen in den 1930er-Jahren auch der Schauplatz des Attentats auf Robert F. Kennedy. Hier war die Bewahrung der Geschichte zwar ein Thema, die Zerstörung der historisch wertvollen Räume wurde aber von der Bauherrschaft zugunsten eines -Neubaus in Kauf genommen. Kompensationszahlungen und «kreative» Nachbildungen der Innenräume im Neubau sollen diesen Verlust ausgleichen («Leere Gesten», S. 31ff.). Tina Cieslik
Inhalt
05 WETTBEWERBE
MCS-Wohnhaus in Zürich | Wohnüberbauung Esslinger Dreieck
10 PERSÖNLICH
Yvonne Farrell: «Wir suchen das symbolische Element» | Hans Grob 1917–2010
12 MAGAZIN
Sanierung mit Fingerspitzengefühl | Sanfte Sanierung eines Zeitzeugen | Maschinen gegen Wärmedämmung? | Bücher: «Fotografie als Katalysator» und «Querdenker»
22 FÜR EINE NEUE GENERATION
Tina Cieslik Aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt das Haus Balmermatte in Bürglen im Kanton Uri. In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege wurde es zum modernen Zweifamilienhaus umgebaut.
26 VERBORGENE QUALITÄTEN
Jutta Glanzmann Gut Das 1972 erbaute Altersheim Wildbach in Zürich besitzt eine kuriose Typologie: Das Heim ist auf und um ein Parkhaus gebaut. Die Innenräume wurden vor kurzem aufwendig saniert.
31 LEERE GESTEN
Lilian Pfaff Während der Roaring Twenties galt das «Hotel Ambassador» in Los Angeles als Treffpunkt der Hollywoodstars, 1968 wurde hier Robert F. Kennedy erschossen.Knapp vierzig Jahre später musste der Bau einer Schule weichen. Replikate sollen an die Geschichte des Ortes erinnern.
37 SIA
Architektenhonorar ohne Auftrag? | 1. Sitzung der Energiekommission | Wahlen in Kommissionen | Kompetenz in Erneuerung | Raument-wicklung über die Grenzen
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Verborgene Qualitäten
Mit Sorgfalt und Gespür haben Gäumann Lüdi von der Ropp Architekten in Zürich das städtische Altersheim Wildbach umgebaut. Der Bau von 1972 ist ein seltsamer Gebäudehybrid: Das Altersheim ist um und auf ein mehrstöckiges Parkhaus gebaut. Betriebswirtschaftliche Überlegungen führten zur Erweiterung, zudem wies der Bau neben betrieblichen auch bauliche Mängel auf. Ein wichtiger Teil des Eingriffs besteht in den mit unterschiedlichen Materialien erzeugten Raumwirkungen, die sich trotz Eigenständigkeit zu einem Ganzen fügen.
Das städtische Altersheim Wildbach im Zürcher Seefeld ist ein Kuriosum, sowohl was seine Lage im Quartier betrifft als auch in Bezug auf sein Innenleben. Der sechsgeschossige rechteckige Bau, der nicht nur Altersheim, sondern auch Parkhaus ist, wirkt unter den mehrheitlich dreigeschossigen Wohnhäusern aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert irgendwie fremd. Im Gebäude, dessen Äusseres stark durch die vorgelagerte Balkonschicht strukturiert wird, legen sich in den ersten vier Geschossen die Räume L-fömig um die drei oberirdischen Parkgeschosse, die sich gegen die Inselhofstrasse mit einer geschlossenen Betonfassade zeigen. Das Haus als Wohnmaschine ist ein Kind seiner Zeit: Anfang der 1970er-Jahre von Architekt André E. Bosshard entworfen, verfolgt der Bau einen funktionalistischen Ansatz. In der konstruktiven Detailausbildung aber ist er alles andere als funktional. Für die Verschränkung der drei sehr ungleichen Teile Parkhaus, Alterswohnungen und Dachgeschosse mit Innenhof und Saal waren aufwendige Statik- und Techniklösungen notwendig. Eine Tatsache, mit der sich das Zürcher Architekturbüro Gäumann Lüdi von der Ropp konfrontiert sah, nachdem es den Wettbewerb für den Umbau des Hauses 2005 gewonnen hatte.
Mit dem Einbezug der in den drei unteren Stockwerken liegenden Seniorenwohnungen ins Altersheim, das seit den 1980er-Jahren in den beiden obersten Geschossen bestand, sollte die Einrichtung aufgrund der grossen Nachfrage erweitert und mit 56 Ein- und 15 Zweizimmerappartements gleichzeitig eine betriebswirtschaftliche Grösse erreichen, um wieder rentabel betrieben werden zu können. Gefragt war eine Lösung, die trotz begrenzten Mitteln das Haus zu einer Einheit werden lässt. Mit unterschiedlich tiefen Eingriffen in den Bestand an verschiedenen Orten im Gebäude ist das Gäumann Lüdi von der Ropp trotz schwieriger Ausgangslage gut gelungen. Während der neue Eingangsbereich und die Anbindung ans Quartier mit der öffentlich zugänglichen Cafeteria und dem zugehörigen Aussenbereich sofort ins Auge fällt, ist das neu gebaute Kernstück der beiden obersten Geschosse von aussen nicht sichtbar. Für die notwendigen Anpassungen in den drei dazwischen liegenden Geschossen und dem neu gestalteten vertikalen Erschliessungsbereich mit einem zweiten Aufzug suchten die Architekten nach kostengünstigen Lösungen, die räumlich trotzdem eine grosse Wirkung entfalten.
Der Bestand als Ausgangspunkt für Neues
Die neue Adresse des Hauses ist ein Pavillon, der dem eigentlichen Volumen vorgelagert ist. Die Betonstützen erinnern in ihrer Form an Äste und bringen ein neues Element in das streng geometrische, durch die Balkone regelmässig rhythmisierte Äussere des Gebäudes. Da sie ebenfalls in Sichtbeton realisiert sind, entsteht aber auch eine Verwandtschaft zwischen alt und neu. Gleichzeitig schafft der Baukörper Klarheit zwischen der Garageneinfahrt und dem Besuchereingang und gliedert den davor liegenden kleinen Park. An die Lobby, die sich im neuen Pavillon befindet, schliesst die neu geschaffene Cafeteria an – ein Begegnungsort, der sich bewusst auch nach aussen und zum Quartier orientiert. Die Öffnung derkleinteiligen Räume, die sich vorher hier befanden, machten Unterzüge und Stützen notwendig, welche den Raum heute in Nischen gliedern. Die Architekten haben diese mit rubinroten Tapeten ausgekleidet, auf denen sich durch die mittig platzierten Wandleuchten ein schönes Lichtspiel ergibt. Entstanden ist ein Raum mit hoher Aufenthaltsqualität. Bereits heute sind die Plätze in der Cafeteria sehr beliebt, um am Kommen und Gehen im Haus teilzuhaben.
Für Lobby und Cafeteria wählten die Architekten Materialien und eine Formensprache, die an ein Hotel erinnert. Damit wird den Räumen eine gewisse, durchaus beabsichtigte Weltoffenheit und Eleganz verliehen. So ist der Handlauf, der vom Erdgeschoss ins erste Stockwerk führt, aus dunkler, kerngeräucherter Eiche gefertigt, die angenehm in der Hand liegt. Als Bodenbelag wählten die Architekten einen fein gezeichneten, hellen Kalkstein, der im überhohen Raum der Lobby gut zur Geltung kommt und die Cafeteria weit und offen macht. Als verbindendes Element wurde er überall da eingesetzt, wo in die bestehende Struktur des Hauses eingegriffen wurde: im Erdgeschoss, den neu gestalteten Begegnungszonen vor dem Lift und in den beiden obersten Stockwerken.
Prunkstück auf dem Dach
In den Korridoren der Stockwerke eins bis drei, die an die Sichtbetonwand des Parkhauses grenzen und wo früher die Seniorenwohnungen lagen, ging dies aus Kostengründen nicht. Hier ersetzt das kräftige helle Blau eines gegossenen Kunststoffbodens den dunklen Teppich von damals. Die grossflächigen Wandbilder auf der Parkhauswand – von Künstler Harry Buser zwischen 1976 und 1980 geschaffen – wurden auf Wunsch der Stadt Zürich erhalten. An der Decke brechen tellerartige Elemente mit bündig eingelassenen Leuchten die stark lineare Wirkung der Korridore. Die Wohnungen selbst wurden wie die Fassade lediglich neu gestrichen. Eine Verbindung zu den beiden obersten Geschossen schaffen die Zonen vor dem Lift. Die bis zur Fassade offen gestalteten Bereiche ermöglichen den Bezug zu aussen, erleichtern damit die Orientierung und bieten gleichzeitig auch Sitzgelegenheiten. Dabeischliesst an den eigentlichen Liftvorplatz jeweils ein gemeinschaftlich nutzbarer Raum an, der von den Architekten ebenfalls neu eingerichtet wurde. Wie bereits im Erdgeschoss entsteht auch hier durch die verwendeten Materialien und die Möblierung eine den Räumen
Adäquate Atmosphäre.
Mit dem radikalen Umbau der beiden obersten Geschosse schliesslich ist es den Architekten gelungen, im Altersheim Wildbach eine ganz neue Raumwahrnehmung zu schaffen. Anstelle trostloser Räume, die nur durch Kuppellichter Bezug zum Aussenraum hatten, ist eine Welt entstanden, die von spannungsvollen Durch- und Ausblicken lebt. Der mit Zedernholz und Glas eingefasste, auf zwei Ebenen liegende Innenhof mit freiem Blick zum Himmel findet seine Fortsetzung im mehrfach nutzbaren Saal, der in der Mitte zweigeschossig wird und sich mit einem eingeschossigen Flügel zur Aussenfassade öffnet. Dunkelgrüne Tapeten, eine zeitgemässe Version eines Kronleuchters und ein mit CNC gefertigtes dekoratives Wandelement als Sichtschutz zum Korridor lassen zusammen mit der Verkleidung aus Zedernholz eine warme, fast festliche Raumstimmung entstehen. Auf Zeder fiel die Wahl aufgrund der positiven Eigenschaften des Materials: Es ist aussen und innen einsetzbar, harzt nicht und schafft ein gutes Raumklima. Im Wellnessbereich erzeugen die Architekten mit den kleinteiligen Glaskeramiksteinen in Blau-, Grün- und Brauntönen nochmals eine andere Raumstimmung. Und selbst die Grossküche überrascht mit einem eigenwilligen Farbkonzept: Die üblicherweise weissen Keramikplatten sind hier pinkfarben. Mit der Vielfalt an Raumeindrücken, die sich im Haus zu einem stimmigen Ganzen fügen, unterstützen Gäumann Lüdi von der Ropp selbstbestimmtes Wohnen im Alter, das im Rahmen einer Institution vielfältige Aktivitäten und den Rückzug in die eigenen vier Wände bietet. Sie haben für Menschen, die in der Regel über einen nur mehr begrenzten Bewegungsradius verfügen, eine Vielfalt an spannungsvollen Räumen in erreichbarer Distanz geschaffen.TEC21, Fr., 2010.09.24
24. September 2010 Jutta Glanzmann