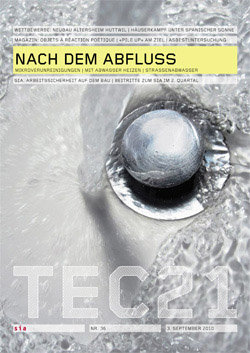Editorial
Die Schweiz hat eines der besten Abwasserreinigungssysteme weltweit. Funktionierende Kanalisationen und Kläranlagen sind selbstverständlich geworden und werden höchstens noch am Rande wahrgenommen. Kläranlagen sind darauf ausgelegt, Feststoffe, organische Substanz und Nährstoffe aus dem Abwasser zu entfernen. Mit den sogenannten «Mikroverunreinigungen» wurden in den letzten Jahren jedoch neue Problemstoffe identifiziert, die mit den jetzigen Anlagen nicht ausreichend entfernt werden. Da sie sich nachteilig auf Wasserlebewesen auswirken können, werden Verfahren zur Entfernung dieser Stoffe im Moment intensiv getestet. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) plant auch schon den nächsten Schritt und möchte die hundert grössten Kläranlagen der Schweiz mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe aufrüsten. Das Uvek hat eine entsprechene Änderung der Gewässerschutzverordnung vorgeschlagen. Die Zeit scheint günstig, denn viele Kläranlagen müssen in den nächsten Jahren sowieso erneuert werden. Der Vorschlag stiess bei der Vernehmlassung allerdings auf Kritik (vgl. «Mikroverunreinigungen reduzieren », S. 20ff.).
Ein weiteres, bis vor einigen Jahren noch weitgehend unbeachtetes Problem im Gewässerschutz ist das Strassenabwasser. Obwohl das Gewässerschutzgesetz seit 1991 vorschreibt, dass das Abwasser stark befahrener Strassen gereinigt werden muss, wird es noch bei einem Grossteil der Schweizer Autobahnen lediglich durch einen Ölabscheider geleitet, bevor es ins nächste Gewässer fliesst. Immerhin wird bei grösseren Strassenbauprojekten die Abwasserbehandlung heute von vornherein mitgeplant. Welches das geeignetste Verfahren ist, ist jedoch umstritten (vgl. «Klärungsbedarf beim Strassenabwasser», S. 27ff.).
Im Abwasser finden sich aber nicht nur Schadstoffe: Täglich verschwinden auch grosse Mengen an Wärmeenergie im Abfluss. Auch bei der Nutzung dieses bisher weitgehend vernachlässigten Potenzials ist die Schweiz international führend. Einige dieser Pionierprojekte zur Wärmenutzung des Abwassers stellen wir in diesem Heft vor (vgl. «Mit Abwasser heizen», S. 24ff.).
Um der Bevölkerung vor Augen zu führen, was mit dem Wasser geschieht, nachdem es im Abfluss verschwunden ist, soll am 21. Mai 2011 erstmals ein Schweizer Tag des Abwassers durchgeführt werden. Initiiert wurde er von der Schweizer Kampagne für die sanitäre Grundversorgung. Die einzelnen Veranstaltungen sind ersichtlich unter www.siedlungshygiene2008.ch.
Claudia Carle, Daniela Dietsche
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Neubau Altersheim Sonnegg in Huttwil | Häuserkampf unter spanischer Sonne
10 PERSÖNLICH
Patrick Gartmann: «Es wird heute zu kompliziert gebaut»
12 MAGAZIN
Objets à réaction poétique | «Pile up» am Ziel | Hülle gut, alles gut? | Asbestuntersuchung
vereinheitlichen | Garten der zweihundert Unkräuter
20 MIKROVERUNREINIGUNGEN REDUZIEREN
Christian Abegglen, Marc Böhler, Hansruedi Siegrist
Für die Reduktion von Mikroverunreinigung im Abwasser eignen sich die Ozonung oder die Adsorption an Pulveraktivkohle – ein Vergleich von Wirksamkeit, Kosten und Engergiebedarf.
24 MIT ABWASSER HEIZEN
Aldo Rota
Abwasser steckt voller Energie, die zum Heizen von Gebäuden genutzt werden kann. Die Technik ist ausgereift, dennoch wird dieses Potenzial noch wenig genutzt.
27 KLÄRUNGSBEDARF BEIM STRASSENABWASSER
Daniela Dietsche
Die Standardlösung für die Strassenabwasserbehandlung wurde noch
nicht gefunden. Unterschiedliche Systeme werden gebaut, getestet und analysiert.
31 SIA
Arbeitssicherheit auf dem Bau | Beitritte zum SIA im 2. Quartal 2010
36 WEITERBILDUNG
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Mikroverunreinigungen reduzieren
Mikroverunreinigungen im Abwasser sind eines der drängendsten Probleme im Gewässerschutz. Sie können in den Kläranlagen nicht ausreichend entfernt werden und gelangen dadurch in die Gewässer. Die Kläranlagen sollen daher mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe aufgerüstet werden. Zur Diskussion stehen die Ozonung oder die Adsorption an Pulveraktivkohle. Beide Verfahren werden derzeit in Labor- und grosstechnischen Versuchen hinsichtlich Wirksamkeit, Kosten und Energiebedarf evaluiert.
Heutige Abwasserreinigungsanlagen (ARA) sind darauf ausgerichtet, Feststoffe, organische Substanz und Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor zu entfernen. Sogenannte Mikroverunreinigungen werden aber nur ungenügend reduziert. Mikroverunreinigungen sind organische Stoffe, die in sehr tiefen Konzentrationen (Milliardstel- bis Millionstel Gramm pro Liter) in den Gewässern vorkommen. Sie stammen aus Pflanzenschutzmitteln, Körperpflegeprodukten, Reinigungsmitteln oder Medikamenten und gelangen zu einem grossen Teil über die Siedlungsentwässerung in die Gewässer, vor allem über die Ausläufe der kommunalen ARA.
In stark mit Abwasser belasteten Gewässerabschnitten können einzelne dieser Stoffe Konzentrationen erreichen, die sich nachteilig auf Gewässerlebewesen auswirken können.[1,2] So wurde beispielsweise festgestellt, dass hormonaktive Stoffe zur Verweiblichung männlicher Fische führen. Ausserdem können Mikroverunreinigungen Trinkwasserressourcen beeinträchtigen, zumal sich die schwer abbaubaren Stoffe auch im Grundwasser nachweisen lassen. Um eine ausreichende Qualität des Rohwassers für die Trinkwasserproduktion zu gewährleisten und negative ökologische Auswirkungen zu minimieren, gibt es Bestrebungen, den Eintrag von Mikroverunreinigungen aus kommunalen ARA in die Gewässer zu verringern.[3]
Teil der «Strategie Micro Poll»
Mit welchen Massnahmen das erreicht werden kann, wird im Rahmen des Projekts «Strategie MicroPoll» untersucht, das 2006 vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) gestartet wurde. Dazu gehören unter anderem technische Versuche, mit denen getestet wird, ob durch die Einführung einer zusätzlichen Reinigungsstufe in Kläranlagen Mikroverunreinigungen entfernt werden können. Die meisten ARA haben heute drei Reinigungsstufen – eine mechanische, eine biologische und eine chemische (Abb. 1). Als mögliche zusätzliche Reinigungsstufe werden die Ozonung sowie die Adsorption an Pulveraktivkohle (PAK) im Labor- und im Grossmassstab untersucht.
Die Ozonung wurde in der ARA Wüeri in Regensdorf während etwa 18 Monaten bis Oktober 2008 betrieben (vgl. TEC21 38/2007 und 37-38/2009).[4] Bis Spätsommer 2010 läuft ein zweiter grosstechnischer Versuch in der ARA Lausanne. Dort wird zudem eine grössere Pilotanlage mit einer PAK-Adsorption betrieben.[5] Zusätzlich werden am Wasserforschungsinstitut Eawag in Dübendorf verschiedene Varianten der PAK-Adsorption im Labormassstab untersucht und teilweise in grösseren ARA verifiziert.[5,6,7] In diesem Artikel werden vorwiegend Resultate der Versuche in Regensdorf (Ozonung) und an der Eawag (PAK-Adsorption) vorgestellt. Die bisherigen Resultate in Lausanne zeigen aber vergleichbare Tendenzen.
Ozonung
Ozon, das aus drei Sauerstoffatomen besteht, hat eine stark oxidierende Wirkung. Es greift viele Substanzen an und wandelt sie chemisch um. Da Ozon sehr instabil ist, muss es am Einsatzort aus getrockneter Luft oder flüssigem Sauerstoff produziert werden. Dann wird es gasförmig in den Abwasserstrom eingeblasen. Eine Ozonanlage in einer ARA besteht im Wesentlichen aus Ozonerzeugung, Kontaktreaktor, Abluftreinigung und Prozesssteuerung (Abb. 2).
Die Auswirkung der Ozonung auf die Qualität des Abwassers wurde in der ARA Regensdorf anhand von chemischen, ökotoxikologischen und biologischen Parametern untersucht. Es zeigte sich, dass durch die Ozonung sowohl die Anzahl der messbaren Mikroverunreinigungen als auch deren Konzentrationen substanziell abnahmen. So konnten vor Inbetriebnahme der Ozonungsstufe von den 50 untersuchten Stoffen 31 im Ablauf der Kläranlage nachgewiesen werden, während es nach der Inbetriebnahme nur noch 16 Substanzen waren. Die Gesamtkonzentration der gemessenen Mikroverunreinigungen sank von rund 15 g/l auf etwa 3.5 g/l. Betrachtet man einzelne Stoffgruppen, so wurden z. B. die untersuchten Östrogene komplett eliminiert. Es gibt aber auch Substanzgruppen, beispielsweise die iodierten Röntgenkontrastmittel, die kaum angegriffen werden. Insgesamt wird das gereinigte Abwasser durch die Ozonung aber wesentlich von Mikroverunreinigungen befreit.
Unerwünschte Reaktionsprodukte?
Ein Problem der Ozonung ist, dass sie die angegriffenen Substanzen nicht komplett eliminiert, sondern sie lediglich in grösstenteils unbekannte Reaktionsprodukte umwandelt. Man wollte daher wissen, ob diese Produkte weniger schädlich sind als die Ausgangsstoffe. Dafür wurden die wenigen bekannten, unerwünschten Umwandlungsprodukte mittels chemischer Analytik untersucht. Man stellte fest, dass ihre Konzentrationen im Auslauf der Ozonung deutlich unterhalb von Richtwerten für Trinkwasser lagen.
Ergänzend wurden ökotoxikologische Tests durchgeführt, um zu untersuchen, ob durch die Ozonung die toxischen Effekte auf Organismen reduziert werden oder ob das Abwasser nach der Behandlung «schädlicher» ist.4 Viele ökotoxikologisch relevante Effekte (zum Beispiel Hormonaktivität) wurden deutlich reduziert. Bei zwei dieser Tests wurde aber direkt nach der Ozonung eine Verschlechterung gegenuüber dem biologisch gereinigten Abwasser beobachtet. Dies ist vermutlich auf die Bildung von labilen Reaktionsprodukten zurückzuführen. Nach dem Durchlaufen des nachgeschalteten Sandfilters waren diese negativen Effekte jedoch verschwunden. Um den Eintrag solcher Reaktionsprodukte in die Gewässer zu vermeiden, wird empfohlen, der Ozonung eine weitere Stufe (etwa Sandfilter) nachzuschalten, wo sie biologisch abgebaut werden können (Abb. 2).
Mit dem grosstechnischen Versuch in Regensdorf konnte gezeigt werden, dass eine Ozonung mit relativ geringem Aufwand in eine bestehende Anlage integriert werden kann. Eine Herausforderung war die Steuerung der Ozondosierung. Wird zu wenig Ozon dosiert, ist die Elimination der Mikroverunreinigungen ungenügend. Wird zu viel dosiert, steigen einerseits die Kosten für den Betrieb, andererseits wird Ozon aus dem Reaktor ausgetragen, was sich negativ auf den vor allem aus Bakterien bestehenden Biofilm im Sandfilter auswirkt. Mit zunehmender Erfahrung werden hier aber noch wesentliche Optimierungen möglich sein. Da Ozon ein stark reizendes Gas ist, sind beim Einsatz einer Ozonungsanlage entsprechende Sicherheitsvorkehrungen (Abdichtungen, Gasdetektoren, Alarmsysteme) zu treffen, um das Personal zu schützen.
Adsorption an Pulveraktivkohle
Die zweite untersuchte Option für die Entfernung von Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser ist die Adsorption an Pulveraktivkohle. Adsorption bezeichnet die Bindung von Stoffen an der Oberfläche von Feststoffen. Die Stoffe werden dabei chemisch nicht verändert, sodass im Gegensatz zur Ozonung keine Abbauprodukte entstehen. Wie effizient Aktivkohle die Mikroverunreinigungen entfernt, hängt wesentlich davon ab, an welcher Stelle in der Kläranlage sie zugegeben wird. Eine Schwierigkeit bei allen Methoden ist, die zugegebene Aktivkohle wieder vom Wasser zu trennen, bevor dieses in ein Gewässer eingeleitet wird.
Die einfachste Möglichkeit, die an der Eawag untersucht wird, ist die Zugabe der Aktivkohle in die biologische Reinigungsstufe (Abb. 3a) und die anschliessende Entfernung zusammen mit dem Belebtschlamm im Nachklärbecken. Da aber in der biologischen Reinigungsstufe die Konzentration an organischem Kohlenstoff (DOC), der die Adsorption der ebenfalls organischen Mikroverunreinigungen konkurrenziert, hoch ist, ist dieses Verfahren wenig effizient und braucht grosse PAK-Mengen. Dafür sind die Investitionskosten tief, da die bestehenden ARA nur geringfügig umgebaut werden müssen.
Favorisiert wird derzeit die Zugabe von Aktivkohle in den Ablauf der Nachklärung, da hier die Konzentration des DOC geringer ist. Das Abwasser wird dabei nach Verlassen der biologischen Reinigungsstufe und des Nachklärbeckens in einen separaten Adsorptionsreaktor geleitet, wo die PAK zugegeben wird. Anschliessend wird die PAK mittels Sedimentation oder Membranfiltration (Abb. 3b) abgetrennt. Diese Verfahren werden an der Eawag (Sedimentation) und in Lausanne (Membran) getestet. Im Fall der Sedimentation ist zusätzlich eine nachgeschaltete Filtration notwendig, da der Feinanteil der PAK schlecht sedimentiert.
Eine Möglichkeit, die Effizienz dieses Adsorptionsprozesses zu verbessern, ist, die Kohle im Kreis zu führen. Bei zweistufigen Verfahren wird daher die vom Abwasser abgetrennte Aktivkohle, die dann schon teilweise mit Mikroverunreinigungen «beladen» ist, nochmals in die biologische Stufe zurückgeführt. Weil dort der Gehalt an Mikroverunreinigungen noch höher ist, kann die Aktivkohle noch mehr adsorbieren. Ein Nachteil des Verfahrens mit separatem Adsorptionsreaktor ist der höhere Platzbedarf.
Die Ergebnisse einer Pilotanlage der Eawag zur Elimination von Mikroverunreinigungen durch PAK zeigen, dass diese viele Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser eliminieren. Eine Rückführung der PAK in die biologische Stufe erscheint vorteilhaft, da für einige Stoffe, deren Elimination bei einer einstufigen Behandlung vergleichsweise gering ist (z. B. Röntgenkontrastmittel), eine deutlich verbesserte Reduktion erzielt wird.
Vergleich der Verfahren
Die Qualität des gereinigten Abwassers verbessert sich mit beiden Verfahren deutlich, die Reinigungsleistung kann sich für einzelne Substanzen aber deutlich unterscheiden. Der Einsatz von PAK bewirkt eine zusätzliche Elimination des organischen Kohlenstoffs, während Ozon dank seiner desinfizierenden Wirkung die Keimzahl reduziert. Bezüglich der Kosten schneiden beide Verfahren ähnlich ab. Für grössere Anlagen belaufen sich die Mehrkosten (ohne Filtration) auf ca. 10 Rp./m3 Abwasser (das entspricht rund 10 Fr. pro Einwohner und Jahr), bei kleineren Anlagen sind es 15 – 25 Rp./m3 Abwasser. Ist noch kein Sandfilter vorhanden, ist mit weiteren 5 –15 Rp./m3 zu rechnen.
Anders sieht es beim Energieverbrauch aus: Ozon wird vor Ort in einem energieintensiven Prozess hergestellt, d.h. der grösste Teil des Energieverbrauchs fällt in der ARA selbst an. Damit wird sich der Stromverbrauch im Durchschnitt schätzungsweise um ca. 20 % (ca. 0.06 kWh/m3 Abwasser; mit Filtration: ca. 30% oder 0.1 kWh/m3) erhöhen. Gemäss einer Hochrechnung wird sich dadurch der Stromverbrauch der Abwasserreinigung in der Schweiz bei einer Ausrüstung von rund 100 grösseren ARA mit einer Ozonungsstufe (inkl. Filtration und Sauerstoffproduktion) von derzeit rund 400 GWh/a um 25 % auf etwa 500 GWh/a erhöhen. 100 GWh entsprechen etwa 0.15 % des Schweizer Stromverbrauchs.
Eine PAK-Stufe erhöht den Energieverbrauch der ARA nur unwesentlich. Die Herstellung der PAK ist jedoch sehr energieintensiv. Der Primärenergiebedarf für die PAK-Produktion liegt daher um einen Faktor 1.5 bis 3 höher als derjenige für die Ozonung.
Mit der PAK-Adsorption und der Ozonung stehen zwei Verfahren zur Verfügung, die organische Spurenstoffe in ARA weitgehend eliminieren können. Welches Verfahren für welche ARA geeignet ist, muss im Einzelfall geklärt werden (Platz, Abwasserzusammensetzung etc.). Aufgrund der Erfahrungen im In- und Ausland sind grundsätzlich beide Verfahren reif für die grosstechnische Anwendung, obwohl noch nicht restlos alle Fragen geklärt sind.
Forschungsbedarf gibt es vor allem im Bereich Materialwahl und Steuerung / Regelung, bei der PAK zusätzlich bei der Abtrennung und Schlammbehandlung. Andere Verfahren, die eine ähnliche Breitbandwirkung bezüglich der Elimination von Spurenstoffen zeigen und deren Kosten und Energieverbrauch in einem vertretbaren Rahmen sind, sind derzeit nicht in Sicht.
An den Projekten in Regensdorf sowie an der Eawag war eine Vielzahl von Forschenden, Behördenvertretern und Ingenieuren beteiligt. Die Autoren danken allen herzlich für ihren grossen Einsatz. Die Studien wurden vorwiegend vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) sowie vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) des Kantons Zürich finanziert.
Der Text ist eine gekürzte und überarbeitete Version eines Artikels, der in der Zeitschrift «gwa» Nr. 7/2010 erschienen ist.
Anmerkungen:
[01) R. Gälli, C. Ort und M. Schärer: «Mikroverunreinigungen in den Gewässern – Bewertung und Reduktion der Schadstoffbelastung aus der Siedlungsentwässerung », in: Umwelt-Wissen Nr. 17/09. Bundesamt für Umwelt, Bern, 2008, S. 103
[02] C. Götz, R. Kase, C. Kienle, J. Hollender: «Beurteilung von Mikroverunreinigungen aus kommunalem Abwasser», in: Gas Wasser Abwasser 7/2010, Zürich, 2010
[03] Bafu (Hrsg.): Eintrag von organischen Spurenstoffen – Erläuternder Bericht zur Änderung der Gewässerschutzverordnung. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation – Bundesamt für Umwelt. 18.11.2009
[04] C. Abegglen et al.: «Ozonung von gereinigtem Abwasser», in: Schlussbericht Pilotversuch Regensdorf, Publikation zum Projekt «Strategie MicroPoll». Eawag, Dübendorf, 2009
[05] Die Pilotversuche in Lausanne und an der Eawag werden im Sommer/Herbst 2010 abgeschlossen. Ende 2010 liegt der Schlussbericht mit den detaillierten Resultaten aus den Versuchen in Lausanne vor. Der aktuelle Kenntnisstand zu den Verfahren zur Entfernung von Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser wie auch die Resultate und Schlussfolgerungen aller Micropoll-Versuche werden voraussichtlich Anfang 2011 in einer Bafu-Publikation veröffentlicht
[06] M. Böhler et al.: «Aktivkohledosierung in den Zulauf zur Sandfiltration Kläranlage Kloten/Opfikon», in: Eawag Zwischenbericht, Dübendorf, 2009
[07] B. Zwickenpflug und M. Böhler: «Einsatz von Pulveraktivkohle zur Elimination von Mikroverunreinigungen aus dem kommunalem Abwasser», in: 3. Zwischenbericht, Studie Eawag im Auftrag des Bafu. Dübendorf, 2009, www.eawag.ch/organisa tion/abteilungen/eng/schwerpunkte/abwasser/ strategie_micropoll/pak_eawag/index (10.5.2010) 03 a 03 bTEC21, Fr., 2010.09.03
03. September 2010 Christian Abegglen, Marc Böhler