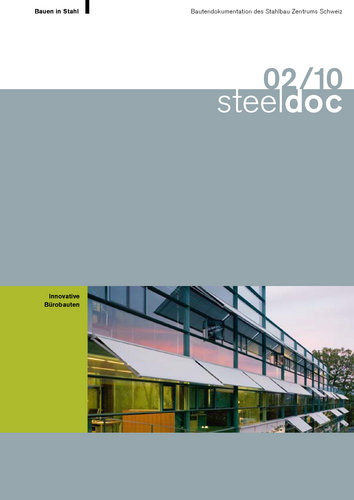Editorial
Ein Firmensitz ist ein gebauter Imageträger. Wo bisher Design und Stil gepflegt wurden, zählt heute vor allem der Innovationscharakter. Öffentliche Bauherren haben sich das nachhaltige Bauen schon seit einigen Jahren auf die Fahne geschrieben. Nun ziehen private Unternehmen mit – und investieren Kapital in Technologien und Baukonzepte für den energiereduzierten Betrieb. Das Wohlbefinden des Mitarbeiters und des Kunden steht im Vordergrund. Dazu gehören luft- und lichtdurchflutete Lobbies, Konferenzbereiche und Büros, Grünzonen, individuell regulierbare Klimasysteme und das Nutzen von Energie aus Sonne, Erde, Wasser und dem Betrieb. Prunk ist out. «Weniger ist mehr» ist die Devise der neuen Wirtschaft – weniger Material und Energie für mehr Komfort und Umweltverantwortung.
Das vorliegende Steeldoc thematisiert den innovativen Bürobau. Den Anfang macht der grösste österreichische Stahlproduzent Voestalpine, der in Linz einen höchst expressiven Verwaltungsbau errichtet hat. Gleichzeitig nutzt das Gebäude die Abwärme der Stahlproduktion für die Klimatisierung der gesamten Überbauung. Die holländischen Architekten Cepezed sind Minimalisten des Materials und Virtuosen des Leichtbaus. Wo früher ein muffiger Büroturm aus den 70er Jahren stand, erstreckt sich heute eine lichte und luftige Bürowelt für mehr als 2000 Mitarbeiter. Der neue Gebäudekomplex wurde kostengünstig mit industriell vorgefertigten Bauelementen erstellt und braucht ein Minimum an Energie.
Der neue Firmensitz des Luxuskonzerns Richemont am Lac Léman schreibt sich in den umgebenden Garten ein, als sei das Gebäude Teil eines Ganzen. Natur und Raum sind zu einem facettenreichen Ensemble gefügt, das die Grenzen dazwischen verschwimmen lässt.
Die Ergänzung oder Aufstockung bestehender Bausubstanz gewinnt in urbanen Räumen immer mehr an Bedeutung. Auf der Spur einer ausgedienten Krahnbahn einer Werft bei Amsterdam sitzt eine 270 Meter lange Box aus Stahl und Glas. Der respektvolle Abstand zur alten Betonfahrbahn zeigt, wie einfach es ist, Neu und Alt sinnvoll zu verbinden – und dabei attraktiven Raum zu gewinnen. Der neue Geschäftssitz des Pharmakonzerns Merck Serono in Genf bewegt sich in denkmalgeschützter Bausubstanz und ist ein Manifest für nachhaltiges Bauen. Dank Spitzentechnologie wurden anregende Arbeitsplätze und Erholungsräume geschaffen, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Der Stahlbau entspricht den Forderungen des nachhaltigen Bauens in hohem Masse. Grosse Spannweiten, schlanke Deckensysteme, geringes Gewicht und die Flexibilität der Bauweise sind Vorteile sowohl ökologischer wie wirtschaftlicher Art.
Neue Energiekonzepte nutzen die Wärmeleitfähigkeit des Stahls zur raschen Kühlung und Beheizung von Räumen. Steeldoc zeigt wie immer die Details der Konstruktion und beschreibt die konzeptuellen Ideen dahinter. Wir wünschen viel Anregung bei der Lektüre und dem Studium der nachfolgenden Seiten.
Inhalt
03 Editorial
04 Verkaufs- und Finanzzentrale Voestalpine Stahl, Linz
Sanfter Stahlriese
10 Bürokomplex Westraven, Utrecht
Die Verwandlung
14 Firmensitz Richemont International, Genf
Ein Spiegel der Natur
20 Bürogebäude Kraanspoor, Amsterdam
Kühle Box auf der Kranbahn
24 Zentrale Merck Serono, Genf
Klimaneutrale Arbeitsoase
31 Impressum
Ein Spiegel der Natur
(SUBTITLE) Firmensitz Richemont International, Genf
Der neue Firmensitz von Richemont schreibt sich in den umgebenden Garten ein, als sei das Gebäude Teil eines Ganzen. Farbe, Licht, Spiegelung, Transparenz und Schattenspiel – Natur und Raum sind zu einem facettenreichen Ensemble gefügt, das die Grenzen dazwischen verschwimmen lässt.
Tatami ist das japanische Einheitsmass, das dem einer Schlafmatte entspricht. Aus dem Vielfachen dieses Moduls ist das japanische Haus zusammengesetzt. Es spiegelt damit die Natur – denn auch die Natur ist eingeschrieben in die Gesetze des Kosmos: das Kleine ist das Grosse. Ob der Architekt Jean Nouvel diesem Prinzip zu entsprechen versuchte, ist Spekulation. Der Architekt gibt zu, vom Ort mit den Jahrhunderte alten Zedern und den leichtblättrigen Laubbäumen in den Bann gezogen worden zu sein: die Stille, das Zeitlose, das leicht abfallende grüne Terrain, im Blick der Genfersee und zwischen dem alten Baumbestand die historischen Holzhäuser, denen der Neubau Nachbar werden soll. Wie bauen, um diesem magischen Ort die Seele nicht zu rauben?
Der weltweit tätige Konzern Richemont investiert vor allem in Luxusgüter sowie in Gold- und Diamantenminen. Für seinen europäischem Standort im Nobelvorort Bellevue bei Genf erwarb das Unternehmen einen privaten Park mit insgesamt acht denkmalgeschützten Holzhäusern aus dem Jahr 1869. Diese Häuser sollten mit diversen Nutzungen ausgestattet werden, wobei für den eigentlichen Hauptsitz ein Neubau im Park vorgesehen war. Entstanden ist eine leichte, hochtransparente und vielschichtige Architektur, die sich ihrer Umgebung vollständig hingibt. Die Entmaterialisierung wird durch das Spiel von Reflektion, halbtransparenten und mit Pflanzen und Schattenmotiven bedruckten Gläsern, Durch- und Einblicken zelebriert. Es entsteht ein Gefl echt aus Raum, Ausblicken und Naturschauspiel. Die Räume werden je nach Funktion mit Gläsern unterschiedlicher Durchsichtigkeit und Beschaffenheit begrenzt.
Modulares Stahlgitter
Insgesamt wurden drei Neubauten aus Stahl realisiert – zwei kubische Volumen sowie ein langgestreckter, abgestufter Baukörper. Das Längsgebäude setzt sich aus zwei parallelen Raumschichten zusammen, die durch eine mittlere Schicht aus Licht- und Grünräumen verbunden sind. Dem abfallenden Terrain folgt die Geometrie der Bauvolumen durch die Abstufung einzelner Geschosshöhen, so dass sich drei Teilvolumen abzeichnen.
Das feingliedrige Stahlgitter folgt einem streng modularen Raster. Ein Betonkern für die Treppenanlagen steift das Stahlskelett aus, so dass keine Windverbände notwendig sind. Um den kleinstmöglichen Querschnitt der Stützen im Fassadenbereich zu erreichen, wurde ein Vollstahlprofi l gewählt. Damit haben die tragenden Vertikalstützen dieselbe Abmessung wie die Fassadenrahmen, nämlich acht Zentimeter. Die Stützen sind mit einer Thermobeschichtung behandelt und brandsicher dimensioniert.
Die Geschossdecken bestehen aus Walzprofilen mit breitem Flansch und einer Verbunddecke aus Holoribblech mit Betonüberguss von 16 Zentimetern. Der Deckenverbund zwischen Blech und Beton wird entweder durch runde Kopfbolzen oder durch Warzenblech geschaffen.
Die Dachstruktur über dem langgestreckten Innenhof des Hauptgebäudes ist aus geschweissten Rechteck-Hohlprofilen gefertigt, um die Verbindungen der Konstruktion möglichst unsichtbar zu halten. Während die Vollstahlstützen ohne Behandlung einen Feuerwiderstand von 30 Minuten aufweisen, mussten die Deckenträger mit einem dämmschichtbildenden Brandschutzanstrich versehen werden.
Brückenlabyrinth
In der Zwischenzone des Gebäudes verbindet ein Brückensystem die beiden Raumschichten auf zwei Ebenen. Die Passerellen sind aus Stahlblech gefertigt, das mit Längs- und Querrippen versteift ist. Je nach Nutzung sind die Passerellen zwischen 90 und 130 Zentimeter breit und haben bis zu 5,60 Meter Spannweite. Die Plattformen bestehen aus zwei übereinanderliegenden orthotropen Platten, die verschraubt sind. Die Geländer bestehen nur aus einer fugenlosen Glasscheibe. Sämtliche Brückenteile sind mit einer Brandschutzbeschichtung für 30 Minuten Widerstand geschützt.
Die beiden kubischen Neubauten, welche sich im nördlichen Teil des Parks befi nden, nehmen den Dialog mit dem Hauptgebäude auf und sind im selben Prinzip gebaut. Die bestehenden Holzhäuser dienten den Architekten als Anschauungsmaterial und Inspiration für die Materialwahl und Detailgestaltung. Im Untergrund verbinden eine Parkgarage und diverse Zugänge die Gebäude untereinander.Steeldoc, Mo., 2010.07.19
19. Juli 2010 Evelyn C. Frisch, Johannes Herold
Klimaneutrale Arbeitsoase
(SUBTITLE) Zentrale Merck Serono, Genf
Der neue Geschäftssitz des Pharmakonzerns Merck Serono ist ein Manifest für optimale Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Bauen. Dank Spitzentechnologie und Konzepten für mehr Life-Balance wurden anregende Arbeitsplätze und Erholungsräume geschaffen, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen.
Der Bauplatz ist komplex: Nahe am Gleisfeld des Genfer Stadtbahnhofs ist das historische Industrieareal seit den 50er Jahren zu einem blockartigen, städtischen Gebilde herangewachsen. Etliche Gebäude stehen unter Denkmalschutz und sollten in das neue Gesamtkonzept integriert werden. Das Pharma-Unternehmen Merck Serono übernahm das ehemalige Areal der Firma Sécheron SA und baute es zu einem «Campus» um, der alte und neue Bausubstanz in ein städtisches Gesamtwerk integriert. Zwischen den Bauten für Forschung und Verwaltung sind gedeckte und offene Gemeinschaftszonen angeordnet. Eine Hauptachse, die «Mainstreet», wird zum zentralen Element, das den Campus an den öffentlichen Raum anbindet.
Die amerikanischen Architekten Murphy/Jahn nutzten das Image des Konzerns in der Spitzenforschung, um innovative Technologie für ein nachhaltiges Klimakonzept einzusetzen. Tageslicht, natürliche Belüftung, passive Solarenergie und die Idee, dass ein Gebäude sich selbst reguliert, standen bei der Planung im Vordergrund, statt wie üblich «just design and style». Die natürlichen Ressourcen werden maximal genutzt, wobei sich die technischen Installationen sinnvoll ergänzen, sowohl beim Heizen, als auch bei beim Kühlen. Dies führt zu einem Hightech-Gebäude, das jedoch ein Minimum an Energie verbraucht.
Stadt in der Stadt
Der bestehende Gebäudekomplex wurde im Zuge einer Sanierung vollständig entkernt und mit dem Neubau ergänzt, der mit Ausnahme der letzten Etage und der Dachkonstruktion in Massivbauweise ausgeführt ist. Dominiert wird das Stadtgeviert von einem mäandernden Neubau, der sich in mehreren Stufen durch die Freiräume der Parzelle bewegt. Er überragt die bestehenden Gebäude um drei bis vier Geschosse und hüllt sich in eine mannigfach reflektierende gläserne Haut, so dass die Orientierung zum Hauptbau hin auf dem ganzen Areal gewährleistet ist.
In den Zwischenräumen liegen weit gespannte Passerellen sowie Treppen- und Liftanlagen in Stahl. Die Dachkonstruktion dient auch als Aufhängevorrichtung für die Stahl- und Metallfassaden des Gebäudes. Die durchlässige Hülle ist ein wichtiger Teil des Klimakonzeptes. Um die Fassaden noch transparenter erscheinen zu lassen, sind schräge Glaselemente aus extraweissem Glas mit einer Überlappung von einem Meter wie Schindeln übereinander geschichtet. Sie verbergen die Lüftungsöffnungen, die sich dezentral bedienen lassen und sichern damit die Zuluft. Der Sonnenschutz liegt aussen. In den Büros weisen die Decken eine Betonkernaktivierung auf, die Doppelböden integrieren die Installation der Gebäudetechnik und dienen überdies zur Quelllüftung. In Verbindung mit Wärmetauschern und Wärmepumpen sowie Kühlaggregaten wird das Seewasser zum Heizen und Kühlen genutzt.
Markantes Segel
Das Kernstück der Anlage bildet das Forum – ein 25 Meter hoher Glasbau in Form eines Viertelkreises, dessen fächerförmiges Dach sich hydraulisch öffnen lässt. Es handelt sich hier um das weltweit grösste zu öffnende Glasdach. Das 1000 Quadratmeter grosse Forumdach ebenso wie die 12 Meter hohen, acht Meter breiten, drehbaren Glastore und der aussenliegende Sonnenschutz sind wichtige Bestandteile des Klimakonzeptes des Gebäudes. Die maximale Öffnungshöhe des Daches beträgt 4,7 Meter. Die Primärstruktur des Daches liegt im Freien – das Isolierglas ist davon mit einem Abstand von 25 Zentimeter abgehängt. Die Hauptträger bilden eine Reihe radial angeordneter Hohlkastenträger, die bei geöffnetem Dach bis zu 26 Meter frei auskragen. Je nach Beanspruchung sind sie zwischen 140 und 50 Zentimeter hoch und haben unterschiedliche Blechdicken. Ein Randträger verbindet alle Hauptträger.
Ein Drehrohr mit einem Durchmesser von 35 Zentimeter, das an ein Hydrauliksystem angebunden ist, erlaubt das Öffnen und Schliessen des Daches. Damit ist die ganze Dachkonstruktion ausgesteift. Die Drehachse ist auf zehn Stahlrohrstützen aufgelagert.
Abhebesicherungen im Drehrohr verhindern ein Abheben der Drehachse im Falle eines Erdbebens. Das Gegengewicht des Daches ist ein ausgesteifter Hohlkastenträger, teilweise mit Beton gefüllt und wiegt 110 Tonnen. Der Ober- und Untergurt des Kastens wird aus Blechen gebildet, die mit T-Trägern versteift sind. Die Montage des Forumdachs erfolgte abschnittweise nur mit Hilfe eines Autokrans und Hubbühnen – ein Traggerüst war nicht erforderlich.
Lichte Freiräume
Die Haupttragelemente der Forumfassade bestehen aus einem Druckring, vorgespannten Seilen und etwa 25 Meter hohen Stahlstützen. Der Druckring ist gelenkig an den Deckenrändern angeschlossen, mit den Spiralseilen bildet er im Grundriss eine speichenradartige Struktur. Die Sekundärträger sind Holhlkastenquerschnitte, die gelenkig mit den Stahlstützen verbunden sind. Zwischen den Horizonalträgern sind vertikal Glasschwerter angeordnet, welche die Windlasten aufnehmen.
Beeindruckend sind die 12 Meter hohen Glastore, die an Stahlrohren als Drehachsen fixiert sind. Die horizontalen Windlasten der Türen übernehmen auskragende und gevoutete Stahlschwerter.
Der Stahl- und Metallbau bleibt grösstenteils sichtbar und zeichnet sich durch die sorgfältige Detaillierung aus. Stahl wirkt bei diesem innovativen Bürogebäude als Botschafter für Grosszügigkeit, Eleganz und Präzision. Die Konstruktion besticht durch ihre filigrane Erscheinung und reagiert mit Leichtigkeit auf die hohen technischen Anforderungen. Das Projekt wurde deshalb vom Stahlbau Zentrum Schweiz mit dem Prix Acier 2009 ausgezeichnet.
Gebaute Firmenphilosophie
Die Mainstreet als Hauptachse durch den Gebäudekomplex bietet eine Vielzahl an Galerien, Passerellen und Treppenanlagen zur Unterstützung der Kommunikation und der freien Zirkulation. Im Foyer empfängt den Besucher eine wandhohe Lichtinstallation namens «Layers of Life», die durch vorgelagerte Galerien mit transluzenten Böden unterstrichen wird. Diese Installation kombiniert und verdichtet die Elemente Wasser und Wachs mit einer Spiegelwand und Mulitmedia-Design. Symbolisiert wird damit die menschliche DNA. Blöcke aus natürlichem, gelben Bienenwachs sind, entsprechend der abstrahierten Form eines Gen-Codes, auf einer Gesamtfläche von rund 400 Quadratmetern angeordnet. Hinter dieser Wachswand bilden künstlicher Regen und eine Spiegelwand weitere Schichten, welche durch Unterbrüche in der Wachswand sichtbar und sinnlich erfahrbar werden.Steeldoc, Mo., 2010.07.19
19. Juli 2010 Evelyn C. Frisch, Johannes Herold