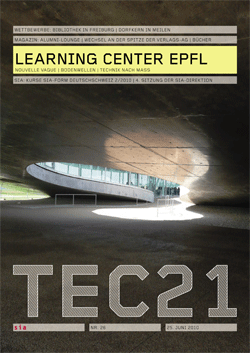Editorial
Solches Aufsehen hat die Architektur der EPFL in Ecublens bei Lausanne zuletzt vor vierzig Jahren erregt. Damals hatten die Tessiner Tita Carloni, Luigi Snozzi, Flora Ruchat-Roncati, Aurelio Galfetti und Mario Botta am Wettbewerb für die Planung des neuen Campus teilgenommen und die Jury mit einem visionären Vorschlag schockiert, der entgegen dem funktionalistischen Dogma neue Bezüge zum historischen Kontext suchte. Realisiert wurde zwar das Projekt des Zürchers Jakob Zweifel, eine dichte und streng orthogonale Anlage; doch der Entwurf der Tessiner lenkte die Aufmerksamkeit auf eine Entwicklung der Schweizer Moderne, die später unter dem Sammelbegriff «Tendenza» internationalen Ruhm erlangen sollte.
Seit seiner Einweihung ist der Campus mehrfach erweitert worden. In den letzten Jahren sind unter anderem das Informatikgebäude von Rodolphe Luscher (2005) und der Life-Science-Bau von Devanthéry & Lamunière (2009) hinzugekommen, Richter & Dahl Rocha entwarfen ein Cluster für High-Tech-Firmen (im Bau) sowie ein Kongresszentrum samt Wohnbauten (2012), das Idheap-Gebäude von Geninasca Delefortrie steht kurz vor der Fertigstellung. Das Hauptereignis ist jedoch das im Mai eingeweihte, nach dem Hauptsponsor benannte Rolex Learning Center von Sanaa.
Dass der Bau von Stararchitekten stammt – Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa haben 2010 den Pritzker-Preis erhalten, Sejima kuratiert die diesjährige Architekturbiennale in Venedig –, kommt den Plänen des EPFL-Präsidenten Patrick Aebischer entgegen, die Hochschule international neu zu positionieren. Doch das Learning Center ist mehr als medienwirksame Signature Architecture. Es ist unverschämt aufwendig gebaut, und es ist unverschämt gut. Es bietet jene Begegnungsräume, die dem Campus seit 1970 fehlen.
Und es beruht auf der Zusammenarbeit von Sanaa mit dem Ingenieur Mutsuru Sasaki, der bereits am 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa (2005) beteiligt war. «Mr. Sasaki has been kindly joining us to think about whatever it is we might be thinking»1 – in der Wettbewerbsphase des Learning Center hat er dessen Tragstruktur entworfen und digital konkretisiert. Daneben hat Sasaki in den letzten Jahren mit weiteren namhaften japanischen Architekten zusammengearbeitet, unter anderem mit Toyo Ito bei dessen Mediathek in Sendai (2000) und beim I-Project (2005), einem Park mit organisch gewölbten Gewächshäusern in der Bucht von Fukuoka.2 Höchste Zeit, sein Werk auch in Europa zur Kenntnis zu nehmen!
Judit Solt
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Bibliothekserweiterung in Freiburg | Dorfkerngestaltung in Meilen
10 MAGAZIN
Wissenschaft und Wodka | Wechsel an der Spitze der Verlags-AG | Bücher
18 NOUVELLE VAGUE
Judit Solt
Architektur: Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa haben den EPFL-Campus um einen einzigartigen Bau bereichert. Das Publikum weiss es zu schätzen.
23 BODENWELLEN
K. Bollinger, M. Grohmann, A. Weilandt, M. Wagner, R. Walther, G. Santini, St. von Ah
Ingenieurwesen: Nicht weniger als fünf Ingeni-eurbüros waren am Entwurf der Tragkonstruktion beteiligt.
28 TECHNIK NACH MASS
Rolf Moser, Pierre Jaboyedoff, Steffi Neubert
Gebäudetechnik und Fassadenbau: Dank innovativen Ideen und der Zusammenarbeit vieler Fachleute und Firmen konnte der Minergiestandard erreicht werden.
33 SIA
Kurse SIA-Form Deutschschweiz 2/2010 | 4. Sitzung der SIA-Direktion
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Bodenwellen
Das Rolex Learning Center (RLC) in Lausanne besticht durch sein ungewöhnliches architektonisches Konzept. Das japanische Ingenieurbüro Sasaki and Partners aus Tokio entwickelte das Tragwerkskonzept dafür. Auf einem massiven, mit scheinbarer Leichtigkeit geschwungenen Betonboden steht die Dachkonstruktion aus Stahl und Holz. Vier verschiedene Schweizer Bauingenieurbüros verfeinerten dieses Konzept, berechneten die Tragkonstruktion und setzten sie in die Realität um.
Die architektonische Landschaft des RLC ist durch seine wellenförmige Gestaltung geprägt (vgl. «Nouvelle Vague», S. 18). Sie ist im Grundriss rechteckig mit Abmessungen von 121.5 m × 166.5 m und weist im Wesentlichen zwei organisch geschwungene Bereiche auf mit dazwischen liegenden flachen Zonen. Wo die Landschaft sich mit luftunterströmten Wellen vom Untergrund löst, überspannt das Tragwerk 85 m (grosse Schale) bzw. 40 m (kleine Schale). Das Gebäude ist mit Patios durchsetzt, die eine natürliche Belichtung und Belüftung ermöglichen. Unter dem Regelgeschoss ist eine eingeschossige Tiefgarage angeordnet, die zusätzlich Raum für Bibliothek, Haustechnik, Archive und sonstige Nebenräume bietet.
Massive Betonschale mit Bodenwellen
Das japanische Ingenieurbüro Sasaki und Partners (SAPS) sah für das Tragwerkskonzept dieser Landschaft einen massiven Betonboden vor, der von einer Leichtbaukonstruktion aus Stahl und Holz in gleichbleibendem Abstand überdacht wird. Der Betonboden wurde dort, wo er sich vom Untergrund abhebt, als Schale ausgebildet. Da anders als bei üblichen Schalenkonstruktionen diese nicht als Dach, sondern als Boden der Nutzfläche dient, wurden an ihre Geometrie besondere Anforderungen gestellt, die es im Rahmen der Formfindung zu berücksichtigen galt. Diese zusätzlichen Anforderungen, die sich aus der Nutzung und den architektonischen Gesichtspunkten ergaben, verlangten unter anderem die Einhaltung von begrenzten Steigungen, was wiederum geringe Stichmasse bei den Schalen hervorrief. Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde für die flachen Schalen ein statisches System aus Bögen ausgebildet, die einen Grossteil der Lasten zu den Widerlagern abtragen. Diese wurden in ihrer Geometrie optimiert und weisen ein relativ hohes Krümmungsverhältnis auf, sodass die Membrantragwirkung überwiegt. Die zwischen diesen Krümmungen aufgespannten Plattenbereiche sind dagegen relativ flach, sodass hier hohe Biegebeanspruchungen auftreten.
Im Detail lässt sich die Geometrie der Betonschalen wie folgt beschreiben: Die kleine Schale mit einer Bauteildicke von 40 cm weist ein verhältnismässig grosses Stich- zu Spannweiten- Verhältnis 1/10 auf (h = 4 m, l = 40 m). Drei Patios schneiden in diese Schalenkonstruktion ein, sodass dazwischen vier lastabtragende Bögen (Abb. 3, A1 bis A4) ausgebildet sind. Die grosse Schale mit einer Spannweite bis zu 85 m und einem maximalen Stichmass von 4.85 m hat dagegen ein entsprechend kleineres Stich- zu Spannweiten-Verhältnis, etwa 1/17.5. Die Lage der Patios in dieser grossen Schale ermöglichte die Ausbildung von sieben lastabtragenden Bögen (Abb. 3, A5 bis A9), deren Bauteilhöhe 80 cm beträgt. In den dazwischen liegenden Schalenbereichen konnte zur Reduktion des Eigengewichts die Stärke auf 60 cm reduziert werden. Unter der grossen Schale wurden drei vertikale lastabtragende Elemente angeordnet, um die Stabilität zu gewährleisten: erstens ein Aufzugskern, der aufgrund der Nutzeranforderungen ohnehin erforderlich war; zweitens eine Wand, die im westlichen Bereich des südlichen Bogens angeordnet ist, sodass dieser mit einer Gegenkrümmung in den flachen Deckenbereich auslaufen kann; und drittens eine Stütze, die den diagonal verlaufenden Bogen nördlich des grössten Patios stabilisiert.
Den massgeblichen Anteil der Belastung der Betonschalen bilden die ständigen Lasten, die sich aus dem Eigengewicht und den ständigen Lasten inklusive des Eigengewichts des Stahldaches zu 22.5 kN/m² für die grosse Schale und zu 15 kN/m² für die kleine Schale ergeben. Die veränderliche Last spielt mit 5 kN/m² nur eine untergeordnete Rolle. Die Bodenschale ist auf ihrer Oberseite gedämmt. Der Beton liegt also im Aussenbereich und ist damit Temperaturschwankungen ausgesetzt, die im Rahmen der Nachweise auch zu berücksichtigen waren. Überdacht wird das Gebäude mit einem Stahl-Holz-Dach, das parallel zur Betonschale verläuft und auf Stützen liegt, die im Raster von 9 × 9 m angeordnet sind.
Verformungen
Neben dem Nachweisen von Tragsicherheit und Stabilität war für die Wahl der Bewehrung die Analyse der Verformungen entscheidend. Die zulässigen Grenzwerte der Deformationen wurden hierbei in Bezug auf das auf den Schalen aufliegende Stahldach und die Fassaden festgelegt. Die maximale Verformung der grossen Schale unter Berücksichtigung von Kriechen und Schwinden beträgt rechnerisch 220 mm. Dieser Wert, der zunächst sehr hoch erscheint, liegt in Bezug auf die Spannweite von 80 m mit l/300 im Bereich der üblichen Verformungen von Stahlbetonkonstruktionen. Die im Rahmen der Ausführung durchgeführten Kontrollen weisen jedoch deutlich geringere Werte auf, die mit dem verwendeten Beton zu erklären sind, der bessere Kriech- und Schwindeigenschaften aufweist, als in der Berechnung angesetzt wurden.
UG-Decke mit Doppelfunktion
Die statischen und konstruktiven Anforderungen waren auch für die Decke über der Tiefgarage sehr hoch gesteckt, da diese zwei Hauptfunktionen übernimmt: Zum einen erfüllt sie die klassische Funktion einer Geschossdecke für das darunterliegende Untergeschoss und zum anderen nimmt sie die grossen Horizontalkräfte der darüberliegenden Schalentragwerke auf. Diese Zugbänder, bestehend aus im Verbund wirkenden Vorspannkabeln, überdrücken die horizontalen Auflagerkräfte aus den darüberliegenden Schalen. Sie befinden sich jeweils in der Flucht der Bögen der darüberliegenden Schalen. Zusätzlich zu den in den Zugbändern befindlichen Vorspannkabeln wurden aus Gleichgewichtsgründen und zur Aufnahme der Spreizkräfte in den Verankerungsbereichen Vorspannkabel angeordnet, die dem Verlauf der Schalenauflager folgen. Unter dem nördlichen Bogen der grossen Schale, an der Stelle mit der grössten Zugkraft, sind allein 14 Kabeleinheiten des Typs 31T15S (31 Litzen mit je 150 mm2)angeordnet. Dies entspricht einer Vorspannkraft Po von 14 × 6 173 kN = 86 422 kN! Die Stärke der Decke über der Tiefgarage variiert abhängig von ihren Beanspruchungen und den konstruktiven Bedürfnissen. Im Bereich der Schalenauflager beträgt sie zwischen 60 cm und 80 cm. In den restlichen Bereichen, in denen das Bauteil ausschliesslich die Funktion einer Decke übernimmt und die Nutzlasten von 5 kN/m2 bis 10 kN/m2 aufnehmen muss, beträgt die Deckenstärke 28 cm bis 35 cm, abhängig vom darunterliegenden Stützenraster, das zwischen 5.90 m und 9.00 m variiert.
Lastableitung im Untergeschoss
Unter den Auflagerlinien der Schalen sind im Untergeschoss Innenwände mit einer Stärke von 55 cm angeordnet, welche die vertikalen Lasten aus den Schalenauflagern direkt in die Fundamente weiterleiten. Unterbrüche in den Wänden unterhalb der Patios ermöglichen die für den Parkingbetrieb nötigen Fahrgassen. Die Stützen im Untergeschoss unterteilen sich in zwei funktionale Kategorien: Die Nachbarstützen der Innenwände müssen neben ihrer normalen Funktion des vertikalen Lastabtrags der Deckenlasten zusätzliche Reaktionen aus der Einleitung der Auflagermomente der Schalen mittragen. Ihre Dimensionen sind mit 30 × 60 cm entsprechend grösser als jene der Standardstützen mit 30 × 40 cm bzw. 40 × 40 cm in den restlichen Bereichen des Untergeschosses. Die Aussenwände mit einer Stärke von 25 cm bilden den peripheren Abschluss des Untergeschosses. Sie sind auf den anstehenden Erddruck und einen potenziell möglichen Wasserdruck bis auf 1 m über dem Wandfuss bemessen. Die minimal 25 cm starke Bodenplatte und die Aussenwände sind als «weisse Wanne» über eine Länge von 160 m fugenlos ausgebildet. Sie liegt auf einer sandigen, lehmigen Bodenschicht mit mässiger Tragfähigkeit, in der Hangwasser zirkuliert. In den Zonen unter den Innenwänden, in denen die grossen Vertikallasten an die Tiefengründung weitergeleitet werden, beträgt die Stärke der Bodenplatte deshalb bis zu 2 m.
Zur korrekten Krafteinleitung der vertikalen Lasten und zur Vermeidung von zu grossen differenziellen, vertikalen Deformationen wurde das gesamte Bauwerk auf Pfähle gegründet, welche die Kräfte hauptsächlich über Spitzendruck in die tiefer liegende Moräne einleiten. Dabei wurden insgesamt 650 Pfähle verwendet. Den Hauptanteil bilden Verdrängungspfähle mit Durchmessern zwischen 50 cm und 60 cm und Längen zwischen 14 m und 23 m. Weiter wurden unter den Schalenauflagern auch Grossbohrpfähle mit einem Durchmesser von 90 cm und einer Länge von 27 m ausgeführt. In einzelnen Bereichen, in denen die Erstellung der Verdrängungspfähle durch das Vorhandensein von Felsblöcken unmöglich war, wurden diese durch Mikropfähle ersetzt.
Bewehrung am Limit
Neben dem konstruktiven Entwurf und den statischen Berechnungen stellte auch die Ausführungsplanung für die Betonschalen und deren Auflagerbereiche in der Decke über dem Untergeschoss eine grosse Herausforderung dar (vgl. «TRACÉS 12/2008», S. 7). Zum einen musste die komplexe dreidimensionale Geometrie auf den Werkplänen so abgebildet werden, dass sie auf der Baustelle gelesen und ausgeführt werden konnte. Zum anderen mussten Bewehrungsdetails entwickelt werden, die den effektiven Einbau der erforderlichen hohen Bewehrungsmengen, die bei den Bögen der grossen Schale bis zu 470 kg/m³ betragen, ermöglichten.
Um die Ausführbarkeit der Bewehrungsführung zu gewährleisten, wurden zunächst für einige Details Prinziplösungen entwickelt, die in 1:1-Mock-ups hinsichtlich der Machbarkeit überprüft wurden. Zu diesen Standarddetails gehörte der Übergang zwischen Bögen und Plattenbereichen der grossen Schale, bei dem sowohl die Bauteilhöhe von 80 cm auf 60 cm verspringt als auch die Bewehrungsrichtung sich ändert. Das zweite Standarddetail war die radial bzw. tangential verlaufende Bewehrung der Patiorandträger mit anschliessendem Plattenbereich und schliesslich als Drittes das Detail der Auflagerbereiche der Schalen mit dem Übergang von Schalungs- und Deckenbewehrung und dem zu berücksichtigenden Betonierabschnitt. Um den hohen Bewehrungsgrad der Bögen zu ermöglichen und um gleichzeitig ausreichend Gassen für die Rüttler zur Verfügung zu stellen, wurde als Hauptbewehrung der Bögen Bewehrungseisen mit einem Durchmesser von 50 mm gewählt, die in den Hauptbögen im Abstand von 25 cm jeweils zweilagig oben und unten angeordnet sind. Die Entwicklung der Prinzipdetails ermöglichte eine Optimierung der Bewehrungsführung, sodass die Schalen zwei Monate vor dem ursprünglich vorgesehenen Termin betoniert werden konnten. Insgesamt wurden hierbei in beiden Schalen 2070 t Stahl und 5400 m³ Beton verbaut. Die Betonnage erfolgte für beide Schalen ohne Unterbrechung: 10 h für die kleine Schale und 55 h für die grosse.
Zusammenspiel ermöglicht die Umsetzung
Die beeindruckenden Bilder des fertiggestellten Gebäudes zeigen, dass die ursprüngliche Idee der Architekten, eine architektonische Landschaft zu schaffen, umgesetzt werden konnte. Dies war nur durch die gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen allen Planern und Unternehmern möglich. Das Ergebnis kann kaum mit einem bereits existierenden Bauwerk, sei es aus architektonischer oder ingenieurtechnischer Sicht, verglichen werden. Es ist in vielen Belangen ein Unikat.TEC21, Fr., 2010.06.25
25. Juni 2010 Klaus Bollinger, Manfred Grohmann, Agnes Weilandt, Michael Wagner, René Walther, Gilbert Santini, Stefan von Ah
verknüpfte Bauwerke
Rolex Learning Center