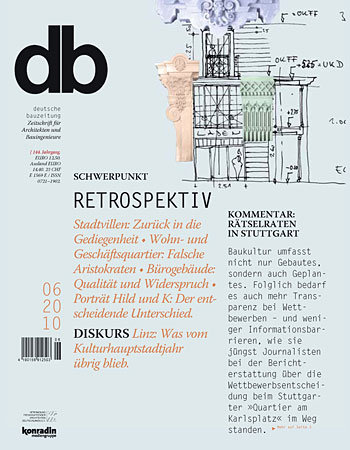Editorial
Architektur, die sich historisierender Elemente bedient, findet normalerweise keinen Einzug in Fachzeitschriften – in diese bisher auch nicht. Unter Kollegen und in der übrigen Fachwelt gehört es zum guten Ton, die modernen Eklektizisten und ihre Projekte zu schmähen und das Lob des Neuen und Originellen zu singen. Doch machen wir uns nichts vor: In der Bevölkerung erfreut sich traditionalistische Architektur großer Beliebtheit. Als Massenphänomen prägt sie unsere Städte. Deshalb, so finden wir, kann man sie nicht einfach ignorieren. Also begehen wir mit dieser Ausgabe einen Tabubruch und beginnen mit der ernsthaften aber kritischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Retrospektiven. | red
Historisierendes Bauen in Hamburg
(SUBTITLE) Falsche Aristokraten
Nicht nur, aber auch in Hamburg lässt sich der Hang zum neuen Traditionalismus durchaus als Massenphänomen bezeichnen. Retro-Neubauten sind gefragt und werden somit auch gebaut. Seit neuestem sogar mit ausdrücklicher Befürwortung durch die Hamburger Politik. Unser Autor betrachtet das Phänomen kritisch und stellt in diesem Zusammenhang die Projekte »Westend Ottensen« und »Hegehof-Terrassen« vor.
Der Paukenschlag kam ganz am Ende. Im Januar dieses Jahres veröffentlichte das Bezirksamt Hamburg-Mitte recht überraschend »Leitsätze für die bauliche Gestaltung der Innenstadt«. In ihnen sind zunächst viele Aussagen zu finden, die absolut mehrheitsfähig sind: Neubauten und Aufstockungen sollen sich in ihren Höhen an die Umgebung anpassen, Blickbeziehungen zu Kirchtürmen sind zu erhalten, der Wohnanteil auszubauen usw. Doch dann: »Die architektonische Gestaltung von Neubauten soll grundsätzlich ihre Entstehungszeit repräsentieren. Eine historisierende Gestaltung wird im Einzelfall jedoch nicht ausgeschlossen, wenn die Umgebung dies sinnvoll erscheinen lässt.« Diese Passagen bedeuten eine Zäsur. Seit über 100 Jahren, seit der Berufung Fritz Schumachers zum Leiter des Hochbauwesens und zum Baudirektor im Jahre 1909 gab es in der Hamburger Politik und Verwaltung den Konsens für eine moderne Architektur und einen ebensolchen Städtebau. Er wurde nun aufgekündigt. – Warum? Die Begründung erscheint trivial, denn es werden keine fachlichen Gründe genannt – vielmehr beruft man sich im Bezirksamt Mitte auf ein vermeintliches Volksempfinden: »In der Anmutung bereiten das Hotel Adlon in Berlin und der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden vielen Menschen Freude.
In besonderen Fällen wird eine solche Form der Stadtbildreparatur für möglich gehalten.« Und in einem Zeitungsinterview unterstrich Bezirksamtsleiter Markus Schreiber: »Ich bin davon überzeugt, dass die Bürger sich dabei wohler fühlen werden als bei der neuen Stahl-Glas-Architektur. Wir bauen für die Bürger und für deren Wünsche müssen wir offener sein«. Mit anderen Worten: Die Leute wollen das so. – Wollen sie es so?
Neu imitiert alt und kommt an
Wer offenen Auges durch Hamburg spaziert, wird in der Tat ein eigenartiges Phänomen beobachten: Während vor allem im Zentrum (unter der Ägide eben jenes Bezirksamtsleiters) die bauliche Vergangenheit durch rüde Entkernungen, Aufstockungen und Abrisse immer weiter vernichtet wird, entstehen (bislang nur außerhalb der City) zugleich zahlreiche neue Gebäude, die sich ein historisches Gewand überstreifen. Das authentisch Alte verschwindet und wird vom Neuen imitiert. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Investoren und Architekten, die sich auf dieses Wachstumssegment konzentrieren. Makler berichten, dass sich historisierende Neubauten in Hamburg deutlich besser verkaufen lassen als solche mit modernem Antlitz. Waren es anfangs noch einzelne Wohnhäuser und Villen, sind es nun die Stadthäuser oder Town Houses genannten Reihenhäuser nach dem Vorbild der englischen terraced houses und auch hochverdichtete Quartiere mit Mehrfamilienhäusern. Die zumindest preisliche Spitze dürfte das Luxusquartier Sophienterrassen in Harvestehude bilden. Auf dem 4,5 ha großen Grundstück der ehemaligen Bundeswehr-Standortkommandantur in allerbester Außenalsterlage werden Wohnungen zu Quadratmeterpreisen bis 15 000 Euro verkauft. Die Lokalpresse hat natürlich schnell den Trend erkannt und feiert historistische Bauten als willkommene Alternative zum ungeliebten »avantgardistischen Glas- und Stahldesign« der Modernisten. Protagonisten der Retro-Szene wie der Hamburger Architekt Matthias Ocker können sich unter Schlagzeilen wie »Dieser Mann hasst Klötze« als mutige Kämpfer gegen eine »seelenlose, eitle Sensationsarchitektur« und für eine »sinnliche und ursprüngliche Atmosphäre« in unseren Städten in Szene setzen. Die vordergründigen und pauschalierenden Berichte verhindern einen unvoreingenommenen Blick auf die Wirklichkeit. Dabei gäbe es einiges zu diskutieren: Ist »modernes« Bauen denn tatsächlich der einzig adäquate Ausdruck unserer Gegenwart, wenn wir bei Saturn Retroradios kaufen und Bakelit-Lichtschalter bei Manufaktum und unsere iPad-Bibliothek in einem virtuellen Bücherregal aus Kirschholz steht? Kann andererseits moderne Architektur nicht genauso »kleinteilig, sinnlich und vielfältig« sein, wie es die traditionelle Architektur angeblich ist? Und was sind eigentlich objektive Kriterien für eine Beurteilung der historistischen Bauwerke? Ist größtmögliche Authentizität das Ziel oder eher die Schaffung einer heimeligen Atmosphäre? Ist handwerkliche Qualität der industriellen Herstellung vorzuziehen? Ist ein purer klassizistischer Bau besser als ein eklektisches Stilgemisch? In den städtischen Fachzirkeln wird all das bislang nicht erörtert. Der Oberbaudirektor will zumindest die Innenstadt von traditionalistischen Neubauten freihalten, scheut aber eine offene Diskussion mit dem Bezirkschef, der genau das erlaubt hat.
Ebenso wenig lassen sich die Berufsverbände auf dieses Thema ein: Vorträge, Streitgespräche oder Diskussionsrunden hierzu sucht man meist vergeblich. Und dass ein historisierendes Gebäude jemals einen BDA-Preis gewinnt, erscheint völlig undenkbar. Immerhin: In das von der Hamburgischen Architektenkammer herausgegebene Jahrbuch »Architektur in Hamburg« nimmt die Redaktion (deren Mitglied der Autor ist) auch Retro-Bauten auf, weil sie es als ihre Aufgabe sieht, das gesamte Spektrum des Hamburger Baugeschehens zu analysieren – was nicht auf ein ungeteilt positives Echo in der Architektenschaft stößt.
Westend Ottensen: unmotivierter Stilmix
Wenn man die ideologischen Vorbehalte jedoch einmal beiseite lässt, kommt man nicht umhin einzugestehen, dass einige dieser Gebäude bemerkenswert sind. Zwei völlig unterschiedliche Projekte sollen dies verdeutlichen: Die »Hegehof-Terrassen« des bereits genannten Matthias Ocker und das »Westend Ottensen«, dessen Name wohl eine Verwandtschaft zum Londoner Westend suggerieren soll. Hier, zwischen Völckers- und Borselstraße mitten im alten Arbeiter- und Industriestadtteil Ottensen, stehen bescheidene Gründerzeit-Zinshäuser, umgenutzte alte Fabrikhallen und einfache, aber wohlgestaltete Gelbklinker-Arbeiterwohnhäuser der 20er Jahre von Altonas modernem Stadtbaurat Gustav Oelsner. Mittenhinein in diese kleinteilige, bescheidene, proletarisch geprägte Welt krachte vor kurzem ein gewaltiges großbürgerliches Wohn- und Büroquartier auf das Gelände einer abgerissenen Fischfabrik. So deplatziert und fremd das Projekt wirkt – es ist die logische Konsequenz der Aufwertung Ottensens vom kleinbürgerlichen Stadtteil zum Szene- und Kreativstandort. Erst die jahrzehntelange ungesteuerte Gentrifizierung schuf den Humus, auf dem das Westend wachsen konnte. Und so stehen sich heute das alte und das neue Ottensen in Gestalt von Arbeiterkleinwohnungen und 200-m²-Lofts in einer Straße gegenüber. Das Westend ist eine Mischung aus Blockrand- und Hofbebauung, gestaltet vom Hamburger Planungsbüro Flumdesign sowie dem Mailänder Architekten Antonio Citterio mit Hinrichs Nicolovius Architekten. Die Vorderhauszeilen wurden in mehrere die durchlaufenden Grundrisse kaschierende Einzelhausfassaden aufgelöst, die stilistisch zwischen Klassizismus und gemäßigter Moderne schwanken. Eine Passage sowie zwei offene Durchgänge leiten in das erfreulicherweise nicht abgeschlossene Innere der Anlage. Dort ist es überraschend eng und unübersichtlich. Zwei aneinandergeschobene, großvolumige, unregelmäßig geformte Gebäude füllen den Hof fast vollständig aus und lassen auf drei Seiten nur schmale Räume frei. In der nordöstlichen Hofecke jedoch wurde ein runder Platz mit Springbrunnen eingepasst, der der Anlage ein inneres Zentrum geben soll. Ein harmonischer Gesamteindruck ergibt sich freilich nicht: Viel zu unruhig ist das Geschehen. Wird die Freifläche auf der einen Seite mit geradezu theatralischer Geste von einem abgerundeten Bürohaus mit einem (überflüssigen, weil zu kurzen und funktionslosen) Arkadengang und einem hohen, von mächtigen Pfeilern getragenen Durchgang gefasst, so verläuft sie sich auf der gegenüberliegenden Seite in einem Gewirr von vor- und rückspringenden Anbauten, Nischen und Loggien. Dieses unvermittelte und unmotivierte Aufeinanderprallen unterschiedlicher Formen, Stilelemente und Typologien prägt das ganze Quartier. Es entstehen aberwitzige Detaillösungen, wenn beispielsweise Loggien in innere Gebäudeecken hinein gebaut werden, eine moderne Glasbrücke zwei klassizistische Bauten verbindet, Satteldächer sich munter abwechseln mit Flach- und Tonnendächern. Und der Stileklektizismus vereint Dorisches mit Ionischem, Klassizistisches mit Modernistischem – teilweise an ein und demselben Gebäude. Das Durcheinander wirkt im Einzelnen unbeholfen, hat aber dennoch Methode: Es soll so eine Unterschiedlichkeit und Lebendigkeit suggeriert werden, wie sie die Klientel an den Gründerzeitquartieren kennt und liebt. Nicht umsonst wirbt die Website zum Westend mit dem Satz, dies sei »ein Quartier, das sich den Charme der Gründerzeit bewahrt hat und das auf die individuellen Wünsche der Bewohner eingeht.« Und wer will hier wohnen? Es ist überraschend: Keine Senioren mit Hang zur guten alten Zeit, sondern solvente Einzel- und Doppelverdiener jüngeren und mittleren Alters, die Pilaster und Giebel genauso schätzen wie moderne Ausstattung mit Fußbodenheizung, offener Designwohnküche und Tiefgarage – und sich wenig darum scheren, ob das alles zusammenpasst. Ähnlich ist es auf den Büroetagen: Wer hier Notare und Schiffsmakler vermutet, liegt falsch. Es dominieren junge Firmen des tertiären und quartären Sektors: E-Commerce, Online-Marketing, Produktdesign, Konsumforschung.
Hegehof-Terrassen: perfekt eingepasster Stilmix
Der Kontrast zu den Hegehof-Terrassen, eine Anlage aus Vorder- und Hinterhaus in der Hegestraße im großbürgerlichen Stadtteil Eppendorf, könnte größer nicht sein. Hier ist alles wohldurchdacht – stilistisch, typologisch, gestalterisch. Die Häuser sind so perfekt geplant und ausgeführt, dass sie inmitten ihrer gründerzeitlichen Nachbarbauten zunächst kaum auffallen. Im Unterschied zu den prächtigen Nachbarn zeigt der Neubau des Vorderhauses Understatement. Statt mit noblem weißen Putz sind die Fassaden mit einem einfachen, aber präzise gefügten Sichtmauerwerk verkleidet, in die sich genauso akkurat die hohen, schmalen französischen Fenster mit ihren Natursteinleibungen schneiden. Ebenso aus Naturstein sind die Kranzgesimse sowie die (beim Vorderhaus zweigeschossigen bzw. beim Hofhaus eingeschossigen) Natursteinsockel. Sie besitzen eine dezente Quaderung, die über den Türen und dem Tordurchgang als Bogenquaderung ausgeführt wurde. Hinter den hohen Fenstern des Vorderhaussockels verbergen sich übrigens gleich zwei Geschosse, denn über dem (erfreulicherweise für vier Geschäfte genutzten) Sockelgeschoss wurde noch ein Mezzanin eingefügt. Vorder- und Hinterhaus sind symmetrisch angelegt; ihre Mittelteile durch Tordurchgänge sowie (beim Vorderhaus) mittels eines flachen Giebels und durch offene Balkone betont. Wirkt das Vorderhaus würdevoll und herrschaftlich, so erscheint das Hofhaus deutlich privater, intimer. Verantwortlich hierfür sind die geringere Geschosszahl, das flachere Sockelgeschoss und das mit Gauben versehene, ausgebaute Mansarddach. Zusätzlich werden die Balkone der ersten Etage durch von Steinmetzen geschaffene toskanische Säulen und ein Gebälk getragen, die zugleich einen geschützten Vorraum für die Hauseingänge definieren. Das Innere der Häuser korrespondiert mit dem fein differenzierten Äußeren: Im Vorderhaus wohnt man auf bis zu 150 m² komfortabel, aber nicht luxuriös in Vierzimmer- oder Maisonette-Wohnungen. Im Hofhaus sind die Wohnungen mit zwei Zimmern im Normalgeschoss und drei Zimmern als Maisonette-Typ deutlich bescheidener – dafür aber ruhiger und mit Blick auf den unmittelbar angrenzenden Isebekkanal. Die Grundrisse der bei der Erstvermietung 16 Euro / m² teuren Wohnungen sind der Gründerzeit entlehnt: Wie damals liegen die Zimmer um einen Erschließungs- und Sanitärkern, sind teilweise durch Flügeltüren miteinander verbunden und annähernd gleich groß – aus einem Schlaf- wird problemlos ein Kinderzimmer, aus einem Wohn- ein Arbeitsraum. Die Hegehof-Terrassen sind eine formidable Weiterführung der Gründerzeitbauten des Stadtteils und eigentlich eine Stadtreparaturmaßnahme. Gute Lage, solide Bauweise, praktische Grundrisse: Merkmale, die auch ohne Rückgriffe auf die Vergangenheit Qualität erzeugen.
Doch so unterschiedlich die Hegehof-Terrassen und das Westend Ottensen im Detail auch sind und so verschieden die Ansprüche der Bewohner sein mögen – beide Projekte sind Ausdruck derselben gewaltigen Schizophrenie: Gerade in den besseren Kreisen gibt es ein weit verbreitetes und tiefgehendes Unbehagen an einer Moderne, die die althergebrachten und traditionsgeleiteten Fundierungen unserer Gesellschaft immer weiter aufzulösen scheint. Das Versprechen der Moderne auf eine schönere, bessere Welt nimmt man ihr, so es überhaupt noch geäußert wird, nicht mehr ab. Zugleich möchte niemand die Annehmlichkeiten des Fortschritts missen. Die Synthese aus beidem ist das Wohnen und Arbeiten in historisierenden Bauten mit moderner und komfortabler Ausstattung. Die Bewohner wissen genau, dass sich die Uhr nicht anhalten oder zurückdrehen lässt, denn: »Alte Fassaden sind für die neue Zeit nicht undurchlässig. Zwischen Form und Inhalt treten gewaltige Ungleichheiten auf, die die Form aber nie im Ernst für sich entscheiden kann« (Ullrich Schwarz). Ganz offensichtlich stört dieser Zwiespalt die Bewohner aber nicht – sie erkennen ihn womöglich noch nicht einmal. Schade, dass die eingefleischten Modernisten und Traditionalisten unter den Architekten sich so feindselig gegenüber stehen. Die einen könnten sonst verstehen, dass die Hinwendung zum tradierten Formenkanon keine Rückkehr ins Kaiserreich bedeuten muss, und die anderen müssten feststellen, dass die Bewohner ihrer Häuser nicht die moderne Welt fliehen – sie wollen es sich nur etwas gemütlicher darin machen.db, Mo., 2010.06.07
07. Juni 2010 Claas Gefroi
Gedanken zum Werk von Hild und K
(SUBTITLE) Feine Antworten auf alte Fragen
Kaum ein Büro ist stilistisch derart schwer zu fassen wie Hild und K: Die Erinnerung an Bekanntes schwingt in ihren Entwürfen stets mit, ohne dass man von einer »Zitate-Architektur« sprechen könnte. Unsere Autorin spürt im Gespräch mit Andreas Hild und Dionys Ottl deren akribischer Konzept- und Entwurfsarbeit nach.
Eine Geschichte über das Duo Andreas Hild und Dionys Ottl, die seit 1999 gemeinsam das Büro Hild und K in München führen, in einem Retro-Heft zu platzieren, folgt der Strategie des feinen Unterschieds. Während unseres Gesprächs in der Lobby ihres jüngst fertiggestellten Hotels Louis am Münchener Viktualienmarkt ist es vor allem Andreas Hild, der skeptisch jede Vokabel prüft, die zur Charakterisierung der Arbeiten versuchsweise von der Autorin angeführt wird. Bloß in keine Schublade gesteckt werden! Da mag der Betrachter und Nutzer der Hild und K-Architekturen von deren stupenden handwerklichen Details beeindruckt sein, aber in handwerkliche Traditionen mag sich das Büro nicht stellen. Bloß keine Werkbund-Sentimentalitäten von guten alten Zeiten der Materialgerechtigkeit. Da mögen die Anklänge an bereits Klassisches durch den ganzen Raum schwingen, aber retrospektiv sind die Entwürfe keinesfalls.
Die Anfänge des Reisens: Spiel mit der Erinnerung
Dieses Hotel hat eine Philosophie: »Auf Reisen daheim« lautet das Motto. Und wie vermittelt man das Vertraute, Bequeme besser als mit solch tiefen einarmigen, in Blattgrün gepolsterten, geradlinigen Sesseln und Sitzbänken, die so auch im frühmodernen Salon einer Wiener Erbtante stehen könnten?
Die Herangehensweise des Büros ließe sich kon-textuell oder kon-piktoral nennen. In jedem Fall gehen Hild und Ottl immer vom konkreten Ort aus. Dabei entwickelt sich das Bild vom neu zu Schaffenden so dialogisch wie ein Gespräch. Wer den beiden Architekten gegenübersitzt, wird in einen Redefluss des Hin und Her, sich Bedingenden und Hinterfragenden, Weitergehenden und Einschränkenden, Ergänzenden und Präzisierenden hineingezogen, der sich unentwirrbar zu einer geistreichen Geschichte verdichtet. Hild und K betreiben Architektur als Kommunikation. Und da sich die beiden Persönlichkeiten, die Auftraggeber, die Aufgabe, die Architektur und der Ort gegenseitig bedingen, gleicht kein Hild und K-Projekt dem anderen. Es gibt kein (historisches) Formenrepertoire, das bei jedweder Gelegenheit durchdekliniert wird, um angeblich bessere Zeiten zu memorieren. Es gibt nur sehr distinguierte Antworten auf meist komplexe, mitunter auch schwierige Fragestellungen. Und nicht selten wirken die Antworten in dem Moment, da sie gegeben sind, ganz selbstverständlich und dadurch vertraut.
So auch im Hotel Louis, das einmal ein Versicherungsgebäude war. Zum Viktualienmarkt hin hatte der vierachsige Stahlbetonskelettbau eine Vorhangfassade aus blaugrünen Fliesen, die die schräg zum neobarocken Kustermannhaus gestellte Front zu einem sehr auffälligen Schlussprospekt des Viktualienmarkts werden ließ und den folgenden niedrigen barocken Terrassenbau in den Schatten stellte. Ein schmaler, rückwärtiger Seitentrakt nebst öffentlicher Passage verbindet das Gebäude mit einem Ärztehaus am höher gelegenen Rindermarkt. Dort flankiert einerseits der in den 50er Jahren errichtete Kustermann-Erweiterungsbau und andererseits das schlichte, barocke Pfarrhaus von St. Peter den Komplex. Als Hild und K das Projekt vom Grundstückseigentümer Kustermann übernahmen, war ein erstes Bauvorhaben bereits gescheitert und der Versicherungsbau stand bis auf die Betonstützen entblößt hinter dem Bauzaun. Es galt sich neu zu orientieren. Da half die typisch münchnerische Nachbarschaft, die trotz aller Nachkriegsbauten altstädtisch wirkt. Formal und inhaltlich wählten die Architekten die Strategie des Einpassens: In jeder europäischen Stadt gäbe es so etwas wie ein »Vereinbarungsgefüge«, erklärt Hild. Zeitgenössisches Bauen müsse sich mit diesem Vereinbarungsgefüge auseinandersetzen, um die Stadt weiter zu stärken. Kapriziöse Originalität und unvermittelte Objekthaftigkeit wären da fehl am Platz.
Im Vereinbarungsgefüge der Münchener Altstadt dominieren sehr schlichte Putzbauten, deren Lochfassaden mit leichten Stuck- oder Farbbändern und -feldern unauffällig individualisiert wurden. Das Thema unscheinbarer Putzreliefs griffen die Architekten gerne auf, genauso wie den Farbklang aus Grau- und Grüntönen. Die Gliederung der Lochfassade des Hotels am Viktualienmarkt ergab sich zwingend aus der Notwendigkeit, in dem Vierachser mit potenziell acht Fenstern fünf Hotelzimmer unterzubringen. Eine Trennmauer bedingt eine Achse aus Blindfenstern, die Hild und K zum vertikalen Flachrelief mit dem Schriftzug »Hotel« verleiteten. Durch diese typografisch ornamentierte Blindachse erhält die breite Front einen schönen Rhythmus von vier zu drei Fenstern. Alle zweiflügligen, zimmerhohen Fenster bekamen eine außergewöhnliche, nur zweiseitige Stuckrahmung in Form eines einfachen Streifens. Die Fensterleibungen sind – ebenfalls nur dreiseitig – von einem Wechsel aus Hohl- und Rundkehlen profiliert. Man hat das Gefühl, dass diese einseitige Rahmung nicht nur mutwillig die historische Tradition bricht, sondern Bezug auf die Passantenströme nimmt. Keiner der, vom Marienplatz kommend, zum Viktualienmarkt schlendert, stellt sich vor das Haus, um es achsensymmetrisch wahrzunehmen. Jeder bemerkt ein Bauwerk en passant, im flachen Winkel. Und in diesem Winkel teilt sich das raffinierte Spiel mit den individualisierenden Schmuckelementen mit. Nicht aufdringlich originell, sondern fast unter der Wahrnehmungsschwelle.
Hild und K kopieren nicht.
Sie imitieren und zitieren nicht. Sie reflektieren die Möglichkeiten tradierter architektonischer Gestaltungsmittel im zeitgenössischen Kontext. Ihre Neuinterpretationen gleichen Variationen über musikalische Themen. Dabei geht es häufig um die leisen Töne. Mit dem Effekt, dass ihre Werke kaum auffallen. So etwa das spätbarocke Handwerkerhaus in der Münchener Brunnstraße. Der Vorbesitzer hatte es ungenehmigt ausgebaut und farblich wie ornamental aufgemotzt. Als das Büro Hild und K vom neuen Eigentümer den Auftrag bekam, das Wohnhaus im Hackenviertel wieder in Ordnung zu bringen, war ihnen klar, dass es aus philosophischen wie bautechnischen Gründen keinen Rückbau in einen vermeintlichen Urzustand geben konnte. Stattdessen boten Hild und Ottl eine integre Neuinterpretation der vom Mittelalter bis heute tradierten, quartierstypischen Fassaden an. Zwei Putzfaschen, die gegeneinander verschwenkt über dem Fenstersturz aus der Fassadenfläche kippen bzw. in diese zurückweichen, modellieren die Fassade, die bis auf den Gehsteig heruntergezogen wurde. So ergibt sich im morgendlichen und abendlichen Streiflicht ein lebendiges Schattenspiel auf der Nordfront und das Haus ist in die Nachbarschaft integriert, ohne die letzte von vielen Überarbeitungen zu leugnen. Mit feinem Understatement vermag das Büro immer wieder zur »Normalität« zurückzukehren und doch für Überraschungen gut zu sein.
Die Unmöglichkeit von Rekonstruktion und Imitation reflektierte Andreas Hild mit seinem ersten Büropartner Tillmann Kaltwasser bereits 1998/99 bei der Sanierung eines Gründerzeitbaus an der Belziger Straße in Berlin, dem im Zuge einer Nachkriegsmodernisierung jeder Bauschmuck genommen worden war. Eigentlich wünschten sich die Eigentümer die Wiederherstellung der Bauornamentik nach dem vorhandenen Eingabeplan, auch um mit der opulent historistischen Nachbarschaft mithalten zu können. Die Münchener Architekten, an Sgrafitto-Scheinarchitekturen gewöhnt, beharrten auf zeitgemäßer Differenz und ließen den vergrößerten Eingabe-Entwurf mit allen entstandenen Verzerrungen in den neuen Putz ritzen und »stanzen«. Bei dieser Art der Repräsentation stellte sich heraus, dass der alte Ornament-Plan nicht aufging, da es offenbar noch während der Realsierung Ende des 19. Jahrhunderts eine Bauänderung gegeben hatte. So bekam das skizzierte Zitat eine ironische Elastizität.
In den letzten Jahren wurden Hild und K immer wieder mit schwierigen Bauaufgaben im Bestand betreut. Da war das Renaissance-Wasserschloss Hohenkammer, das, in den 70er Jahren total verhunzt, als Tagungsstätte der Münchener Rückversicherung neuen Glanz erhalten sollte. Auch hier verbot sich jedes Historisieren. Stattdessen amalgamierten die Architekten Alt und Neu, verhalfen sogar der Betonbalkendecke über dem großen Saal zu beeindruckender Raumwirkung. Mit nur wenigen, einfachen Materialien – Massivholz, Naturstein und Putz – wurden den historischen Räumen
Ruhe und Harmonie geschenkt. Sorgfältig wurde darauf geachtet, dass die neue Haus- und Medientechnik sich im Hinter- bzw. Untergrund hält. Der Versuch freilich, das Renaissance-Thema »Wandmalerei« aufzugreifen, bleibt fragwürdig. Die zaghaften Floraldekore von Martin Schwenk scheinen beliebig und finden keine Verbindung zur Architektur und der sachlich kühlen, in jedem Detail noblen Aufwertung der Raumfolgen.
Heutzutage eher unüblich: Die Integration von Spolien
Für viel Diskussion sorgte zuletzt die Wohnanlage Klostergarten »im Lehel«. Die Franziskaner im St.-Anna-Kloster traten den ehemaligen Refektoriums-Trakt in Erbpacht an die Bayerische Hausbau ab, um die Sanierung und Umstrukturierung ihres Klosters finanzieren zu können. Die neue luxuriöse Wohnanlage im Klosterhof mit der umliegenden Klausur zu vereinbaren, war eine Sache, der Umgang mit der gewachsenen Geschichte des Orts und dem Denkmal eine andere. Die explizit »normale« Wohnanlage, die so oder ähnlich als Hofarchitektur im 19. Jahrhundert und als Stadthaus in der Nachkriegszeit hätte gebaut werden können, bekam ihre Extravaganz durch die neoromanischen, 5 m hohen Steinbögen des ehemaligen Refektoriums. Auseinandermontiert und über die fünf Hausachsen vom Erd- bis zum Obergeschoss versetzt, bedingen die historischen Versatzstücke die Geometrie der neuen Wohnungen mit großer Wohnhalle und anschließenden Split-Level-Räumen. Dieses Spiel mit den Antiquitäten wirkt schon sehr manieriert und kommt mancher historistischen Ausstattungsstrategie seit der Romantik sehr nahe, reflektiert aber auch den Zeitgeist, der durch solch exklusive innerstädtische Wohnanlagen weht und mit einer Buddha-Statue auf einer Loggia seinen unfreiwillig komischen Ausdruck findet. Dem gewachsenen Kloster-Ensemble tun die wiederverwendeten Doppelbögen indes gut. Sie binden die so fremde Welt des Luxus und der Moden an die Traditionen des Orts und des Bettelordens. Ein schlichtes Eisengitter, das zwischen einfachem Lattenzaun und hochherrschaftlichem Spalier changiert, schafft die nötige diskrete räumliche Trennung der Sphären.
So sehr die Auseinandersetzung mit dem Tradierten in der »Welt der Architektur« bei Andreas Hild und Dionys Ottl eine gewichtige Rolle spielt, so wenig führen sie ihre kommunikativen Strategien zu unreflektierten, sentimentalischen, werbestrategisch plakativen Übernahmen historischen Materials. Mit Ironie und Taktgefühl wissen sie den feinen Unterschied zeitgenössisch zu kultivieren.db, Mo., 2010.06.07
07. Juni 2010 Ira Mazzoni