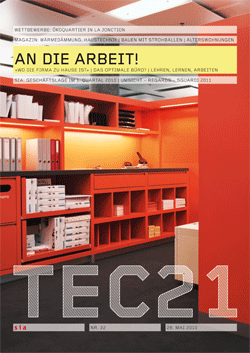Editorial
Was vor hundert Jahren eine Ausnahmeerscheinung war, gehört heute längst zum Alltag: die Arbeit im Büro. Ende des 19. Jahrhunderts betrug in der Schweiz der Anteil des Büropersonals an der Belegschaft eines Industriebetriebs durchschnittlich 4 %. Mit dem Wachstum der Firmen steigerte sich in den folgenden Jahrzehnten auch der administrative Aufwand der Betriebe.
Die Entwicklung der Bürowelten war immer mit technologischen Neuerungen verbunden: Kaufmännische Angestellte arbeiteten zunächst im Kontor; Buchhaltung und anfallende Korrespondenz wurden von Hand erledigt. Die Einführung der Schreibmaschine Anfang des 20. Jahrhunderts brachte mit dem neuen Beruf der Dactylografin auch die Feminisierung des Büros. Die zunehmende Spezialisierung führte zu einer Hierarchisierung, die sich in der räumlichen Typologie niederschlug. Bürosäale wichen Vorzimmern und Chefbüros. Das Folgemodell des Bürosaals, das Grossraumbüro der 1960er-Jahre, war auch ein Ausdruck der gesellschaftlichen Umwälzungen: Es versprach gleichwertige Arbeitsplätze für alle. Den letzten Quantensprung brachten die 1980er-Jahre mit der flächendeckenden Einführung der Personal Computer und der damit verbundenen Aufrüstung der Haustechnik. Heute entbinden Laptops, Mobiltelefone und Wireless LAN die Mitarbeitenden von der physischen Präsenz am Arbeitsplatz – die Nachfrage nach Büroflächen ist aber in der Schweiz selbst im Krisenjahr 2009 stabil geblieben.
Dabei ist das Büro nur eine von vielen möglichen Arbeitsumgebungen. Es repräsentiert das räumliche Umfeld der Wissensarbeiter und wird von Variationen wie dem Sitzungssaal oder auch dem Lehrerzimmer ergänzt. Ein besonders schönes Modell des Letzteren befindet sich in der Fachschule Viventa für Hauswirtschaft und Lebensgestaltung in Zürich. Die in den 1960er-Jahren erbaute Schule wurde kürzlich umfassend saniert, damit darin auch in den folgenden Jahrzehnten weiche Fähigkeiten und handfeste Fertigkeiten vermittelt werden können (vgl. «Lehren, Lernen, Arbeiten»). Diese Kompetenzen sind auch im Büro hilfreich. Gemäss einem Forschungsprojekt der Hochschule Luzern empfinden viele Mitarbeitende ihr Büro als zweites Zuhause – mit vergleichbaren Ansprüchen an Privatheit und Beeinflussbarkeit des nächsten Umfelds. Die Studie formuliert entsprechende Empfehlungen für Neu- und Umbauten (vgl. «Das optimale Büro?»). Für Rückzugsmöglichkeiten plädiert auch der Zürcher Büroentwickler Toni Lengen. Im Gespräch betont er den Wert der Regeneration für die Steigerung der Produktivität und die Bedeutung der Büros als Ausdruck der Firmenkultur (vgl. «Wo die Firma zu Hause ist»).
Tina Cieslik
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Ökoquartier in La Jonction, Genf
14 PERSÖNLICH
Hans Rudolf Wymann: «Ich war 17 Jahre Polizeioffizier»
17 MAGAZIN
Wie arbeiten Ingenieure in Europa? | Gute Wärmedämmung und Haustechnik | Bauen mit Strohballen | Zürcher Verkehrsvisionen | Preis für einen Alien | Alterswohnungen mit Seesicht | Bücher
28 «WO DIE FIRMA ZU HAUSE IST»
Tina Cieslik
Die Mehrheit aller Schweizer -Angestellten arbeitet heute in Büros. Ein -Gespräch mit Büroplaner Toni Lengen zu Firmenkultur, Rege-nerationsfähigkeit und zum Statussymbol Einzelbüro.
35 DAS OPTIMALE BÜRO?
Sibylla Amstutz, Peter Schwehr
Eine Studie der Hochschule Luzern hat untersucht, wie Büros beschaffen sein müssen, um den Bedürfnissen der Mitarbeitenden und der Firmen gerecht zu werden.
39 LEHREN, LERNEN, ARBEITEN
Katja Hasche
Die Fachschule Viventa in Zürich ist eine Schule für «Hauswirtschaft und Lebensgestaltung». Nun wurde der Bau aus den 1960er-Jahren saniert.
50 SIA
Geschäftslage im 1. Quartal 2010 | Umsicht – Regards – Sguardi 2011 | «Pfusch am Bau – wer ist schuld?»
55 PRODUKTE
58 FIRMEN
69 IMPRESSUM
70 VERANSTALTUNGEN
«Wo die Firma zuhause ist»
Das Büro ist längst ein Synonym für den Arbeitsplatz geworden. Etwa zwei Drittel aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Schweiz arbeiten heute in Büros. Aber obwohl 10 % der Gesamtbürofläche in der Schweiz leer stehen, werden weiterhin Büros gebaut. Was muss das Büro der Zukunft können, und wie sieht die Beziehung Mensch – A rbeitsplatz aus? Ein Gespräch mit Toni Lengen vom Zürcher Büroentwickler und -planer OFF Consult.
TEC21: Was sind momentan die Hauptbedürfnisse Ihrer Kunden? Gibt es einen Wandel vom Repräsentationsbedürfnis zu Aspekten wie Gesundheit oder Steigerung der Produktivität?
Toni Lengen: Die Steigerung der Produktivität ist nach wie vor ein Thema – allerdings kein lautes. Die Ressource Arbeitskraft, vor allem die der hoch qualifizierten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ist in der Schweiz sehr wertvoll. Es wird also nichts umgesetzt, was die Mitarbeitenden verärgern könnte. Das macht es schwierig, unkonventionelle Ideen zu realisieren. Wir glauben, dass in der Schweiz mit leer stehenden Büroarbeitsplätzen eine immense Fläche vergeudet wird. Das Einzelbüro ist immer noch ein Statussymbol, obwohl es das hierarchische Büro praktisch nicht mehr gibt.
TEC21: Wie sind Ihre Erfahrungen mit offenen, multipel genutzten Flächen?
TL: Im Gegensatz zu den Grossraumbüros der 1970er- und 1980er-Jahre, bei denen die Motivation darin lag, Kosten zu sparen, sind die Erfahrungen dort, wo man bewusst geplant hat, positiv. Eines der wichtigsten Themen in der Büroplanung ist die Kommunikation. Wir glauben, dass die Ressource ‹Mitarbeiter-Know-how› riesig ist und in vielen Betrieben dennoch schlecht genutzt wird. Eine ideale Formel für eine offene Fläche ist die Teamgrösse. Zwar kann eine offene Fläche mehrere Teams beherbergen, aber die Zonen sollten gegeneinander abgegrenzt sein. Eine Teamgrösse um die 15 Leute ist optimal: Die Leute sollen sich miteinander unterhalten können, um voneinander zu profitieren.
TEC21: Wie liesse sich diese Ressource besser nutzen, ausser über solche offenen Flächen?
TL: Es ist eine ganze Kette von Massnahmen, die zum Tragen kommen muss. Dazu gehören klassische Aspekte wie Mitarbeiterführung, Aus- und Weiterbildung und ein langfristiges Personalmanagement. Weitere Elemente sind die Infrastruktur und das Büro. Nach unserer Meinung mit offenen Zonen – aber intelligenten offenen Zonen. Natürlich spielen auch die Prozesse eine Rolle. Wie unterstützt man diese, damit eine optimale Zusammenarbeit möglich ist?
TEC21: Entspricht es dem Wunsch der Firmen, die Prozesse auch durch bauliche Massnahmen zu optimieren, indem man das Organigramm eines Betriebes räumlich umsetzt?
TL: Wir haben einige Kunden, bei denen wir sogenannte ‹One-Roof-Konzepte› umgesetzt haben, die im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und auch bessere Arbeitsstrukturen sinnvoll waren. Es kann aber durchaus sein, dass gewisse Unternehmenseinheiten an einem anderen Standort gut aufgehoben sind. Auch bei den einfachsten Projekten werden zunächst die Arbeitsabläufe betrachtet. Bei der vertieften Betrachtung werden die Prozesse der einzelnen Abteilungen miteinander abgestimmt, um beurteilen zu können, welche Struktur am besten funktioniert. Auch wenn in bestimmten Positionen ein Einzelbüro sinnvoll ist, denken wir, dass Multi-Space-Büros eine Zukunft haben. Die Menschen werden den persönlichen Kontakt immer schätzen – aber nicht jederzeit. Deswegen müssen auch Rückzugsmöglichkeiten angeboten werden.
Der Kontakt zwischen den Mitarbeitern wird auch bei der Diskussion um Home-Office und mobile Arbeitsplätze unterschätzt. Die Sozialisation als Teil jeder Firmenkultur lässt dort eine Firmenidentität entstehen, wo das Unternehmen daheim ist. Das ist in der Regel ein Haus, ein Ort, eine Adresse. Wir haben eine Firma betreut, die mit ‹virtuellen› Büros angefangen und jetzt wunderschöne Büroräume bezogen hat. Dabei handelte es sich um eine Neugründung, die sich aus verschiedenen Konstellationen heraus entwickelt hat. Man merkte jedoch schnell, dass es irgendwo eine Postadresse geben muss, rechtlich gesehen braucht es einen Firmensitz. Selbstverständlich ist aber auch eine Kombination möglich: Home-Office oder Satellitenbüros sind grosse Themen. Die Büroimmobilie wird trotzdem nie aussterben.
TEC21: Der Internet-Suchdienst Google bietet seinen Mitarbeitern am Standort Zürich unkonventionelle Arbeitsplatzumgebungen. Wird diese Philosophie als Trendsetter betrachtet oder eher als exotisch gesehen?
TL: Ich denke nicht, dass dies Trendsetter sind. Büros haben heute stark mit Recruiting und Marketing zu tun; zum einen auf der Kundenseite, aber auch, wenn es um zukünftige Mitarbeiter geht. Google hat bewusst einen Weg gesucht, über ihre Büroinfrastruktur bestimmte Leute anzusprechen. Sie haben einen sehr werbewirksamen Auftritt gewählt, die Arbeit muss aber auch dort mehrheitlich an einem ganz normalen Arbeitsplatz erledigt werden. Das Angebot wird zwar genutzt, aber nicht von einer breiten Masse.
Das ist eine Erfahrung, die auch wir machen: Bietet ein Kunde im Rahmen eines Gesundheitskonzeptes Regenerationsmöglichkeiten an, wird immer nur ein kleiner Teil der Belegschaft solche Angebote nutzen. Viele Leute kann man gar nicht ansprechen. Sie sind der Meinung: Ich gehe arbeiten, mehr brauche ich nicht.
Um aber auf die Produktivität zurückzukommen: Das Fraunhofer-Institut in Stuttgart hat eine Studie dazu gemacht, die auch die Frage der Regeneration aufwirft.[1] Die Wissensarbeit ist komplexer als vor dreissig Jahren, als es repetetive Arbeit gab, die heute der Computer übernommen hat. Man ist anders gefordert, arbeitet in anspruchsvollen Jobs auch tendenziell länger. Es muss daher sensibel beobachtet werden, wie die tatsächliche Produktivität der Menschen aussieht. Die Studie zeigt, dass bei einem Achtstundentag nur während sechs Stunden tatsächlich produktiv gearbeitet wird.
Wenn man es also schafft, von diesen zwei Stunden unproduktiven Arbeitens noch eine Stunde produktiv zu leisten, würde dies eine enorme Steigerung der Effektivität bedeuten. Die Regeneration zur Steigerung der Leistungsfähigkeit müsste Teil der Firmenkultur werden. Leider ist das heute noch nicht so. Auch bei Firmen, die mit unseren Angeboten konform gehen, ist die Mentalität immer noch: Ich gehe zum Arbeiten ins Büro, nicht zum Schlafen. Wenn man während der Arbeitszeit Entspannungszeiten einschiebt, wird das als Zeichen von Schwäche interpretiert.
TEC21: Das liegt möglicherweise auch an der Art, wie solche Angebote präsentiert werden und ob sie Teil der Unternehmenskultur sind.
TL: Wir erleben oft während eines Projektes, dass wir auf solchen Konzepten nicht bestehen können. Sie würden nicht funktionieren, weil sie nicht zur Unternehmenskultur passen. Wir haben z. B. in einer Firma Stehkonferenztische eingebaut. In diesem Fall kam etwa zeitgleich ein neuer CEO, der das ganze Konzept verworfen hat. Bei solchen Projekten weiter Druck zu machen, würde an der Unternehmenskultur vorbeigehen. Früher ging es sehr stark um den grossen Wurf. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht funktionieren kann, wenn der Mensch einer Entwicklung nicht folgen kann.
TEC21: Werden von Ihnen nach einiger Zeit Evaluationen der Projekte durchgeführt, der Soll- mit dem Ist-Zustand verglichen?
TL: Das ist durchaus üblich, vor allem bei Projekten, die wir substanziell mit- oder komplett neu entwickeln. Bei Firmen, die wir über lange Zeit begleitet haben, interessiert es uns natürlich, wie sich die Konzepte im Alltag bewähren. Auch dort kämpft man mit der Tatsache, dass sich das Konzept konventioneller weiterentwickelt, als wir uns das wünschen. Man schreckt noch immer davor zurück, den Vollarbeitsplatz in das System aufzunehmen und z. B. Desk-Sharing zu praktizieren. Aber auch da muss man sich mit den letzten dreissig Jahren Bürogeschichte auseinandersetzen. Damals hat man sehr konventionelle Büros gebaut. Treiber waren Optimierung der Fläche und Kosteneinsparungen, während heute eher das Knowledge-Management im Vordergrund steht. Damals wurden unter Umständen die Abteilungen auch auseinandergerissen; heute würde man wahrscheinlich eher die Wand abreissen. Das ist auch im sozialen Sinn eine positive Entwicklung.
TEC21: Im Bauen werden aktuell Nachhaltigkeitsthemen wie Energiesparen oder baubiologisch korrekte Materialien stark diskutiert. Ist das in der Büroplanung ein Thema?
TL: Absolut. Wobei man sagen muss, dass bei Herstellern und Lieferanten von Büroeinrichtungen lösungsmittelfreie Farbe und Lacke längst dem Standard entsprechen. Andererseits ist es erstaunlich, wie leichtfertig man mit anderen Themen umgeht. Nachhaltigkeit ist eine Frage der Definition. Bei der Forumsveranstaltung ‹Green Office›, die wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation angeboten haben (vgl. «Das optimale Büro?», S. 35), ging es nicht nur um den Umgang mit der Energie, obwohl das ein wichtiger Faktor war. Ein nachhaltiges Büro ist nicht nur ökologisch vorbildlich ausgerichtet, sondern auch gegenüber den Mitarbeitenden. Insofern ist Gesundheit auch ein Thema der Nachhaltigkeit.
TEC21: Gibt es heute in der Büroplanung ein ‹must-have›, ein Statussymbol?
TL: Wir haben festgestellt, dass man der Konferenzinfrastruktur zunehmend wieder eine andere Beachtung schenkt, die Menschen wieder ‹zu sich nach Hause holt›. Das hat mit klassischer Gastfreundschaft zu tun, aber auch mit dem Wunsch, die eigene Authentizität erlebbar zu machen. Nach wie vor spielt auch die Architektur eine grosse Rolle. Leider ist bei der Planung die Aussen-Innen-Betrachtung immer noch wichtiger als die Innen-Aussen- Betrachtung, die wir verfechten. Spannend sind die Projekte, bei denen wir schon in der Wettbewerbsphase mit einbezogen sind und das Briefing der Architekten durchführen können. Wir hatten ein paar Mal die Chance, bei der Erstellung des Betriebsprogramms die Anforderungen an die Primärstruktur mitzudefinieren. Diese Betrachtung entspricht dem Menschen auch besser. Nicht alles, was schön ist, ist auch dienlich, um darin zu arbeiten. Andererseits gibt es einen wachsenden Kreis von Architekten, der durchaus einsieht, dass es die sogenannten ‹work environment specialists› genauso braucht wie den Tragwerksplaner oder den Sanitäringenieur.
TEC21: Gibt es durch die wachsende Durchmischung der Arbeitswelt – z. B. durch die zunehmende Internationalisierung oder durch eine höhere Anzahl von Frauen in Führungspositionen – einen Wandel der Bedürfnisse?
TL: Diese Frage ist mir zuletzt im Zusammenhang mit älteren Mitarbeitern gestellt worden. Der Unterschied der Generationen ist in den Büros bald nicht mehr so riesig. Der 65-jährige Mitarbeiter arbeitet mit der gleichen Infrastruktur und benutzt die gleichen Kommunikationswege wie die Jungen. Es gibt körperliche Aspekte, die man berücksichtigen muss, z. B. dass ausreichend Licht vorhanden ist, dass man unter Umständen lärmempfindlicher ist. Diese Bedürfnisse müssen ernst genommen werden.
Was das Internationale anbelangt, wird künftig eher eine Rolle spielen, in was für einem Umfeld eine Firma steht, in der Stadt oder auf der grünen Wiese. Mit tendenziell jüngeren Mitarbeitern befindet man sich besser in einer urbanen Umgebung. Hier kommt auch das Umfeld insgesamt zum Tragen: Gibt es Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten, ein kulturelles Angebot, Betreuungsangebote für Kinder? Ein Bürohaus kann heute nicht mehr isoliert betrachtet werden. Im Gegenteil: Gerade auf der grünen Wiese werden ergänzende Dienstleistungen um den Arbeitsplatz immer wichtiger. Dazu gehören die Reinigung der Kleider oder Convenience-Angebote zur Verpflegung ausserhalb der Öffnungszeiten der Kantine.
TEC21: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
TL: Eines unserer wegweisenden Projekte ist PricewaterhouseCooper in Zürich Oerlikon. PwC ist ein Multi-Space-Konzept, das wir ganzheitlich bearbeiten konnten. Ursprünglich wurde die Arealüberbauung zusammen mit ABB-Immobilien entwickelt. Wir haben den Grundausbau auf der Mieterseite begleitet sowie den ganzen Innenausbau geplant und realisiert. Themen waren u.a. die Gesundheit und die Mobilität. Das Mobilitätskonzept wurde gemeinsam mit einem darauf spezialisierten Ingenieurbüro entwickelt. Leider wurde es dann nicht im geplanten Umfang umgesetzt.
TEC21: Wie sah dieses Konzept aus?
TL: Es sollte kostenneutral realisiert werden, und bei der Summe wurde von den Subventionen für die Parkplätze ausgegangen. Dieser Betrag wurde neu verteilt. Die wenigen Parkplätze, die es gab, waren nicht mehr so günstig, dafür hätten alle Mitarbeitenden einen Beitrag an das Abonnement für den öffentlichen Verkehr erhalten. Dass sich das Konzept letzten Endes nicht durchsetzte, hatte auch mit der Rekrutierung von neuem Personal zu tun. Solange Studienabgänger ihre Prioritäten auf Einzelbüro und reservierten Parkplatz setzen, hat ein solches Konzept keine Chance.
TEC21: Die Unternehmen könnten so ein Konzept ja auch zu Marketingzwecken nutzen, um sich als nachhaltige Firma zu positionieren.
TL: Dies geschieht auch zunehmend. PricewaterhouseCoopers hat beispielsweise viel Neues gewagt, ist aber trotzdem ein eher traditionelles Unternehmen mit konservativer Kundschaft. Allzu progressive Ideen würden als Schwäche ausgelegt, nicht als Stärke – zumindest damals beim Bezug der neuen Büros. Unsere Welt ist nach wie vor geprägt von einer gewissen Bequemlichkeit.
TEC21: Welches sind die Zukunftsvisionen in der Büroplanung?
TL: Es wird erst dann im Büro einen Quantensprung geben, wenn die Technologie wieder einen Quantensprung macht, so wie das mit der Einführung der Desktop-Computer geschehen ist. Es gibt spannende Innovationen wie Digitalstrom, bei dem sich Daten über das bestehende Stromnetz übertragen lassen.[2] Das sind allerdings Neuerungen, die den Mitarbeitenden im Arbeitsprozess nicht unbedingt tangieren. Man wird sicher auch stärker versuchen, Nachhaltigkeitsziele wie die der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen. Ich denke, der ganzheitliche Ansatz wird zunehmend zum Tragen kommen, zum Beispiel das Thema ‹Wohnen und Arbeiten› in einer vernünftigen Entfernung, zum Beispiel in Velodistanz.
[Gesprächspartner: Toni Lengen, Inhaber und Seniorconsultant OFF Consult AG, Zürich (www.offconsult.ch). Seit 26 Jahren im Bürobereich tätig, 20 Jahre davon selbstständig mit der Innovationsplattform Office LAB AG, www.officelab.ch]
Anmerkungen:
[01] Empirische OFFICE-21-Studie «Office Performance», Fraunhofer IAO, Stuttgart, 2002, www.office21.de/forschung/office_performance.htm
[02] Digitalstrom ist ein Bus-System zur Steuerung und Überwachung elektrischer Verbraucher über das vorhandene Stromnetz. Das System wurde an der ETH Zürich entwickeltTEC21, Fr., 2010.05.28
28. Mai 2010 Tina Cieslik
Das optimale Büro?
Die räumliche Situation hat einen massgebenden Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden an Büroarbeitsplätzen. In einem Forschungsprojekt der Hochschule Luzern wurde untersucht, welche Faktoren die Zufriedenheit und damit die Produktivität der Büroarbeitenden beeinflussen und wie ein Büro konzipiert sein muss, damit es gleichzeitig auch den Anforderungen der Unternehmen genügt. Daraus wurden Empfehlungen für die Planung von Neu- und Umbauten formuliert.
5.1 Mio. m2 Bürofläche stehen in der Schweiz leer. Trotzdem wird rege neu gebaut – immerhin 500 000 m² Bürofläche kamen im Jahr 2007 hinzu.1 Der Leerstand ist ein Indiz für mangelnde Anpassungsfähigkeit der Immobilien an die neuen Ansprüche der Arbeitswelt: Die Mitarbeitenden können darin ihr Leistungspotenzial nicht mehr optimal entfalten. Die Unternehmen beklagen die geringe Leistungsfähigkeit der Gebäude bei oft teurem Unterhalt. Wie muss ein Bürogebäude konzipiert sein, damit es den Anforderungen eines Unternehmens genügt und gleichzeitig optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden bietet? Dieser Frage ging das Forschungsprojekt «human building office» nach. Durchgeführt wurde das im Sommer 2009 abgeschlossene Projekt vom Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur der Hochschule Luzern – Technik & Architektur in Zusammenarbeit mit dem Institut für Facility Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Da die Thematik weit über architektonische Aspekte hinausgeht, waren auch Wissenschafter und Wissenschafterinnen aus den Bereichen Wirtschaft, Soziale Arbeit sowie ein Arbeitspsychologe beteiligt.
Für das Forschungsprojekt wurden vier Fokusbereiche festgelegt, die den Faktor Mensch und die Ansprüche einer zeitgemässen Unternehmenskultur an das System Büro in den Mittelpunkt stellen (Abb. 1 bis 4): Einfluss auf die physische und die psychische Gesundheit, Unterstützung von Kommunikationsprozessen, Flexibilität in der Struktur sowie Diversität, das heisst Berücksichtigung unterschiedlicher Fähigkeiten und Bedürfnisse der Nutzenden. Untersucht wurden 46 Bürogebäude von 26 Unternehmen und Behörden. Die Bürotypen umfassten Zellenbüros, Grossraumbüros bis hin zum Multispace. Diese Büros wurden von den Forschenden vor Ort begutachtet und mittels eines Katalogs aus 120 Kriterien zu den vier Faktoren Standort, Gebäude, Raum und Arbeitsplatz beurteilt. Zudem wurden insgesamt 1400 Mitarbeitende zur Zufriedenheit mit der Büroumgebung und zu ihrer Gesundheit befragt sowie die Geschäftsleitung zu ihren Anforderungen an Bürogebäude und zur aktuellen Situation.
Mitarbeitende wollen «Einfluss nahme» und «Privatheit»
Die Befragung der Unternehmen ergab, dass die Unterstützung von Kommunikations- und Gesundheitsaspekten generell als am wichtigsten bewertet wurden. Flexibilität und Diversität nimmt bei den befragten Unternehmen einen geringeren Stellenwert ein. Der Vergleich mit der aktuellen Situation zeigte auf, dass die Bürogebäude den Ansprüchen der Unternehmen oftmals nicht genügen. Als entscheidend für die Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden im Büro stellten sich die Faktoren «Einflussnahme» und «Privatheit» heraus. Mit Privatheit ist die Möglichkeit zur Regelung von sozialer Nähe und Distanz gemeint; sie beinhaltet also die Möglichkeit, sich gegenüber sozialen Interaktionen zu öffnen (beispielsweise um Informationen auszutauschen) oder sich von diesen zurückzuziehen (z. B. um ungestört zu arbeiten oder um vertrauliche Gespräche zu führen). Einflussnahme (Kontrolle) umschreibt die Möglichkeiten, die Arbeitsumgebung und den funktionalen Komfort (Licht, Klima, Gestaltung des Arbeitsplatzes) zu verändern und zu modifizieren, sodass sie die Arbeit unterstützen.
Je mehr Personen sich im Büroraum aufhalten, desto geringer sind Privatheit und Einflussnahme. Im Gegenzug nehmen mit der Anzahl Personen Lärm, Ablenkungen und Störungen zu, die wiederum einen direkten negativen Einfluss auf die Gesundheit und die Zufriedenheit ausüben (Abb. 5) und für die Unternehmen damit Kosten durch Produktionsausfall verursachen.
Über 70 % aller Befragten sind «oft bis immer» durch Geräusche und Gespräche abgelenkt (Abb. 6).2 Die Gründe für die akustischen Ablenkungen sind hauptsächlich Gespräche zwischen Kolleginnen und Kollegen sowie Telefongespräche. Dadurch werden 65 % der Befragten «oft bis immer» während der Arbeit gestört. Bei den visuellen Ablenkungen sind es immer noch über 40 % der Befragten, die sich dadurch gestört fühlen. Dies wirkt sich auf die Konzentration und damit auf die Leistungsfähigkeit aus. Fast 40 % geben an, dass sie dadurch «oft bis immer» Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Bei 49 % der Befragten fehlen Räume für spontane Besprechungen und bei 61 % auch die Möglichkeit, sich für ungestörtes Arbeiten zurückzuziehen.
Kombibüro wird am besten bewertet
So ist es denn auch nicht erstaunlich, dass die klassischen Einzelbüros (Abb. 7) in der Studie in Bezug auf Gesundheit und Zufriedenheit gut abschneiden, denn die Mitarbeitenden haben genügend Privatheit und Einflussmöglichkeiten an ihrem Arbeitsplatz. Allerdings entspricht dieser Bürotyp nicht den Anforderungen vieler Unternehmen, die den spontanen Wissensaustausch durch die Bürostruktur fördern möchten. Zudem ist die Bürostruktur durch die starr eingezogenen Wände wenig flexibel, um an geänderte Bedürfnisse der Unternehmen angepasst zu werden. Ein weiterer negativer Aspekt ist der hohe Raumbedarf und die dadurch grossen Flächenkosten pro Arbeitsplatz.
Der Bürotyp, der sowohl die Kommunikation unterstützt als auch Rückzug und damit Privatheit ermöglicht, ist das Kombibüro (Abb. 8). Dieses besteht aus Zellenbüros. Gegenüber der klassischen Zellenbürostruktur ist die Korridorzone jedoch verbreitert und enthält verschiedene Zonen, die für Teamarbeit oder spontane Besprechungen genutzt werden können. Die Wände zwischen den Büros und der Mittelzone sind verglast. Sie ermöglichen dadurch den Sichtkontakt und dienen der besseren Belichtung. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen, dass dieser Bürotyp in Bezug auf Zufriedenheit mit der Arbeitsumgebung, der Kommunikation, der Privatheit und der Einflussnahme am besten bewertet wird.
Multispace-Büros schneiden am schlechtesten ab
Klassische Gruppen- und Grossraumbüros unterstützen durch die offene Struktur die Kommunikation zwischen den einzelnen Mitarbeitenden und den Teams. Die Raumstrukturen sind vielfältig und flexibel nutzbar. Allerdings schneiden sie schlechter ab hinsichtlich Lärm, Ablenkungen und Störungen. Zwar wird durch immer besser schallgedämmte Gebäudehüllen und die immer leiseren Geräte der Grundschallpegel niedriger, dadurch werden aber die menschlichen Stimmen als umso störender empfunden. Zudem haben die Mitarbeitenden in diesem Bürotyp wenig Privatheit und Einflussmöglichkeiten z. B. auf Licht und Temperatur. Multispace-Büros sind eine spezielle Ausformung eines Gruppen- oder Grossraumbüros. Mit diesem neuen Konzept, das Kommunikation und Teamarbeit ins Zentrum stellt, wird versucht, ein möglichst angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. Die Bürofläche ist in eine Vielzahl von Arbeitsorten und -flächen gegliedert, die eine breite Spanne an Tätigkeiten ermöglichen: Arbeiten (allein oder im Team), Erholen, Kommunizieren, Nachdenken oder sogar Wohnen (Abb. 9). Die Layouts dieser Multispace-Konzepte können sehr unterschiedlich sein, was schliesslich über deren Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Im hiervorgestellten Forschungsprojekt schnitten Multispace-Bürokonzepte erstaunlicherweise bei der generellen Zufriedenheit und der Gesundheit der Mitarbeitenden noch schlechter ab als Grossraumbüros. Eine mögliche Ursache dafür ist die unmittelbare Nähe von offenen Kommunikations- und Arbeitsplatzflächen, die auch bei diesem Bürolayout zu Störungen und Ablenkungen führen kann. Besser ist es, die Kommunikationsflächen zusammenzufassen oder akustisch abzutrennen.
Regeln für die Planung: Sitz-, Lauf- und Rede-Typen trennen
Das perfekte Bürokonzept, das für jedes Unternehmen Geltung hat, gibt es nicht. Es gibt jedoch Regeln, die bei der Planung berücksichtigt werden können, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich optimal arbeiten lässt. In einem Bürogebäude arbeiten Mitarbeitende mit unterschiedlichen Funktionen und Tätigkeiten zusammen. Dabei sind die Tätigkeiten stärker bestimmend für die Gestaltung arbeitsgerechter Büroräume als die Funktion. Die Störpotenziale entstehen in offenen Bürostrukturen wie Gruppen- und Grossraumbüros dadurch, dass Kommunikation und konzentrierte Arbeit einen Zielkonflikt bilden. Bei der Planung und Einrichtung von Bürolayouts ist deshalb ein spezielles Augenmerk auf die Tätigkeiten zu legen. Diese lassen sich grob in drei Typen einteilen: Der Sitz-Typ, der sich mehrheitlich am Arbeitsplatz aufhält und wenig telefoniert, der Lauf-Typ, der sehr viel im Büro unterwegs ist, und der Rede-Typ, der sehr viele Telefonate und Sitzungen hat. Die drei Mitarbeitenden-Typen haben unterschiedliche Anforderungen an das räumliche Umfeld und das Raumangebot. Eine Analyse der Mitarbeitenden- Typen ist deshalb bei der Planung des Bürolayouts unabdingbar. Ein auf sie abgestimmtes Raum- und Arbeitsplatzangebot trägt wesentlich dazu bei, Störungen zu verhindern und damit die Produktivität der Mitarbeitenden zu unterstützen. Ein vielfältiges Angebot an Räumlichkeiten ermöglicht es, den je nach Tätigkeit passenden Ort aufzusuchen (Abb. 10), z. B. für Teamarbeit, laute Telefonate, konzentriertes Arbeiten. Je grösser und je vielfältiger das Raumangebot ist, das zur Verfügung steht, desto zufriedener sind die Mitarbeitenden mit der Arbeitsumgebung, weil dies den Bedürfnissen nach Privatheit und Einflussnahme entgegenkommt. Bei der Konzeption der Räumlichkeiten ist darauf zu achten, dass diejenigen, die an ihren Büroarbeitsplätzen arbeiten, so wenig wie möglich gestört und abgelenkt werden. Für Team- und Projektarbeit sind deshalb Gruppenarbeitsräume einzuplanen. Für konzentriertes Arbeiten oder private Gespräche sind akustisch abgetrennte Einzelarbeitsräume anzubieten. Kaffee- oder Kopierzonen dienen oftmals für spontane Besprechungen. Damit an diesen Orten Gespräche möglich sind, ohne andere Arbeitskollegen und -kolleginnen zu stören, sind diese von den Arbeitsplätzen akustisch und optisch abzutrennen. Die Möglichkeit für einen Powernap in einem Ruheraum fördert die Konzentration und berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse und körperlichen Verfassungen der Mitarbeitenden.
Das Forschungsprojekt «human building office» zeigte, dass die Situation an den Büroarbeitsplätzen für die Unternehmen und die Mitarbeitenden generell nicht optimal ist. Unternehmen und Investoren müssen daher das grösste Augenmerk dem Konflikt zwischen Flächenkosten und Produktivität der Mitarbeitenden schenken. Nur so können im Sinne der Nachhaltigkeit Lösungen für zukunftsfähige Bürogebäude gefunden werden, in denen die Mitarbeitenden ihr Leistungspotenzial optimal entfalten können und ihre physische und psychische Gesundheit nicht beeinträchtigt wird.
Aus den Untersuchungen im Forschungsprojekt wurde ein Planungstool erstellt. Dies dient den beteiligten Wirtschaftspartner/innen bei Neu- und Umbauten dazu, die nötigen Zielvereinbarungen mit ihren Kunden und Kundinnen zu treffen. Damit können geeignete Strukturen und optimale Arbeitsbedingungen, die den Anforderungen der Unternehmen und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden entsprechen, gewährleistet werden.
Anmerkungen:
[01] Credit Suisse: Economic Research. Immobilienmarkt 2008. Fakten und Trends. Zürich; 2008
[02] Durchschnitt über alle untersuchten BürotypenTEC21, Fr., 2010.05.28
28. Mai 2010 Peter Schwehr, Sibylla Amstutz