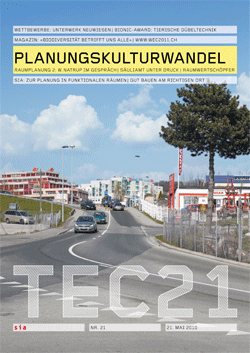Editorial
TEC21 widmet dieses Jahr vier Ausgaben der Raumplanung. Die erste vom 5. März hiess «Die Schweiz wird knapp» und lieferte einen Überblick über Geschichte und aktuelle Aufgaben der Raumplanung in der Schweiz. Das hier ist die zweite Nummer.Sie beschäftigt sich mit der Planungskultur. Denn dass wir schleunigst etwas an der Art und Weise ändern müssen, wie wir mit der Landschaft und den natürlichen Ressour-cen umgehen, ist nicht nur Fachleuten klar, sondern dämmert offensichtlich auch immer mehr Bürgerinnen und Bügern.
Die Schweizer Raumplanung hat Topqualität im internationalen Vergleich. Trotzdem ist sie gescheitert, wenn man sie an den Ansprüchen misst, mit denen sie angetreten ist: Zwar hat jede Gemeinde einen sauberen Zonenplan – das ist viel wert, aber es tröstet nicht darüber hinweg, dass immer noch jedes Jahr Kulturland von der Grösse des Zugersees unter Beton und Asphalt verschwindet. Als ob wir eine zweite Schweiz hätten, wenn die erste überbaut ist. Und nach wie vor nimmt die Biodiversität ab, als ob wir neue Pflanzen und Tiere importieren könnten, wenn unsere ausgestorben sind.
Nachhaltige Raumentwicklung ist gefragt, in ökologischer Hinsicht sowieso, aber auch in kultureller. Was wäre ein kulturell nachhaltiger Raum? Landschaften und Ortsbilder, Gebäude und öffentliche Räume, die so schön sein müssten, dass unsere Nachfahren sie bewahren möchten. Das wird nur geschehen, wenn sie sich mit den Orten, die wir schaffen, identifizieren werden. Damit man sich aber mit einem Ort identifizieren kann, muss dieser zuerst einmal identifizierbar sein. Machen Sie den Test: Betrachten Sie die Fotos von Hannes Henz in diesem Heft und bestimmen Sie die Gemeinde, wo sie aufgenommen wurden (oder die Agglomeration oder wenigstens den Landesteil). Schwierig zu identifizieren? Dabei sind die Bilder doch vertraut. Vertraut und doch nicht Heimat?
Nachhaltige Räume wären also einmalige Räume: ortstypisch (aus der lokalen Geschichte abgeleitet) und ortsspezifisch (auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten). Wie man diese Qualität erreichen kann, davon handeln die Beiträge in dieser Nummer: Der neue Zürcher Kantonsplaner Wilhelm Natrup möchte Planungsregionen und Gemeinden vermehrt bei konkreten Projekten unterstützen und hofft, über diese guten Beispiele flächendeckend eine hohe Baukultur zu erreichen – das Planungsamt würde zum Amt für Baukultur. Hugo Wandeler erzählt aus dem Knonauer Amt, wo es gelungen ist, die Gemeinden an einen Tisch zu bringen und die Region gemeinsam auf den Siedlungsdruck vorzubereiten, den die neu eröffnete A4 bringen wird. Thom Held blickt in die Zukunft und sieht eine Planungskultur, die bleibende Werte hervorbringt und kreativ ist, weil sie sich für öffentliche Diskurse und neue Disziplinen öffnet.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Unterwerk Neuwiesen | Bionic-Award: Tierische Dübeltechnik
10 PERSÖNLICH
Claude Martin: «Biodiversität betrifft uns alle»
12 MAGAZIN
www.wec2011.ch | Haus der Religionen Bern | Ticino-Delta wird aufgewertet
18 «EIN AMT FÜR RAUMENTWICKLUNG UND BAUKULTUR»
Lukas Denzler, Ruedi Weidmann
Mehr Qualität dank guten Beispiele: Der neue Zürcher Kantonsplaner Wilhelm Natrup will Planungsregionen und Gemeinden bei der Projektentwicklung unterstützen. Das Interview.
24 SÄULIAMT UNTER DRUCK
Hugo Wandeler
Die S-Bahn hatte im Knonauer Amt einen Bauboom ausgelöst. Auf die Eröffnung der A4 hat es sich nun planerisch besser vor-bereitet. Der Erfahrungsbericht.
28 RAUMWERTSCHÖPFER
Thom Held
Wenn die Raumplanung Nachhaltigkeit und mehr Werthaltiges schaffen soll, muss sie kreativer werden und sich anderen Diszipli-nen und dem öffentlichen Diskurs öffnen. Die Vision.
34 SIA
Zur Planung in funktionalen Räumen | Gut bauen am richtigen Ort
39 FIRMEN
45 IMPRESSUM
«Ein Amt für Raumentwicklung und Baukultur»
Wilhelm Natrup, der neue Zürcher Kantonsplaner, äussert sich im Gespräch zu den Herausforderungen der Raumentwicklung. Er ist überzeugt, dass ein Diskurs über die räumliche Entwicklung notwendig ist, und möchte Planungsregionen und Gemeinden vermehrt bei der Gebietsentwicklung unterstützen.
TEC21: Die Probleme und Herausforderungen der Raumplanung sind bekannt. Wie gross ist der Spielraum der Raumplanung? Kann sie Akzente setzen?
Wilhelm Natrup: Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass man mit Raumplanung Akzente setzen kann und auch setzen muss. Raumplanung ist zwar auch eine administrative und verwaltungstechnische Angelegenheit, insbesondere beim Vollzug von Gesetzen und der Genehmigung von Plänen. Viel wichtiger aber ist, dass wir mit der Raumplanung Themen anpacken, die für die räumliche Entwicklung wichtig sind, und darüber diskutieren.
TEC21: Gibt es angesichts der übergeordneten Trends wie Globalisierung, Mobilität und Freizeit überhaupt gestalterische Freiräume?
WN: Ja, ich sehe Freiräume für Gestaltung. Wir müssen aber Raumplanung wieder offensiv denken. Und wir müssen aktiv auf andere Ämter und Direktionen zugehen, die mit ihrem Handeln grosse Auswirkungen auf die Raumentwicklung haben. Unsere Aufgabe als das für die Raumordnung zuständige Amt ist es, die Vorstellung der Gesamtentwicklung einzubringen, das themenübergreifende Denken zu fördern, Kooperationen innerhalb der kantonalen Verwaltung herbeizuführen und integrierte Konzepte zu entwickeln.
TEC21: Die Bevölkerung in der Region Zürich ist in den letzten 20 Jahren stark gewachsen, und dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Wie soll und kann man damit umgehen?
WN: Die demografische Entwicklung ist tatsächlich einer der wichtigsten Treiber. Wir werden gemäss Prognosen in den nächsten 20 Jahren im Kanton Zürich noch einmal bis zu 200 000 Einwohner mit dazugehörenden Arbeitsplätzen und Infrastruktur unterbringen müssen – das entspricht zwei Mal der Stadt Winterthur. Und das alles unter der Prämisse, dass wir das Siedlungsgebiet nicht mehr ausdehnen wollen. Wir müssen deshalb mit den Gemeinden über die Akzeptanz von Dichte diskutieren. Wir müssen aufzeigen, wie und wo eine Siedlungsentwicklung nach innen erfolgen kann.
TEC21: Weshalb ist es bisher nicht gelungen, eine griffige Raumplanung umzusetzen?
WN: Wenn man sagt, die Raumplanung habe versagt, so ist es meistens den Fachleuten nicht gelungen, die Politik von bestimmten Leitbildern und Entwicklungen zu überzeugen. Einzelentscheidungen auf den einzelnen Planungsebenen sollten nicht nur aus einer kurzfristigen lokalen Optik erfolgen, sondern immer auch aus einer Gesamtbetrachtung. In diesem Spannungsfeld wird die Raumplanung immer stecken. Es wird immer Einzelentscheidungen geben, die die gesamten Linien nicht im Fokus haben. Aber die Richtung der wesentlichen Entscheidungen, die muss einfach stimmen.
TEC21: Was muss sich ändern, damit wir in der Raumplanung vorwärtskommen?
WN: Wir müssen davon wegkommen, dass Raumplanung der Zusammenzug von 171 Ortsentwicklungen ist – so viele Gemeinden haben wir im Kanton Zürich. Die Gemeinden müssen aufhören, nur in ihrem Gemeindegebiet zu denken. Es braucht eine regionale Abstimmung. Ich befürworte die Gemeindeautonomie grundsätzlich, auch dass der Souverän auf Gemeindeebene über bestimmte Fragen mitentscheidet. Aber es dürfen keine kommunalen Entscheide gefällt werden, die den übergeordneten Interessen widersprechen. Im Kanton Zürich haben wir 11 Planungsregionen. Ich halte das für eine sehr gute Ebene zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Alle Gemeinden sind in den Planungsgruppen vertreten, und deren Aufgabe ist es, eine überkommunale Sichtweise einzunehmen. Wenn dies gelingt, wenn die dort formulierten Entwicklungsvorstellungen nicht von Kirchturmdenken geprägt sind, dann haben wir einen grossen Sprung gemacht. Es muss ein Wechselspiel sein, das dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung trägt: Der Kanton legt bestimmte Vorgaben fest, und die Regionen und Gemeinden können und sollen die vorhandenen Spielräume nutzen.
TEC21: Die Gemeinden sehen in neuen Ansiedlungen auf ihrem Gebiet Entwicklungschancen und tendieren deshalb dazu, im eigenen Interesse zu handeln. Auch dadurch erhoffte Steuereinnahmen spielen eine wichtige Rolle. Könnte ein sogenanntes regionales Siedlungsflächenmanagement, bei dem die regionale Sichtweise im Zentrum steht, weiterhelfen?
WN: Dieses Thema betrifft nicht nur die Raumplanung, sondern auch den Finanzausgleich. Unter Berücksichtigung des Finanzausgleichs lohnten sich für bestimmte Gemeinden, wenn sie ehrlich wären, Ansiedlungen eigentlich gar nicht. Wachstum galt bisher als Erfolgsausweis für Politiker, doch das stimmt gar nicht immer. Oft ergeben sich Sprungkosten – ganz offensichtlich ist das etwa, wenn ein neues Schulhaus gebaut werden muss. Für andere Gemeinden wiederum lohnt es sich zu wachsen. An zwei konkreten Beispielen versuchen wir zurzeit auszuloten, welche Chancen regionale Arbeitsplatzgebiete mit Gewerbe und Industrie bieten würden. Diese wären verkehrstechnisch ideal gelegen und würden die Dörfer kaum belasten. Dieser Prozess läuft zusammen mit dem Amt für Gemeinden. Für uns ist das ein Musterfall. Innerhalb der Region muss eine Aufgabenteilung stattfinden, wobei Vorteile und Lasten gleichmässig verteilt werden müssen.
TEC21: Die Standortgemeinden müssten von den Steuererträgen aus den Arbeitsplatzgebieten einen Teil an die anderen Gemeinden abgeben. Wäre so etwas denkbar?
WN: Ja, das könnte mit einer Vereinbarung zwischen den beteiligten Gemeinden geregelt werden.
TEC21: Welche Weichen werden in der Raumplanung derzeit auf Bundesebene gestellt?
WN: Auf Bundesebene läuft vor dem Hintergrund der Landschaftsinitiative die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG), und schon seit einiger Zeit ist man daran, das Raumkonzept Schweiz zu erarbeiten. Beim Raumkonzept wird entscheidend sein, dass dieses für sämtliche Akteure einen verbindlichen Charakter hat. Das müsste vor allem bedeuten, dass sich alle raumrelevanten Bundesämter hinter das Raumkonzept stellen, sonst bleibt es Makulatur.
TEC21: Weshalb ist der Vorschlag für ein neues Raumentwicklungsgesetz (REG) 2008/09 derart klar gescheitert? Offenbar wollen die Kantone keine Kompetenzen abgeben.
WN: Das ist schon so. Gemäss Bundesverfassung ist Raumplanung primär Aufgabe der Kantone. Das wurde beim Entwurf zum REG wohl zu wenig berücksichtigt. Man kann diese Aufgabenteilung natürlich infrage stellen, aber dann müsste man das auf Verfassungsebene ändern.
TEC21: Sind die Kompetenzen in der Raumplanung heute noch richtig verteilt? Ist die Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden angesichts der aktuellen Herausforderungen noch zukunftsfähig?
WN: Die Frage ist, wie man das lebt. Ich finde schon, dass in der heutigen Zeit die Kantonsgrenzen etwas eng gezogen sind. Eigentlich wären die funktionalen Räume die richtige Ebene, also etwa der Metropolitanraum Zürich. Da hat nun auch bereits eine Zusammenarbeit angefangen. Es wäre eine neue Qualität, wenn wir in diesen Räumen gemeinsame Konzepte und Strategien entwickeln könnten. Das muss nicht der Bund übernehmen, das würde nicht zum Staatsverständnis der Schweiz passen. Zweifellos aber brauchen wir eine Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit in Raumentwicklungsfragen. Das ist übrigens ein Planungsverständnis, das ich sehr schätze: Dass wir hier starke Kantone mit einer hohen Identität haben, die aber immer in der Lage waren, sich zusammenzuraufen und gemeinsame Interessen zu formulieren. An diese Tradition müssen wir wieder stärker anknüpfen. Das gilt sinngemäss auch für die Ebene der Regionen und Gemeinden.
TEC21: Wenn aber die Zusammenarbeit unter den Kantonen doch nicht wie erwünscht erfolgt, wäre das dann der Zeitpunkt, wo der Bund mehr Kompetenzen bekommen sollte?
WN: Ja, und zwar einfach deshalb, weil wir derart starke funktionale Verflechtungen und Abhängigkeiten in der Entwicklung haben, dass wir an Standortqualität verlieren würden, wenn wir unkoordiniert aneinander vorbeiarbeiten würden. Wir können gar nicht mehr nur innerhalb unserer Grenzen operieren, ohne uns abzustimmen. Das haben eigentlich alle erkannt. Manchmal lernt man in der Raumplanung auch durch Fehler. Es muss immer wieder mal ein ‹Galmiz› geben.
TEC21: Der Fall ‹Galmiz› hat aufgerüttelt?
WN: Ja, das hat bei vielen etwas ausgelöst. Es stellte sich die Frage, ob es richtig ist, dass eine so wichtige Frage durch eine Gemeinde in Zusammenspiel mit einem Kanton entschieden wird. Das hätte Auswirkungen auf ein viel grösseres Gebiet gehabt. So etwas wie ‹Galmiz› betrifft zweifellos auch die Nachbarkantone.
TEC21: Die Richtpläne spielen auf kantonaler Ebene und ganz allgemein in der Schweizer Raumplanung eine zentrale Rolle. Bisweilen hört man den Vorwurf, der Bund sei bei der Genehmigung der kantonalen Richtpläne zu wenig streng.
WN: Ich würde an einem anderen Punkt ansetzen. Wenn der Bund nicht klar sagt, was er will, ist es auch schwierig zu entscheiden, was genehmigt wird und was nicht. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn der Bund im Diskurs mit den Kantonen bezüglich der Mindestinhalte der Richtpläne und der Nachweise – etwa über ausgeschiedene Bauzonen oder die Verkehrsplanung in den Agglomerationen – Ziele formulieren und klare Vorgaben machen würde. Damit wäre auch sichergestellt, dass alle Kantone gleich beurteilt werden. Im Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative, also in der jetzt vorgeschlagenen RPGRevision, steht einiges drin, das in die richtige Richtung geht. Klare Zielvorgaben wären insbesondere hilfreich in Kantonen, wo Raumplanung politisch einen schweren Stand hat.
TEC21: Ein heisses Eisen sind die Reserven der Bauzonen, die in einigen Kantonen völlig überdimensioniert sind und oft auch am falschen Ort liegen. Wie steht es diesbezüglich im Kanton Zürich?
WN: Vor 30 Jahren hatten wir im Kanton wesentlich mehr Siedlungsgebiet ausgewiesen als heute. Mit jeder Richtplanrevision wurde es sukzessive zurückgefahren. Dafür braucht es aber klare Zielvorgaben und einen politischen Willen. In einem Kanton, wo die Landschaft unter Druck steht, ist das natürlich einfacher als in sehr ländlich geprägten Kantonen. Grundsätzlich wollen wir, dass die inneren Potenziale genutzt werden. Das gilt für urbane Gebiete wie für den ländlichen Raum. Gerade in den Dörfern gibt es grosse innere Potenziale; ich denke da an leer stehende Bauten, Ökonomiegebäude und Dachstöcke. Das soll genutzt werden, bevor die Dörfer über Quartierpläne erweitert werden. Hierzu bieten wir den Gemeinden auch Hilfestellung. Bei geschützten Ortsbildern gibt es auch materielle Unterstützung. Wir müssen an der Wertschätzung der Dörfer arbeiten.
TEC21: Müssen wir bei dieser Umnutzung grosszügiger sein? Und ergeben sich da nicht eine ganze Reihe von Konfliktfeldern, beispielsweise mit der Denkmalpflege?
WN: Ja, wir müssen grosszügiger sein, um die Interessen unter einen Hut zu bringen. Die Denkmalpflege ist übrigens Teil des Amtes für Raumordnung und Vermessung. Ich sage deshalb immer: Unser Amt macht Raumentwicklung und Baukultur. Wenn wir im bestehenden Siedlungsgebiet arbeiten wollen, dann müssen wir für den jeweiligen Standort im Diskurs mit den Gemeinden, den Betroffenen, der Bevölkerung konkrete Lösungen finden. Wir werden künftig viel stärker projektorientiert arbeiten. Ganz wichtig ist mir dabei die Qualität. Die Qualität der Planung muss unbedingt gesteigert werden. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wir vom Kanton wollen ein verlässlicher Partner sein, indem wir klar sagen, was für uns gute Baukultur heisst. Deshalb sind wir daran, Leitlinien zu erarbeiten, damit die Gemeinden auch wissen, was unsere Erwartungen an Quartier- und Gestaltungspläne sind.
TEC21: Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo die Zusammenarbeit heute schon spielt?
WN: In Wädenswil wurde ein Projekt für ein 50 m hohes Hochhaus am Gerbeplatz beim Bahnhof ausgearbeitet. Weil der Standort im Perimeter des geschützten Ortsbildes lag, musste die Kantonale Natur- und Heimatschutzkommission dazu Stellung nehmen – und diese beurteilte das Projekt als nicht ortsbildverträglich. Vom See her gesehen, hätte das Hochhaus die Kirche als markantes Gebäude verdeckt. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass das Zentrum von Wädenswil verdichtet werden soll. Zusammen mit der Gemeinde führen wir deshalb jetzt ein gemeinsames Studienverfahren durch, das am Beispiel des Wädenswiler Stadtzentrums aufzeigen soll, wie sich die gewünschte städtebauliche Dichte ortsbildverträglich erreichen lässt.
TEC21: Im Kanton Zürich läuft zurzeit die Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans. Nach welchen Grundsätzen wird dabei vorgegangen?
WN: Massgebend ist das kantonale Raumkonzept mit den Leitlinien für die Raumentwicklung in den entsprechenden Handlungsräumen, festgehalten im Raumplanungsbericht vom August 2009. Ich habe das von meinem Vorgänger übernommen, aber nach meinem Verständnis geht es in die richtige Richtung. Wir haben ein kommunizierbares Bild, das im Grundsatz auf hohe Akzeptanz in allen Regionen gestossen ist. Auch im Parlament ist es positiv aufgenommen worden. Wir haben fünf Handlungsräume definiert und für diese nachvollziehbare und stimmige Ziele deklariert. Das ist weitgehend unbestritten. Es wird aber immer schwieriger, je tiefer wir auf den Stufen hinunter in die einzelnen Gemeinden und zu konkreten Projekten kommen. Da müssen wir noch viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit leisten.
TEC21: Voraussichtlich 2011 kommt der Richtplan in den Kantonsrat. Über welche Themen wird gestritten werden?
WN: Im Einzelfall über Erweiterungen des Siedlungsgebiets. Die Politiker werden sich für ihre Gemeinden und Regionen einsetzen. Unsere Aufgabe wird es sein, den Konsens – insbesondere über die Konzentration der Siedlungsentwicklung – nicht auseinanderbrechen zu lassen. Ein weiteres Thema wird die Landschaft sein. Ich habe den Eindruck, dass das Bewusstsein für die Gefährdung der Landschaft in der Bevölkerung zugenommen hat. Und da haben wir ja wirklich auch etwas zu verlieren. Die Qualität im Kanton Zürich besteht in meinen Augen im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Siedlungsstrukturen und hoch attraktiven Landschaftsräumen. Die Nähe von Wohnen, Arbeit, Naherholung und Kultur ist ein entscheidender Vorteil im Standortwettbewerb.
TEC21: Welche Rolle spielt der Dialog mit der Bevölkerung?
WN: Ich bin überzeugt, dass wir einen Diskurs über die räumliche Entwicklung im Kanton brauchen und nicht nur eine Debatte im Kantonsrat. Ich spüre ein grosses Bedürfnis in Politik und Gesellschaft, wieder einmal über die Zukunft des Raums und die Zukunft von Zürich zu diskutieren, gerade auch vor dem Hintergrund der Überprüfung des Richtplans. Diese Chance möchte ich nutzen. Letztlich ist es aber der Kantonsrat, der über den Richtplan entscheidet. Dadurch erhält dieser auch eine hohe politische Legitimation.
TEC21: Gibt es Disziplinen und Stimmen, die gegenwärtig in diesem Dialog fehlen?
WN: Im meinen Augen fehlen insbesondere gesellschaftliche und soziale Themen. Das wird immer wieder mal angetippt, aber eine eigentliche Auseinandersetzung – etwa mit dem demografischen Wandel – findet nicht statt. Wie gehen wir zum Beispiel mit dem Thema Alter um? Wir sind in der Planung sehr technisch orientiert. Das Ästhetische spielt auch eine wichtige Rolle, das zeigen die Debatten über städtebauliche Fragen. Die Sozialwissenschaften hingegen sind in der Planung unterbelichtet.TEC21, Fr., 2010.05.21
21. Mai 2010 Lukas Denzler, Ruedi Weidmann