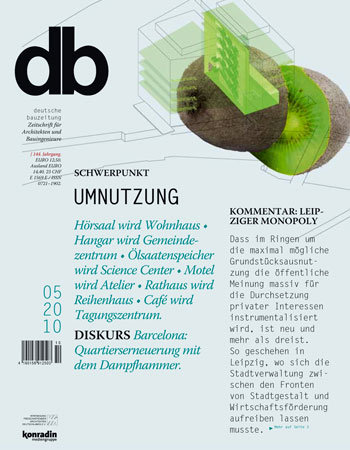Editorial
Ein Rathaus wird zum Reihenhaus, ein Motel zum Bürogebäude, ein Speicher zum Science Center und ein Hangar zum sozialen Zentrum eines Neubaugebiets: Der Umgang mit bestehenden Bauten und Strukturen gehört bereits jetzt zu den größten Bauaufgaben, die wir haben. Fantasievolle Zwischen- und Umnutzungskonzepte, die zur Revitalisierung und zum Erhalt bestehender Bausubstanz führen, sind zunehmend gefragt. Neben technischen Herausforderungen, die sich beim Umbau und bei der energetischen Sanierung ergeben, sollte es dabei immer auch um einen respektvollen Umgang mit dem Bestand gehen. Die von uns für dieses Heft ausgewählten und kritisch vorgestellten Gebäude stehen alle unter Denkmalschutz und standen dennoch – oder gerade deshalb – eine Zeit lang leer und waren vom Abriss bedroht. Sie befanden sich also in einem oft jahrelang andauernden, unsicheren Schwebezustand. Während dieser Zeit können Projekte wie die künstlerische Intervention des Büros chezweitz & roseapple in der ehemaligen städtischen Badeanstalt Halberstadt (s. Abb. links) wesentlich zur Sicherung beitragen. Die raumgreifende Videoinstallation »Entdecke die Le re!« thematisiert den Leerstand und begreift Leerräume als herausfordernde Gestaltungsaufgabe. | uk
Transparent Tagen
(SUBTITLE) Berlin: Café wird Tagungszentrum
Das Café Moskau, ein herausragendes Beispiel der DDR-Moderne, wurde zum Veranstaltungszentrum umgebaut. Dabei stellten die Architekten die ursprünglichen Sichtbeziehungen und die Materialästhetik des Gebäudes wieder her. Mit einer Strategie des behutsamen Weiterbauens fanden sie vielfach, aber nicht überall überzeugende Lösungen für die neuen Anforderungen.
Laut tost der Verkehr auf der vielbefahrenen Berliner Karl-Marx-Allee am sanierten Café Moskau vorbei. Der Architekt Josef Kaiser errichtete es 1960–64 an der Vorzeige- und Paradestraße der DDR. Es bildet zusammen mit den gegenüberliegenden Gebäuden des Kino International, der einstigen Mokka-Milch-Eisbar und dem Neubau des Rathauses Berlin-Mitte – einer Referenz an das Hotel Berolina von 1963 – ein spannungsreiches städtebauliches Ensemble. Dies ist das Kernstück des zweiten Bauabschnitts der Straße, die als Stalinallee eher mit dem DDR-Neoklassizismus der 50er Jahre in Verbindung gebracht wird.
Die Kultur sollte hier zeigen, wie gut es sich im Sozialismus leben lässt: Filmpremieren im Kino International, sowjetische Kochkunst im Café Moskau. Im Gebäude befanden sich neben dem großen Restaurant eine Wein- und Teestube sowie ein Konzertcafé und eine Nachtbar. Letztere blieb auch in Betrieb, als das Haus in den 90er Jahren zum Technoclub und Ziel der Berliner Musikszene wurde. Das neue Nutzungskonzept sieht vor, die Räume in Zukunft für Veranstaltungen zu vermieten – Tanzen und Speisen nicht ausgeschlossen.
Zurück zu den Sechzigern
Das zweigeschossige Café Moskau wirkt transparent mit der umlaufenden Glasfassade im OG. Das EG allerdings präsentiert sich von außen eher verschlossen, wenngleich große Glasfenster die Wandfelder regelmäßig durchbrechen. Nach dem Betreten des Gebäudes hingegen eröffnet sich dem Besucher ein weites Blickfeld vom Eingangsfoyer über das zentrale Atrium bis hin zum rückwärtigen Außenbereich, dem Rosengarten. Diese vielfältigen Sichtbeziehungen und die durchdachte Materialästhetik von 1964 – ein Zusammenspiel von hellen Holzdecken, rotem Marmor, grauem Schiefer, Buntsteinputz und matt schimmernden Aluminiumprofilen – wiederherzustellen, war eines der Ziele des Umbaus durch das Berliner Büro Hoyer Schindele Hirschmüller (HSH). Wurden doch beim letzten Umbau 1981-83 Glaswände mit dunklem Holz verkleidet, großzügige Räume durch eine Vielzahl von Einbauten geteilt und die Leichtigkeit der 60er Jahre durch eine schwere, dunkle Innenausstattung aufgehoben. Dennoch stellten die Denkmalpfleger das Gebäude mitsamt den Einbauten nach 1989 unter Schutz. Sie stimmten der Entscheidung, diese Schicht des Gebäudes bis auf wenige Reste aufzugeben, nur unter der Bedingung zu, dass dafür die ursprüngliche Architektursprache soweit wie möglich wiederhergestellt würde. Die Architekten entfernten dazu zunächst diverse Einbauten und befreiten die Oberflächen von Übermalungen. Die ursprünglichen Materialien lassen sich heute wieder erleben. Einzelne Wandverkleidungen und Motive der 80er Jahre wurden an Ort und Stelle erhalten oder an anderer Stelle in neue Räume eingebaut. Mit dem Umbau konnten die Architekten das Raumerlebnis z. T. sogar noch steigern: Die Heizkörper, die ehemals vor der raumhohen Verglasung den Blick störten, ersetzten sie durch Bodenkonvektoren. Flexibel veranstalten
Das zweite, wichtige Ziel des Umbaus war es, möglichst viele, flexibel nutzbare Veranstaltungsflächen zu erhalten. Dafür reduzierten die Architekten den Anteil der Nebenräume entscheidend – für die zukünftige, temporäre Nutzung reicht z. B. eine Vorbereitungsküche aus. Mit neuem, zusätzlichem Eingang und Foyer an der Westseite bekam das Gebäude außerdem eine zweite, unabhängige Erschließung. Der Betreiber erhält mit dieser Maßnahme, den zusätzlichen Sanitärräumen und mehrfach teilbaren Veranstaltungsflächen, große Flexibilität in der Nutzung des Gebäudes. Durch eine der Umbaumaßnahmen ist jedoch der große Saal im EG in seiner Raumqualität deutlich gemindert worden. Um einen größeren, ungeteilten Innenraum zu erhalten, wurde die ursprüngliche, mittlere Stützenreihe entfernt. Zwei neue Reihen entlang der Längsseiten des Raums nehmen jetzt die Deckenlast auf. Der Blick durch die großen Glasfenster wird dadurch beeinträchtigt; der Raum vor den Fenstern wirkt beengt.
An vielen anderen Stellen gelang dagegen die Verbindung von Alt und Neu. So reflektiert die anthrazitfarbene Glaswand, die den neuen Eingang markiert, die historische Fassade des Café Moskau und setzt damit das schon 1964 angelegte Verwirrspiel mit Durchsichten und Spiegelungen fort. Ihre minimalistische Ästhetik – Profile fehlen außen völlig, lediglich Türgriffe unterbrechen die Glasfläche – zeigt außerdem deutlich die eigene, zeitgenössische Handschrift der Architekten. Tagsüber tritt die Wand zurück, nachts wird sie zum Leuchtzeichen und in Zukunft mit Hilfe einer LED-Wand zur bewegten Antwort auf das realsozialistische Mosaik an der Ostseite. Hinter der Glaswand weitet sich der Raum. Dort befindet sich das neue Treppenhaus. Die Architekten nehmen auch hier Motive des alten Gebäudes auf – die Oberlichter als Referenz an den ehemaligen Wirtschaftshof zum Beispiel – und finden ihren eigenen Materialausdruck: Helles Parkett für die Treppen, ein dunkler Magnesitestrich für die anderen Laufflächen, Glas und Edelstahl für Geländer und Brüstungen. Die Suche nach der zurückgenommenen Ästhetik des Eingangs bleibt an dieser Stelle jedoch vergebens.
Alte Fassung, neue Technik
Subtiler und gelungener ergänzen HSH Architekten die alte Fassade durch notwendige neue Öffnungen wie Lüftungsflügel oder Fluchttüren. Als Fassung dieser Elemente wählten sie schwarze Profile, ähnlich denen, die bereits 1964 verwendet worden waren, um die großen Glasflächen zu teilen. Damit fügen sich die neuen Bauteile wie selbstverständlich in die alte Fassade ein und beleben sie zusätzlich. Auch der neue Windfang am alten Eingang ist dafür ein überzeugendes Beispiel. Um eine bessere Wärmedämmung und einen besseren Sonnenschutz zu erreichen, wurde außerdem Isolier- und Sonnenschutzglas in die alten Profile eingesetzt. Da deren Anteil an der Fassadenfläche nur rund zehn Prozent beträgt, konnten gute Wärmewerte erreicht werden.
Die Architekten überzeugen mit ihrer Strategie des Weiterbauens jedoch nicht überall. Die neuen Decken in den großen Veranstaltungsräumen wurden als Referenz an die ursprüngliche Gestaltung als Holzdecken aus Esche entworfen. Damit sollte der alte Raumeindruck wiederentstehen. Im Gegensatz zur homogenen Oberfläche von 1964 ist die Decke heute aber durch eine Vielzahl von Technikelementen perforiert. Der historische Raumeindruck kann sich so nicht einstellen, ein neuer, eigenständiger nur schwer. In diesem Punkt verharrt die Architektursprache in einer unentschiedenen Haltung dem Bestand gegenüber. Das zeigt auch die Verwendung der gleichen Decke im 1964 noch nicht bestehenden, neuen Veranstaltungsraum. Von diesem fällt der Blick auf den Rosengarten, dem im Vergleich zum Atrium kleineren der beiden Freiräume. Die Rosen werden sich sicher noch entwickeln; derzeit lockert lediglich eine ebenerdige Wasserfläche den Bereich auf. Hier, wie auch beim Atrium und den Flächen um das Gebäude herum, lassen sich kaum Gestaltungsabsichten erkennen. Dennoch wird beim Blick auf die andere Seite der Karl-Marx-Allee deutlich, dass es das Café Moskau mit seiner behutsamen Sanierung und der ganz überwiegend gelungenen Neugestaltung gegenüber seiner Nachbarn wirklich sehr gut getroffen hat.db, Di., 2010.05.11
11. Mai 2010 Carsten Sauerbrei
Hörsaalwohnen
(SUBTITLE) Erfurt: Hörsaal wird zum Wohn- und Geschäftshaus
Nur Denkmäler, die genutzt werden, leben und überleben; doch der Denkmalstatus schreckt Bauherrenpläne in der Regel ab. Oft heißt dann der letzte Ausweg »Bewahren durch Entkernen«: Während der Bauherr im Innern maximale Freiheiten erhält, wird äußerlich die Kulisse eines historischen Gebäudes konserviert. Dass dieser oft problematische Kompromiss durchaus erfolgreich sein kann, beweist die Sanierung und Umnutzung eines Hörsaalgebäudes von 1956 in Erfurt zu einem Luxuswohn- und Geschäftshaus.
Ein Hörsaal als Wohnraum. Das klingt nach reichlich Platz und großzügigen Möglichkeiten; nach häuslicher Behaglichkeit, wo einst konzentrierte wissenschaftliche Lehre stattfand. Eine solche Umnutzung ist nicht unbedingt nahe liegend, umfassende Eingriffe scheinen unausweichlich. Brisant wird diese Idee, wenn es sich beim Bestandsbau um ein Denkmal handelt – wie beim Alten Hörsaal in der Erfurter Gorki-Straße, der von hks Architekten aus Erfurt umgebaut wurde.
Das würdevolle Baudenkmal im Stil der Nationalen Tradition der frühen DDR ist ein sachlich-schlichter und präzise in sein Umfeld eingesetzter urbaner Baustein. Seine rationale, offene Grundstruktur hat fraglos die Neunutzung und den Umbau begünstigt. Allerdings konfrontiert die Transformation zu einem Wohn- und Geschäftshaus historisch-semantische Gegebenheiten mit aktuellen nutzungstechnischen Belangen. Während etwa die historische Fassade weitgehend gewahrt wurde, entstanden im Innern Wohnungen und Gewerberäume, die kaum noch mit der äußeren Erscheinung korrespondieren. Hinter den hohen Fensterstreifen des massiven Hörsaalgebäudes verbergen sich jetzt etagierte Wohnungen und kleinteilige Praxisräume. Trotzdem herrscht allgemeine Zufriedenheit: Der Denkmalschutz kann ein gefährdetes Bestandsgebäude als gesichert zu den Akten legen – und mit dem Luxuswohnkonzept ist auch für eine angemessene Nutzung des Gebäudes gesorgt.
Unauffälliger Umbau
Die Umnutzung zum Wohn- und Geschäftshaus erkennt man erst beim Betreten des 2008 nach zehnmonatiger Bauzeit fertiggestellten Gebäudes oder bei einem Blick auf die Rückfassade. Während die großen Originaltreppenhäuser erhalten blieben, bekamen alle weiteren Bereiche neue Nutzungen und Zuschnitte. Vor allem der Hörsaal ist verschwunden. An seiner Stelle wurden Eigentumswohnungen über mehrere Etagen mit einer Größe von 225 m² bzw. 238 m² eingebaut, deren offene Grundrisse über integrierte Treppen und eingeschnittene Lufträume verbunden sind. Galerien ermöglichen spannende Durchblicke zwischen den Geschossen: dreidimensionales Wohnen. Die Zwischendecken mit den vertikalen Fenstern der Fassade abzustimmen, war nicht leicht – aber der frühere Hörsaal ermöglichte es, den neuen Wohnräumen eine Großzügigkeit zu geben, die beeindruckend ist. Die Decken konnten im Wesentlichen im bestehenden Stahlbetonskelett des Gebäudes verankert werden, so dass im Inneren keine zusätzlichen Tragstrukturen nötig wurden. Mit Rücksicht auf die bestehenden Fensterformate entstanden unterschiedliche Geschosshöhen, die das Raumerlebnis durchaus bereichern.
Beim Umbau des Hörsaals zum Wohnraum hat man generell hohe Standards angesetzt. Neben einem individuellen Zuschnitt der Räume wurde auf edle Materialien und inszenatorische Lichtakzente besonderer Wert gelegt. In den Wohnräumen mit den deckenhohen Fenstern kontrastiert eine puristisch-helle Farbgebung mit dunklen, edlen Parkettfussböden aus Räuchereiche. Behaglichkeit erzeugen auch die klimatischen Bedingungen: Flächenheizungen in den Fußböden und Wänden sorgen im Zusammenspiel mit der Betonkernaktivierung für eine gleichmäßige Temperaturabstrahlung. Jegliche Dämmung wurde im Hinblick auf den Fassadenerhalt innen angebracht.
Weniger großzügig sind im Vergleich zu den Eigentumswohnungen die medizinischen Praxen angelegt: die vorhandenen großen Volumen wurden einfach zugebaut. Hier wird deutlich, dass im Rahmen der ursprünglichen Gebäudestruktur weniger das Prinzip »Entkernung« als die Idee der »Verdichtung« und Flächenmaximierung maßgeblich war – den räumlichen Anforderungen der neuen Nutzer geschuldet. Da war nicht viel zu entfernen, vielmehr wurde zusätzlich eingebaut.
Den kräftigen Eingriffen im Innenraum steht die Beibehaltung des äußeren Erscheinungsbildes gegenüber. Schäden an der Fassade wurden bei der Sanierung glatt geputzt und so exponiert. Horizontal eingeschnittene Fensterbänder bilden allenfalls vorsichtige Gegenakzente; sie waren dem Denkmalamt ohne weiteres zu vermitteln. Die thematische Gegenüberstellung Alt-Neu äußert sich geometrisch: vertikal versus horizontal. Das gilt vor allem für die an der Hoffassade angebrachten Balkone, die am deutlichsten auf die neue Wohnnutzung verweisen. Spätestens hier wird die Innen-Außen-Korrespondenz aufgehoben: was einmal Hörsaal war (und im Übrigen noch danach aussieht), ist nun eine Stadtvilla. Hier offenbaren sich die semantischen Brüche, die mit solchen Umnutzungen einhergehen. Die Gebäude sind nicht mehr ehrlich oder aufrichtig.
Der Altbau
Entstanden war der Alte Hörsaal der ehemaligen Erfurter Frauenklinik und medizinischen Akademie – ein sogenanntes Lehrkrankenhaus – aus dem Geiste einer Sachlichkeit, die auch ideologisches Programm war. 1956 nach einem Entwurf von Adolf Lang vollendet, wurde das Gebäude als ein Zeichen der neuen (sozialistischen) Zeit und ihrer Werte verstanden, welches bewusst der mittelalterlichen Altstadt Erfurts wie auch der bourgeoisen Brühler Vorstadt entgegen gestellt wurde. Die optische Erscheinung des aufrechten Baukörpers mit seinen hoch aufstrebenden Fenstern wie auch sein ehemals geräumiger Innenraum (Platz für 165 Zuhörer) assoziiert eher einen Kirchenbau. Das Kalksteinrelief von Helmut Braun über dem Haupteingang entrollt eine ideologische Mustertapete zum Thema »Frauenheilkunde für das Volk«. Das war notwendige künstlerische Propaganda, um die Schlichtheit und Neutralität der Architektur, die sicherlich den baulichen Möglichkeiten ihrer Zeit geschuldet war, zu kompensieren.
Im Vorfeld der Sanierung wurde das Gebäude von Stadt und Land zur privaten Nutzung veräußert. In einem Bieterverfahren, an dem sich auch Initiatoren eines freikirchlichen Gemeindezentrums beteiligt hatten, siegte dann ein Konzept, das neben der Wahrung denkmalpflegerischer Interessen eine Flächenmaximierung vorsah. Dennoch stand wohl die wirtschaftliche Frage bei der öffentlichen Hand im Vordergrund. Eine gemeinschaftlich-öffentliche Nutzung wurde nicht unbedingt gesucht. Dabei war der Impuls der Architekten, die zugleich zur Eigentümergemeinschaft des Objekts gehören, hinsichtlich der künftigen Nutzung von vorn herein klar: Ziel war die Schaffung eines angemessenen Wohnraums für die eigene Familie.
Mit dem Entscheid zur Sanierung als Wohn- und Geschäftshaus wurde die historische Bedeutung des ehemals öffentlichen Gebäudes also bewusst zurückgenommen und zugunsten seiner Nutzbarkeit privatisiert. Die Privatisierung ehemals öffentlicher Baudenkmäler ist allgemein nicht unproblematisch. Wenn Architekten historische Gebäude, die einmal Gesellschaft und Öffentlichkeit prägten, zur schönen Verpackung reduzieren, stellt sich die Frage, inwieweit die Idee der öffentlichen Repräsentation eines gesellschaftlich-geschichtlichen Konsenses überhaupt noch erwünscht und möglich ist. Damit steht und fällt die Sinnfälligkeit eines Denkmalschutzes, der auf mehr abzielt als nur den Erhalt physischer Bausubstanz oder gar nur des äußeren Erscheinungsbildes von Gebäuden.
Ein Zukunftsmodell?
Der Verdienst der Planer und Bauherren steht außer Frage, für den prominenten Altbau eine probate neue Verwendung gefunden zu haben. Sie haben eine bauliche Lösung für die Nachnutzung und Revitalisierung des Gebäudes entwickelt, die für vergleichbare Fälle einen hohen Standard definiert. Der Kompromiss einer bestandsfreundlichen Sanierung bei gleichzeitiger zweckgemäßer Zergliederung im Innern wahrt die Interessen von Denkmalamt und Nutzern. Die Substanz wurde weitgehend bewahrt, während man beim Ausbau das opulente Raumangebot im Objekt kreativ zu nutzen verstand.db, Di., 2010.05.11
11. Mai 2010 Robert Gärling, Jörg Rainer Noennig
Glückliche Fügung
(SUBTITLE) Heilbronn: Ölsaatenspeicher wird Science Center
Die Bauaufgabe »Science Center« legt technoide, noch nie da gewesene große Gesten nahe, die jedermann sich merken kann. Nichts dergleichen findet sich in Heilbronn, wo vor Kurzem »Süddeutschlands größtes Science Center« angesiedelt wurde: Junge Architekten ergänzten hier einen nutzlosen Speicher um ein äußerlich verwandtes, dienendes Bauwerk. Erst in der Fuge zwischen beiden Gebäuden wird es spannend.
Der alte »Hagenbucher« ist ein Klotz. Benannt nach der Ölmühle, die hier auf der Neckarinsel seit dem späten 19. Jahrhundert Raps, Leinsamen und Mohn verarbeitete, war der 1936 errichtete Speicher das letzte, mächtige Überbleibsel dieser Industrie. Das »Schloss der Ölbarone« hieß er auch. Als nach den Bombardements im Zweiten Weltkrieg alles ringsum in Schutt und Asche lag, stand der Hagenbucher noch, weithin sichtbar, unverwüstlich.
Für 10 000 t Last gebaut, ließ sich die Konstruktion auch nach dem Krieg nicht zu akzeptablen Kosten beseitigen. So dienten die 3 500 m² lange Zeit als Lager für eine Spedition und als Schulfundus. In die nach dem Krieg zu ächst grüne Aue hatte die Stadt über die Jahre andere großmaßstäbliche Nutzungen platziert, ein Hotel, eine Turnhalle und vor allem: Parkhäuser. Für den Hagenbucher reifte im Rathaus erst zu Beginn des neuen Jahrtausends der Entschluss, ihn zum Standort eines Science Centers zu machen – mit großzügiger Hilfe von Sponsoren aus der Region. Schließlich stehe das dominante Bauwerk doch für das Selbstbewusstsein der heimischen Industrie.
Entscheidung gegen das Spektakel
Die Ausschreibung des Anfang 2007 ausgelobten Architektenwettbewerbs ließ indes offen, wie mit dem Klotz zu verfahren sei – er stand nicht unter Denkmalschutz, ja, er forderte in seiner Massivität eigentlich dazu heraus, sich an ihm abzuarbeiten, und gar mancher von den Verantwortlichen erhoffte sich einen »Gehry-Effekt« für die Stadt. Knapp 300 Büros bewarben sich, gut dreißig kamen in die engere Wahl, darunter einige bekannte Namen, die dem Speicher spektakuläre Auf- und Anbauten verpassen wollten. Parallelen zum Kaispeicher A im Hamburger Hafen drängten sich auf, der seit 2003 von Herzog & de Meuron zur neuen Elbphilharmonie überhöht wird, für bald eine halbe Milliarde Euro. Wohl auch, weil das Budget in Heilbronn ein viel bescheideneres war – nur ein Drittel des Raumprogramms sollte in einen Neubau – entschied sich die Jury gegen ein Spektakel. Ein unbekanntes Berliner Büro, erst 2004 gegründet, war mit Glück als »junges Büro« in die Auswahl gekommen. Sein Entwurf eines schlichten, den Speicher ergänzenden Zwillings brachte die Preisrichter geschlossen hinter sich. Die rotbraune Ziegelhaut des alten legt sich auch um das neue Gebäude, so dass beide als Einheit gelesen werden – mit einer entscheidenden Trennung: der gläsernen Fuge. Das Bild einer aufgeschnittenen Kiwi diente den Architekten als Metapher für den geteilten Baukörper mit brauner Haut und einem hellgrün leuchtenden Innenraum. Der scharfe Schnitt soll zugleich Sinnbild für das wissenschaftliche Sezieren sein, das Vordringen zum inneren Kern der Dinge, was ja durchaus frisch und köstlich sein kann. Mit formaler Strenge und tektonischer Klarheit gelingt hier also gleichwohl – ohne technoiden Schnickschnack, der sowieso bald veraltet wäre – eine symbolische Aussage über den Inhalt des Gebäudes. Denn es geht in der »Experimenta« tatsächlich nicht darum, die Technik nur zu bewundern, sondern um den Prozess des Entdeckens, auch der eigenen Talente, Interessen und Fähigkeiten. Wer die Nutzung nicht kennt, mag den Komplex aber auch für ein Hotel- oder Konferenzzentrum halten. Interne Fugen, Gräben oder »Straßen« sind ja typologisch eher unspezifisch.
Erschliessung und Ortsbezug
Zunächst sorgt der »Durch-Schnitt« im Gebäude für eine logische Zirkulation in der Vertikalen. Nachdem für den Anbau das vorhandene Treppenhaus des Speichers abgerissen worden war, wuchs entlang der Schnittkante eine neue einläufig gestapelte Treppenkonstruktion empor, welche das Foyer im EG mit den fünf Geschossen des Neubaus (Verwaltung, Labore, Sonderausstellungen) verbindet. Über die Fuge hinweg führen jeweils kurze Brücken zum Speicher hinüber, der dank des Anbau-»Rucksacks« völlig frei für die Exponate bleiben konnte. Wer sich also durch die vier Etagen der Ausstellung bewegt, überquert zwischendurch immer wieder die Fuge. Dabei lässt sich nicht nur die schön präparierte alte Ziegelwand mit ihren Narben im Streiflicht effektvoll bestaunen; die Gäste können auch durch einen Blick über die Neckaraue kurz Abstand gewinnen von der Reizüberflutung in der Ausstellung. Endpunkt des Parcours sind schließlich die Panoramafenster im obersten Stockwerk. Alt und Neu, raue Ziegelwand und glatte Alu-Paneele stehen sich an der Fuge, durch Lichteffekte betont, spannungsvoll gegenüber.
Der Zugang ins Gebäude liegt jedoch nicht in der Fuge, sondern im Neubau auf der Nordseite. Hier ist der Ziegelquader mit seiner gerasterten Lochfassade aufgeständert, das Entree verglast. Im Foyer wurde die grellgrüne Schnittfassade der Fuge als Leitmotiv an die Decke umgeklappt. Der massive Empfangstresen, ebenfalls Teil der grünen Skulptur, lenkt die Gäste durch zwei Schleusen zur Fuge, wo vor den Garderoben das Treppenhaus, die Lifte und ein Gang zur Gastronomie abzweigen. Umgang mit dem Bestand
Der schmale, einhüftig erschlossene Neubauquader schiebt sich stadtseitig ein Stück am Speicher vorbei, so dass er den alten Mühlkanal überspannt und seine leuchtende Schnittseite sichtbar wird. In der Höhe und vor allem in der Textur passt er sich jedoch dem Altbau an: Die Ziegel wurden eigens in einem der letzten, denkmalgeschützten Ringöfen im Alten Land gebrannt, das zwischen Rot und Dunkelbraun changierende Verblendmauerwerk im selben Kreuzverband hochgezogen wie vor gut 70 Jahren, mit sehr gut versteckten Mäanderfugen. Allein die neuen Öffnungen weichen in Proportion und Fassung deutlich vom Bestand ab, so dass einem eher Louis Kahns Institutsbauten als die alte Industrie in den Sinn kommen.
Dem Speicher stiehlt der Anbau jedoch nicht die Schau, er stärkt ihm vielmehr den Rücken, dämmt ihm zudem die Breitseite. Der konische Grundriss des Altbaus war übrigens nicht funktional begründet, sondern zeichnet den Umriss der alten Stadtmühle nach.
Die trüben alten Gitterfenster blieben an ihrem Platz, der gleiche anthrazitfarbene Glimmerton prägt auch die neuen schmalen Stahlprofile der Zugangstüren und die Profile der Pfosten-Riegel-Glasfassade in Fuge und Foyer. Von innen setzte man allerdings großflächige Fenster mit hellen Alurahmen auf die Fensteröffnungen, um dem Wärmeschutz Genüge zu tun. Das sieht ebenso wenig elegant aus wie die – wegen der enormen Abwärme der Exponate und 100 000 erwarteten Besuchern jährlich – benötigten Klima- und Kabelkanäle, die allenthalben die mächtigen Unterzüge der Deckenkonstruktion queren. Seitens der Ausstellungsmacher war die Installation von oben und nicht über eine Bodenaufdoppelung erwünscht. Die Etagen befinden sich in ständigem Umbau, der Charakter ist eher »Werkstatt« als Museum; es lärmt und plappert, musiziert und summt aus allen Ecken. Der karge Speicher mit seiner weiß getünchten Konstruktion tritt völlig in den Hintergrund, er gibt dem Labyrinth der Stationen noch einen gewissen Halt, mehr nicht.
Am gravierendsten griffen die Architekten aber in die Dachlandschaft des Gebäudes ein. Für einen stützenfreien Saal für Veranstaltungen und die Klimatechnik trug man das oberste Stockwerk samt Pultdach ab. Die neue Stahlkonstruktion lagert nun auf den erhaltenen Umfassungsmauern, in welche die Panoramafenster gebrochen wurden, gerahmt von Betonwerksteinlaibungen.
Saalfoyer und Café-Lounge gehen ineinander über; wie der Saal folgen sie einer ganz anderen, edlen Neubau-Ästhetik mit rotem Boden und Räuchereichenholz. Wie auch im Restaurant im EG, für welches die alten Rundbogenfenster wieder geöffnet und ein raffinierter Tag-Abend-Wechsel des Ambientes inszeniert wurde, wechselt der Charakter hier komplett. Diese Räume werden auch unabhängig von der Experimenta für Veranstaltungen genutzt. Hierzu muss man wissen, dass gut die Hälfte des Budgets von Sponsoren bestritten wurde, die insbesondere die Einrichtung wesentlich mitbestimmten. Größter Financier war die Stiftung einer großen Supermarktkette, was nicht nur an der Typografie des Experimenta-Logos, sondern wohl auch in den lästigen Scannern deutlich wird, die einen an den Schleusen wie auch an vielen Exponaten erfassen. Da ist sie nun doch, die schöne neue Welt der Technik, die dezent auszublenden oder zumindest im Zaum zu halten dem Gebäude bis dahin gelang. Insgesamt überzeugt das Haus aber als robuste, sinnig erschlossene Hülle für eine Erlebniswelt, der sie historische Tiefe, Bodenhaftung verleiht. Und sollten Wissenschaft und Technik einmal nicht mehr genügend Neugier wecken – wonach es derzeit nicht aussieht –, ließe sich das Ensemble leicht auch für andere Ausstellungen wiederum umnutzen.db, Di., 2010.05.11
11. Mai 2010 Christoph Gunßer