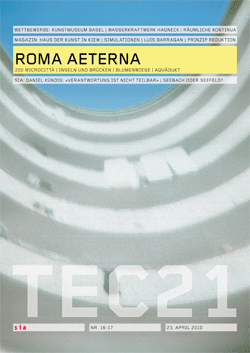Editorial
Francesco Rutelli, 1993–2001 Bürgermeister Roms, lancierte die architektonische Erneuerung der Ewigen Stadt. Zur Millenniumsfeier 2000 sollten nicht nur antike Stätten, mittelalterliche Kirchen und Renaissance-Paläste gerüstet, sondern auch neue Plätze gestaltet, der öV verbessert und die Bausubstanz verjüngt sein. Er initiierte, unterstützt von Walter Veltroni, seinem Nachfolger 2001–2008, etliche Architekturwettbewerbe. Der 1998 von Zaha Hadid entworfene Museumsbau im Quartier Flaminio wurde Ende letzten Jahres als Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (MAXXI) eröffnet. Dieses wird nun – «rhetorisch»1 – die Fortsetzung der Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Gnam), nachdem das im Wettbewerb erkorene Erweiterungsprojekt von Diener & Diener schubladisiert wurde. Angekündigt auf den 21. April 2010 war die Eröffnung der von der französischen Architektin Odile Decq entworfenen Erweiterung des Museo di Arte Contemporanea di Roma (Macro) unweit der Porta Pia. Im Dezember soll Massimiliano Fuksas Centro Congressi, im Gebiet der Esposizione Universale di Roma (EUR), fertig werden. Weit ausserhalb des touristischen Stadtplans liegt die Kirche von Richard Meier, «Dives in Misericordia», im Quartier Tor Tre Teste, für die das römische Vikariat 1993 einen Wettbewerb ausgeschrieben hatte (TEC21, 22/2004).
1993 war auch das Jahr, in dem die römische Administration die Überarbeitung des 30-jährigen Piano Regolatore Generale (PRG) initiierte, mit der das Bild von der Stadt revidiert wurde: Der Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie wurde relativiert und die Stadt als Konglomerat von 200 Microcittà aufgefasst («200 Microcittà»).
Diese Rochade änderte den Blickwinkel auf die Peripherie und jene Menschen am Rand der Gesellschaft, denen Pier Paolo Pasolini filmisch und literarisch ein Denkmal gesetzt hatte. Die PRG-Revision leistete der Aufwertung von Siedlungen am Rand der ringförmigen Stadtautobahn Grande Raccordo Annulare (GRA) Vorschub, in welche die römische Kommune einst Menschen abgeschoben hatte, um deren illegale Behausungen im Zentrum abreissen zu können («Blumenwiese, «Brücken und Inseln», «Aquädukt»). De iure implementiert wurde der neue PRG im Februar 2008 – zwei Monate vor Gianni Alemannos Wahl zum Bürgermeister. Ende Juli 2009 präsentierte der Berlusconi-Parteigänger den «piano nomadi», mit dem die Umsiedlung von Sinti und Roma in Gemeinden ausserhalb des GRA vollzogen werden soll. Derweil inszeniert Alemanno tourismuswirksam das Kolosseum, an das er restauratorische Hand legen will – als Trumpf in der Bewerbung um die Olympischen Spiele 2020.
Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
07 WETTBEWERBE
Kunstmuseumserweiterung Basel | Wasserkraftwerk Hagneck| Räumliche Kontinua
18 MAGAZIN
Haus der Kunst in Kiew | Seminar Simulationen | Bücher | Luis Barragan | Drucksensoren | Architekturwanderer | Das Prinzip Reduktion | Wegen Sanierung gesperrt | Bildung
24 PERSÖNLICH
Andrée Mijnssen: «Als Exotin bin ich oft angeeckt»
36 200 MICROCITTÁ
Rahel Hartmann Schweizer, Christian Holl
Der neue Piano Regolatore Generale (PRG) von 2008 revidiert das Bild vom zentralistischen Rom: Die Metropole birgt 200 Microcittà als identifizierbare Ortschaften.
40 INSELN UND BRÜCKEN
Rahel Hartmann Schweizer
Das Wohnbauprojekt «Laurentino 38» war von Ghettoisierung bedroht. Heute wird das Quartier wieder als «i ponti» bezeichnet nach den Brücken, die der Clou des Entwurfs waren.
48 BLUMENWIESE
Christian Holl
Prato Fiorito, eines der ersten konkreten Projekte für die Aufwertung der Peripherie, gibt dem Quartier eine verlorene Identität zurück.
51 AQUÄDUKT
Christian Holl, Rahel Hartmann Schweizer
Die Landschaftsarchitektin Christina Tullio hat den ersten Schritt dazu getan, dass sich die Bewohner des Quartiers Alessandrino mit einem Relikt aus der Vergangenheit identifizieren.
56 SIA
Daniel Kündig: «Verantwortung ist nicht teilbar» | Seebach oder Seefeld? | Kurse
62 PRODUKTE
65 MESSE Light & Building 2010
85 IMPRESSUM
86 VERANSTALTUNGEN
200 Microcittà – eine Metropole
Die Peripherie Roms litt in den letzten Jahrzehnten unter der Vernachlässigung durch die Stadtverwaltung, die sich auf das Zentrum konzentrierte. Der neue Piano Regolatore Generale (PRG), der 2008 in Kraft trat, revidiert das Bild der Stadt vom Zentristischen zum Polyzentristischen: Die Metropole birgt 200 Microcittà. Die peripheren Quartiere sollen nicht mehr ausfransende, wuchernde Auswüchse der Stadt, sondern identifizierbare Ortschaften sein.
Fünf Piani Regolatori Generali (PRG)[1] hat die Stadt Rom bisher gehabt: Diejenigen von 1873 und 1883 fielen in die Regierungszeit König Umbertos I. Der Plan von 1909 war der erste, der nicht mehr unter aristokratischer Führung, sondern unter der Leitung einer von demokratischen, republikanischen und sozialistischen Kräften getragenen Administration entwickelt wurde, an deren Spitze der Bürgermeister Ernesto Nathan stand. Nach seinem Urheber Edmondo Sanjust als «Piano Sanjust» bezeichnet, wurde der Plan für eine Bevölkerung von einer Million dimensioniert (1908 hatte Rom knapp 600 000 Einwohner). 1931 – die Stadt war nunmehr auf über eine Million Einwohner angewachsen – wurde der Perimeter ausgedehnt und eine Einwohnerzahl von zwei Millionen anvisiert. Roms Gouverneur Boncompagni Ludovisi präsidierte die Kommission, die den Plan ausarbeitete. «[…] die hehren Versicherungen, das historische Zentrum nicht anzutasten, [wurden] den Bedürfnissen des Strassennetzes geopfert», schrieb dazu der Architekt Piero Ostilio Rossi.[2] In der Folge setzten die Faschisten zu den grössten«sventramenti» (Ausweidungen) der Geschichte der Stadt an – unter anderem um die Schneise der Via dei Fori Imperiali zu legen.
1962 schlug die Geburtsstunde der «asse attrezzato» – eine Schnellstrasse, die in Nord- Süd-Richtung die Autostrada del Sole mit dem EUR (Esposizione Universale di Roma) verbinden sollte.[3] An diese Achse sollte das Sistema Direzionale Orientale (SDO) andocken, ein gigantisches Überbauungsprojekt in der östlichen Suburbia der Stadt, in dem die Funktionen der öffentlichen Hand – Ministerien, Verwaltung etc. – hätten konzentriert werden sollen, um das historische Zentrum zu entlasten und durch den frei werdenden potenziellen Wohnraum seiner Verwaisung Einhalt zu gebieten. Man bot Kenzo Tange auf, um das Projekt zu planen, Urheber des Ende der 1980er-Jahre errichteten Centro Direzionale in Neapel. Gegliedert wurde das SDO in vier Zonen: Pietralata, Tiburtina, Casilino, Centocelle. Doch diese Planung bleib in den Anfängen stecken und kam nicht über eine Rumpfbebauung im EUR und auf dem ehemaligen Flughafen von Centocelle hinaus. Daher wurde auch vier Jahrzehnte später und obwohl nun, ab 1993, ein neuer PRG in Arbeit war, noch über die «asse attrezzato» gestritten. Das SDO blieb der Papiertiger einer technokratischen und fortschrittsgläubigen Epoche. Mit dem neuen PRG, über dem nun, da Francesco Rutelli das Bürgermeisteramt antrat, die «grüne» Flagge wehte, wurde das SDO auf eine «centralità urbana» im Quartier Pietralata reduziert, verbunden mit dem Ausbau des Bahnhofs Tiburtina für Hochgeschwindigkeitszüge (Alta Velocità). Gleichzeitig wurde die Nord-Süd- Achse ad acta gelegt und durch ein tangentiales Erschliessungssystem ersetzt, das vor allem auch auf dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs basieren sollte.
«19 Städte, eine einzige Metropole»
Motor dieses Richtungswechsels ist die radikale Revision der Idee von Stadt, die nun rund 6 Millionen Einwohner umfasst – mehr als die Hälfte davon in der Peripherie: Ging die Planung im Gefolge des Piano Regolatore der 1960er-Jahre von der Erweiterung nach aussen aus, vom Wachstum durch Neubau und Neuerschliessung, steht hinter dem neuen Planungsinstrument die Devise der Aufwertung nach innen, innerhalb des Stadtgewebes. Und die zentralistische Auffassung von einer Kapitale weicht der Vision eines polizentristischen Stadtgebildes, in dem nun auch die Peripherie stärkeres Gewicht hat. In Anlehnung an die verwaltungstechnische Gliederung in 19 Municipi will die Stadt ihr Image von der Metropole zur «19 città una sola metropoli» («19 Städte, eine einzige Metropole ») wandeln.[4] Die reale Bebauungsstruktur der Stadt findet ihren Niederschlag in dem Bild eines Haufens von «microcittà», deren 200 identifiziert werden (Abb. 2 und 3).
Es werden 18 «urbane Zentren» definiert, nahezu eines pro Municipio (Stadtbezirk), und 60 Ortszentren («Centralità locali») destilliert und im neuen Piano Regolatore festgelegt.[5] Sie bilden die Knotenpunkte der lokalen Identität, der Prozesse der Modernisierung und der Qualitätssicherung der Perpherie – mittels öffentlicher Einrichtungen, Anbindung an den ÖV, Bau von Kulturzentren und Verbesserung der Qualität der Grünzonen. Der neue PRG brachte aber noch eine weitere Einsicht: dass nicht nur das Planungsinstrument von der zentralistischen Doktrin abrücken muss, sondern auch der Planungsprozess kein zentralistisch geführter sein und nicht Top-down verlaufen darf, sondern der Einbindung der Planungsinstanzen der Region und der Municipi sowie der Bewohner bedarf.
Identität und Katalysator
In diesem Kontext sind die verschiedenen Programme des Dipartimento XIX – Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie zu sehen[6]: territoriale Laboratorien, Quartiervereinbarungen, Plätze und öffentlicher Raum, Zonen mit einst widerrechtlicher Bebauung, Programme zur städtebaulichen Aufwertung, ökologische Entwicklung, Kulturzentren in der Peripherie sowie Landschaft und Identität der Peripherien. Leitmotiv des Programms «Paesaggi e identità delle periferie» (Landschaft und Identität der Peripherien) ist der Gedanke, den traditionellen Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie aufzubrechen. Es verfolgt zwei Intentionen: Zum einen soll die Identität der Ortszentren, der Microcittà, gestärkt, zum andern ihre Integration in die Stadt gefördert und der Segregation vorgebeugt werden. Auf der einen Seite soll also der Charakter der urbanen Inseln im Meer des Grünraums, von dem die Peripherie nach wie vor durchzogen ist, betont, auf der andern sollen sie ans Zentrum der Stadt angedockt werden. Die ausgeworfenen Anker beschränken sich nicht auf die Anbindung an den öV und das Strassennetz. Vielmehr soll durch die Verbesserung der städtebaulichen Qualitäten und die Förderung der wirtschaftlichen Kapazität die Grundlage gelegt werden, um stabile Nachbarschaften zu bilden – Gemeinschaften, die ebenso selbst- wie des Gefühls bewusst sind, Teil eines grösseren Ganzen, der Stadt Rom, zu sein. Die Viertel der Peripherie sollen nicht mehr als auf das Zentrum bezogene Entlastungsstandorte, sondern als eigene «Ortschaften» begriffen werden. Daher wird versucht, auf den Ort einzugehen, sowohl inhaltlich als auch in der Wahl der Mittel. Inhaltlich wird nach Eigenheiten geforscht, die den Orten wieder eine Identität geben können: Landschaftliche Qualitäten wie die Weinberge im Prato Fiorito (vgl. «Blumenwiese», S. 48 ff.), bauhistorische oder archäologische Zeugnisse wie das Aquädukt im Quartier Alessandrino (vgl. «Aquädukt », S. 51 ff.), ein kulturelles Ereignis wie die Friedensdemonstration in den 1960er-Jahren in Colline della Pace oder ein einst prägendes, aber mit den Jahren verwässertes städtebauliches Konzept wie die Brücken im Laurentino 38 (vgl. «Inseln und Brücken», S. 40 ff.). «Paesaggi e identità delle periferie» hat ausserdem eine Katalysatorfunktion für die anderen Programme des Dipartimento XIX. So engagierte sich in Prato Fiorito auch das Programm für Zonen mit einst widerrechtlicher Bebauung und in Laurentino das Programm zur städtebaulichen Aufwertung. Eingebunden ist es ausserdem in die Errichtung von 20 Kulturzentren, die mit je eigenem inhaltlichen Schwerpunkt (Sport, Kultur, Ökologie) als Kristallisationspunkte der Quartiersentwicklung helfen sollen.[7]
PS: Ob und inwiefern die Peripherie nach dem Regierungswechsel einen Spitzenplatz auf der politischen Agenda halten kann? Den Verdacht, dass sich der Brennpunkt verschieben könnte, nährte Bürgermeister Gianni Alemanno mit der Ankündigung, das Kolosseum renovieren und «Fahrende» in Randgebiete umsiedeln zu wollen. Bis zu den Wahlen von Ende März bildete die mitte-links regierte Region Latium, die manche Projekte mitfinanziert, immerhin noch ein politisches Gegengewicht zu Gianni Alemannos Partito delle Libertà (PdL). Nun ist auch sie in der Hand einer Berlusconi-Anhängerin, Renata Polverini, und nur die Provinz Rom ist mit Nicola Zingaretti noch vom Partito Democratico (PD) besetzt.
Anmerkungen:
[01] Der Piano Regolatore Generale (PRG) ist einem Richtplan vergleichbar. Der PRG formuliert das Planungsleitbild und die Entwicklungsschwerpunkte der Stadt. Die Revision, die 2008 in Kraft trat, wurde 1993 an die Hand genommen
[02] P. O. Rossi: Roma – Guida all’architettura moderna 1909–2000. Editori Laterza, 2000, S. 65
[03] EUR (Esposizione Universale di Roma) wird heute ein Stadtviertel im Süden Roms bezeichnet, das nach dem Willen Mussolinis die Weltausstellung 1942 beherbergen sollte. Die ursprüngliche Bezeichnung lautete E42 (Esposizione Universale 1942). Städtebaulich verbindet es das historische Zentrum Roms mit dem Meer bei Ostia. Die Planung wurde Marcello Piacentini übertragen, der 1938 sein definitives Projekt vorlegte. E42 ist geprägt vom Spannungsfeld zwischen der Architektur des Razionalismo und neoklassischen Tendenzen, die auf die römische Baukunst der Antike zurückgreifen, aber auch Elemente der Pittura metafisica aufweisen. Vgl. Anm. 2, S. 248–249
[04] Bis 1992 war Rom in 20 Municipi (Stadtteile) gegliedert. Damals spaltete sich das XIV. ab und bildete die Comune di Fiumicino. Die Nummerierung aber wurde beibehalten und die 14 einfach übersprungen. Es sind nun also 19 Municipi, gezählt wird aber trotzdem bis 20.
[05] Die 18 metropolitanen und urbanen Zentren sind: Alitalia Magliana, Bufalotta, Eur Sud Castellaccio, Fiera di Roma, Ostiense, Pietralata, Polo Tecnologico, Ponte di Nona Lunghezza, Tor Vergata, Acilia, Madonnetta, Anagnina Romanina, La Storta, Massimina, Torre Spaccata, Cesano, Ponte Mammolo, Santa Maria della Pietà, Saxa Rubra. Die 60 centralità locali sind: Piazza Vittorio Emanuele II (Municipio I), Flaminio (II), Città Universitaria (III), Settebagni, Fidene, Conca d’Oro, Talenti, Castel Giubileo (IV), Pietralata, San Basilio, Casal Monastero, Casal Bruciato (V), Pigneto, Teano, Serenissima, Piazza Marranella (VI), Tor Sapienza, Alessandrino, Mirti, La Rustica Centro, Tor Tre Teste, Quarticciolo (VII), Finocchio, Torre Gaia, Torre Angela, Lunghezza (VIII), Assisi/Mandrione (IX), Cinecittà, Casal Morena (X), Giustiniano Imperatore, Grotta Perfetta (XI), Laurentina, Mostacciano, Trigoria (XII), Ostia Antica, Acilia Sud, Acilia/Piazza Capelvenere,Ostia Lido, Axa/ Malafede, Infernetto (XIII), Villa Bonelli, Corviale, Trullo, Magliana, Largo La Loggia, Ponte Galeria (XV), Monteverde, Bravetta, Pisana, Colli Portuensi (XVI), Piazza Mazzini (XVII), Casalotti, Montespaccato, Cornelia (XVIII), Selva Candida, Torrevecchia/ Primavalle (XIX), Labaro, Cassia/Tomba di Nerone, La Storta, Vigna Stelluti, Collina Fleming (XX)
[06] Die Stadtverwaltung ist in 19 Departemente gegliedert. Dipartimento XIX befasst sich mit der Aufwertung und Entwicklung der Peripherie
[07] Die 20 Kulturzentren sind: Fidene, Monte Sacro Talenti, San Basilio, Casal dei Pazzi, Pigneto Biblioteca del Cinema, La Rustica, Torre Maura, Villaggio Prenestino, Appio Latino, Cinecittà Est, Cinecittà Tuscolano, Laurentino Piazzale Elsa Morante, Centro Giano/Acilia, Infernetto, Bravetta, Quartaccio, Volusia, Labaro Prima Porta, Pigneto Nuovo Cinema Aquila, Borgata Finocchio Collina della PaceTEC21, Fr., 2010.04.23
23. April 2010 Rahel Hartmann Schweizer, Christian Holl
Inseln und Brücken
Zwischen 1976 und 1984 errichtet, war «Laurentino 38» das bedeutendste der in Roms Peripherie realisierten, von der öffentlichen Hand gesteuerten Wohnbauprojekte. Vernachlässigung, illegale Besetzung und Verwahrlosung trugen ihm den Ruf einer «römischen Bronx» ein. Die Wende kam mit der Einsicht, dass Rom keine homogene Metropole ist, sondern ein Geflecht aus 200 Microcittà. Heute wird das Quartier wieder gerne als «i ponti» bezeichnet: nach den charakteristischen Brücken, die der Clou des Entwurfs waren.
Das Quartier Laurentino 38, die urbanistische Zone 12d des Stadtteils XII,[1] liegt südöstlich der EUR (Esposizione Universale di Roma, vgl. «200 Microcittà – eine Metropole») und gerade noch innerhalb des als ringförmige Stadtautobahn angelegten Grande Raccordo Annulare (GRA). Es erhebt sich an geschichtsträchtigem Ort: Die Überreste einer antiken befestigten Ortschaft mit einer Nekropole liegen auf dem Hügel, der zum Graben der Acqua Acetosa, einem Zufluss des Tibers, abfällt. Die Funde wurden zwischen das 8. und das 7. Jahrhundert v. Chr. datiert und mit einer der vorrömischen Städte – Tellene oder Politorium – in Verbindung gebracht, die Ancus Marcius, der vierte König von Rom, im 7. Jahrhundert v. Chr. zerstört hatte. Entdeckt worden waren die Relikte bei den Bauarbeiten eines der grössten von der öffentlichen Hand gesteuerten Wohnbauprojekte in Rom. Auf der Basis des 1964 in Kraft getretenen «Piano per l’Edilizia Economica e Popolare» (PEEP) (vgl. Kasten S. 41) stellte die Gestione per le Case dei Lavoratori (GesCal) 1969 ein Finanzierungsprogramm im Umfang von 70 Milliarden Lire auf die Beine für die Realisierung von Wohnbauten in grossem Stil.
Modulsystem aus Inseln und Brücken
Zwischen 1969 und 1970 schied die Administration drei der Piani di zona aus (vgl. Kasten), die in den Genuss einer solchen Planung kommen sollten: Corviale, Vigne Nuove und Laurentino, wobei Laurentino – «piano di zona no. 38» – mit 160 ha und 5500 Wohnungen für 32 000 Einwohner eines der grössten im Rahmen des PEEP überbauten Quartiere war. 1971 beauftragte die GesCal eine Gruppe von fünf Architekten unter Pietro Barucci mit der Ausarbeitung einer Volumenstudie. Vorgabe war, dass die Überbauung von verschiedenen Bauträgern – dem öffentlichen Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) und dem privaten Istituto autonomo cooperative di abitazione Lazio (IACAL) – und in mehreren Phasen realisiert werden könnte. Die Lösung, welche die Architekten 1973 vorschlugen, war eine Art modulares System. Erschlossen von einem 4 km langen Strassenring, gebildet aus der Via Filippo Tommaso Marinetti und dem Viale Ignazio Silone, gliederte sich das Gelände in fünf kranzförmig um diesen Ring gelagerte Sektoren: Nordwest, Nord, Nordost, Süd und Südwest. Jeder dieser Sektoren war mit zwei oder drei «insulae» bestückt, der kleinsten Einheit des Modulsystems mit 250 bis 300 Wohneinheiten für 1500 bis 1800 Menschen. Jede dieser Inseln wiederum bestand aus sieben Gebäuden. Sechs waren reserviert für Wohnzwecke – fünf Scheibenhäuser à acht Stockwerke (rund 28 m) und ein Turm mit 14 Geschossen (knapp 47 m), beide jeweils auf Pilotis – und eines für Gemeinschaftseinrichtungen, Läden, Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, Kindergärten, Restaurants etc., ausgebildet als den Strassenring überspannende Brücke.
In jedem Sektor sollten Grünräume, Spielplätze und Kinderkrippen eingerichtet werden. Zwischen den Sektoren aber waren Schulräume vorgesehen. Im Spickel zwischen dem Strassenring und der Via Laurentina wurde das Quartierzentrum angeordnet. Ausserdem sollte hier die zukünftige Metrostation gebaut werden. Das Tal im Zentrum des Quartiers sollte als grüne Lunge, als eine Art Central Park, funktionieren.zwischen brückenhäusern und -raststätten Das Konzept basierte auf der Idee der autogerechten Stadt, der Trennung der Verkehrsflächen – Autos unten, Fussgänger oben. Die architektonische Inspiration für die Inseln holte sich Barucci beim Plan Pampus, den die Niederländer Jonannes Hendrik van den Broek (1898–1978) und Jaap Berend Bakema (1914–1981) 1964 für die im IJmeer im Osten von Amsterdam gelegene künstliche Insel entworfen hatten (Abb. 4 und 6).[2] Die als öffentliche Passagen konzipierten Brücken verweisen auf die 1956 als Satellit von Glasgow gegründete und bis in die späten 1960er-Jahre entstandene New Town Cumbernauld (Abb. 9). Sie stehen gewissermassen am Ende einer Genealogie, die von der Rialto-Brücke in Venedig (1588–1591), der «interior street», die Andrej A. Ol 1927 für das Wettbewerbsprojekt «split-level dwelling unit of a communal house» entwarf,[3] den «bewohnten» Brücken, die Bernhard Tschumi und Luca Merlini 1989 in ihrem siegreichen Wettbewerbsentwurf zur Umgestaltung des Quartiers Flon in Lausanne aufgriffen (Abb. 10), bis zu der von Raststätten überspannten Autobahn führt. Im Laurentino wurden die Brücken dann aber eher wie mittelalterliche Brückenhäuser genutzt (Abb. 1 und 13), von Zuwanderern und Flüchtlingen notdürftig mit sanitären Installationen bestückt, als Wohnraum zweckentfremdet und besetzt. Denn so ehrgeizig das Konzept, so anfällig die Umsetzung, weil sie auf halber Strecke stecken blieb, sodass sich urbanistische Vision und soziale Realität zu einer fatalen Wechselwirkung hochschaukelten.
Von Baraccopoli nach New Town
Zum einen liess anfänglich nicht nur die technische Infrastruktur – fliessendes Wasser, Elektrizität, Kanalisation – zu wünschen übrig, Makulatur blieben die sozialen Einrichtungen: Schulen, Kindergärten, Gesundheitszentren, Poststellen, Bibliotheken, Theater, Läden, Sporteinrichtungen etc. Zum andern – und teilweise der Grund für die dürftige Alimentierung mit einem Service public – barg die «Besiedlung» sozialen Sprengstoff. Für Pietro Barucci beging die Stadt den Sündenfall, als sie 1979 beschloss, Leute in das Quartier Laurentino umzusiedeln, die das Hotel «Continental» gegenüber dem Hauptbahnhof Termini besetzt hielten. Sie entzweite sich dadurch mit dem Istituto Autonomo Case Popolare, das dagegen opponiert hatte, und weigerte sich in der Folge, die von der IACP erstellten öffentlichen Räume – namentlich die Brückenbauten – mit Schulen und Kindergärten auszustatten. Es war das Fanal für die «operazione borghetti». Um den Barackenstädten («baraccopoli») der Via Genzano, Via Anzio, Via Arco di Travertino und Via del Mandrione (im Südosten der Stadt, auf halber Strecke zwischen dem Zentrum und der Cinecittà gelegen) ein Ende zu setzen, siedelte man die Bewohner von Barackensiedlungen en bloc um. Mandrione hatte Pier Paolo Pasolini literarisch ein Denkmal gesetzt.[4] So wurden die Clanstrukturen mit ihren Hierarchien telquel verlagert und zementiert, eine soziale Durchmischung blieb aus – im Gegensatz zu den von den Kooperativen errichteten Bauten.
Inseln – Identifikation – Isolation
Unter diesen Prämissen förderte das urbanistische Konzept die Segregation. Die Inseln waren nur über den Strassenring miteinander verbunden. Und die Distanzen zwischen den südlichen und den nördlichen Inseln, zwischen Brücke Nr. 6 und Brücke Nr. 9 zum Beispiel, waren nicht nur gross, sondern auch schwer zu überwinden. Der Grünraum in der Mitte des Rings wurde nicht zum Central Park, sondern zum Niemandsland. Das Terrain war abschüssig, von Gräben durchzogen und mit Böschungen von undurchdringlichem Dickicht aus Brombeersträuchern bewachsen. Eine gebaute Barriere entstand ausserdem durch einen von Barucci nicht vorgesehenen Riegel von Terrassenhäusern. Was als nachbarschaftliche Gemeinschaft innerhalb der Inseln geplant war, gipfelte in einer übermässigen Identifikation mit der jeweiligen Insel bzw. mit der je eigenen Brücke. Isoliert waren die Menschen aber nicht nur nach innen, sondern auch nach aussen. Die Verlängerung der Metrolinie B lässt bis heute auf sich warten. Der Busbetrieb, der stattdessen installiert wurde, operierte mit den Nummern 080 und 082 – für die sensibilisierte Bevölkerung eine Ausgrenzung. Denn die vorangestellte Null verweist auf ausserstädtische Linien, sodass sich die Menschen wieder als «extracommunitari» empfanden. Inzwischen wurde die Nummerierung angepasst; es verkehren die Linien der ATAC Nr. 779, 776, 772.
Kaum ökonomisches Gefälle, aber soziale Kluft
Obwohl das ökonomische Gefälle zwischen den in die genossenschaftlich erstellten Bauten einziehenden Arbeitern und denjenigen, die sich in den Wohnungen der IACP einquartierten, nicht gross war, tat sich eine Kluft auf. Erstere, zumeist politisch links orientierte Bevölkerungsschichten aspirierten auf die Zugehörigkeit zur Mittelklasse, während jene in den IACP-Zonen tendenziell einer Arbeiterschicht angehörten, die in manchen Fällen zwischen Arbeitslosigkeit, Schwarzarbeit oder befristetem Arbeitsverhältnis navigierte. Das soziale Gefälle spiegelte sich nicht nur in der Architektur – die Brücken, die in allen Sektoren geplant waren, fielen in dem von den Kooperativen errichteten Sektor Süd weg –, sondern auch im Grad der infrastrukturellen Alimentierung: Anfang der 1990er-Jahre gab es im Sektor Süd einen COOP-Supermarkt, eine Kirche und einen Sitz der Verwaltung des Municipio XII. Auf den IACP-Inseln hingegen mussten sich die Menschen, weil Stadt und Bauherrin die Bewirtschaftung der Brücken versäumen, selber helfen. Zwischen 1987 und 1989 betrieben Jugendliche in einer leer stehenden Scheune das selbstverwaltete «Centro Sociale Occupato e Autogestito» (CSOA), organisierten Konzerte, Happenings, Debatten und dislozierten 1991 als «Laurentinokkupato» auf die Brücke Nr. 6. Zwei Jahre später zogen die Älteren nach und richteten in Brücke Nr. 5 ein Seniorenzentrum ein. Derweil war die Mehrzahl der übrigen Brücken zu diesem Zeitpunkt illegal besetzt – 1987 von rund 500 Menschen. Knapp zwei Drittel von ihnen hatten gültige Papiere und bekamen 1989 IACP-Unterkünfte im Quartier Tor Bella Monaca. Die Brücken wurden geräumt.
Laboratorium und Inkubator
Abreissen lässt die Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (Ater), Nachfolgeinstitution des IACP, drei der Brücken – Nr. 9, 10 und 11 – aber erst 2006. Sowohl die Initiative dazu als auch der Protest dagegen kommen aus dem Quartier. Dass die Stadt dabei auf den Abbruch der als «Vele di Secondigliano» zu zweifelhafter Berühmtheit gelangten Wohnbauten in Neapel verweist[5], verheisst aus architekturhistorischer Perspektive nichts Gutes. Doch das Konzept «Paesaggi e identità delle periferie» funktioniert differenzierter. Marode Glieder werden nicht einfach amputiert und durch Fremdkörper ersetzt, sondern es werden spezifische Eigenheiten eines Quartiers gesucht und gestärkt. Und das Charakteristikum des Laurentino 38 sind die Brücken.
Die Stadt erarbeitet im Rahmen des Programma di recupero urbano einen Katalog von 39 Massnahmen zur Attraktivierung des Quartiers im Umfang von 50 Millionen Euro. Das Programm umfasst u.a. bessere Fussgängerverbindungen, Strassenbeleuchtungen, neue Kreisel, Grünräume, die Renovation von Sportanlagen etc. An erster Stelle steht aber die Sanierung der Brücken Nr. 1 bis 8 und ihre Alimentierung. Brücke Nr. 1 beherbergt Bibliothek und Ludothek, Nr. 2 ein Gemeinschaftszentrum, Nr. 5 ein Konzertlokal und Nr. 8 einen sogenannten «incubatore d’impresa» – das wichtigste Instrument der «autopromozione sociale» (Hilfe zur Selbsthilfe). Der «incubatore d’impresa» ist eine Art «Start-up» der Mikroökonomie. Kleinunternehmern werden während 18 Monaten Infrastruktur und Logistik zur Verfügung gestellt: Räumlichkeiten, Telefon- und ADSL-Anschluss, Sekretariatsdienste, Fax, Scanner, Fotokopierer.
2002 stösst das Assessorato alle Politiche per le Periferie, lo Sviluppo Locale und vom Dipartimento XIX (Sviluppo e Recupero delle Periferie / Autopromozione Sociale) das Ideenlabor «Officina Laurentino» an, das vom Atelier Ambulant d’Architecture (AAd’A) und von «Il Gabbiano» geleitet wird.[6] Die Bewohner, die sich teilweise in verschiedenen gemeinnützigen Organisationen engagieren, sollen sich an der Planung von Projekten beteiligen.[7] Unter dem Titel «Interno 38» machen sich zehn Jugendliche und zehn Studierende der Kunst und Architekturakademie auf, mittels Video das Verhältnis zwischen physischem und sozialem Raum in ihrem Quartier zu ergründen. Das «Teatro Gulliver» erarbeitet die Performance «L’isola che c’è. Viaggio dentro casa», die im Juni 2006 auf der Piazza Elsa Morante aufgeführt wird. Ausgehend von dem in «Gullivers Reisen» angelegten Thema des von Zuhause Aufbrechens, der Entdeckung anderer Dimensionen und ihrer Relativität, unternehmen die Theaterleute eine Reise ins Innere des Quartiers und verweben Fakten und Fiktion, um die Bewohner/innen zu sensibilisieren: mit Interviews mit Leuten, die hier arbeiten, und solchen, die hier wohnen, für die Geschichte; mit Zitaten aus Werken derjenigen Autoren, die den Strassen ihre Namen geliehen haben, für das poetische Potenzial des Quartiers. Auch auf baulicher Ebene wird die Bevölkerung involviert. Im Rahmen des Projekts «Boulevard Laurentino» wird die Funktionsweise des Systems «Strasse und Brücke» debattiert. Die Geschlossenheit des Strassenrings soll aufgebrochen werden. Dieser blockiert die Durchlässigkeit des Quartiers sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen. Er schneidet die Menschen sowohl vom Grünraum im Innern als auch vom aussen liegenden, angrenzenden Quartier Ferratella ab. Der Höhenunterschied von 4 m zwischen Strasse und Fussgängerzone, der die Isolierung der Inseln und ihrer Bewohner bewirkt hat, soll aufgehoben werden. Das partizipative Verfahren gipfelt in einem Projekt, das von Studio UAP ausgearbeitet wird (Abb. 20). Es harrt allerdings noch der Realisierung. Im Bau hingegen ist die im «Laboratorio Territoriale Laurentino» ebenfalls unter Mitwirkung der Bevölkerung projektierte Piazza Elsa Morante. Die von Luciano Cupelloni, Architekt und Professor an der Universität «La Sapienza», entworfene Piazza wird das Kulturzentrum umfassen mit Zeitungslesesaal, Mediathek, Theater mit 200 Plätzen und Arena für rund 300 Personen sowie den Platz und den Park.
Anmerkungen:
[01] Bis 1992 war Rom in 20 Municipi (Stadtteile) gegliedert. Damals spaltete sich das XIV. ab und bildete die Comune di Fiumicino. Die Nummerierung aber wurde beibehalten und die 14 einfach übersprungen. Es sind nun also 19 Municipi, gezählt wird aber trotzdem bis 20. Die Municipi werden ihrerseits wieder in «urbanistische Zonen» und Quartiere unterteilt
[02] Die ebenfalls vom IACP initierten und unter der Leitung von Mario Fiorentino 1975–1982 errichteten Bauten des Quartiers Corviale – piano di zona Nr. 61 – orientierten sich am Vorbild von Le Corbusiers Unité d’Habitation in Marseille
[03] Stanislaus von Moos: Le Corbusier, Elements of Synthesis. 010 Publishers, Rotterdam, 2009, S. 137
[04] «[…] La pura vitalità che è alla base di queste anime, vuol dire mescolanza di male allo stato puro e di bene allo stato puro: violenza e bontà, malvagità e innocenza, malgrado tutto.» Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini (Hrsg.), Pier Paolo Pasolini: un poeta d’opposizione. Skira, 1995, S. 132
[05] «Le Vele» (die Segel), wie die Bauten im neapolitanischen Stadtteil Scampia im Volksmund genannt wurden, entstanden ebenfalls aufgrund des Gesetzes Nr. 167 in den Jahren 1962–1975. Projektiert von dem Architekten Franz Di Salvo und dem Ingenieur Riccardo Morandi, waren sie eine Mischung aus Zikkurat, Unité d’habitation, Turm, Zelt und eben Segel. Da auch hier die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur nie wie geplant installiert wurde und die Camorra alsbald das Regime übernahm, verkamen die Bauten. Zwei der sieben Vele wurden 1997, eine 2003 abgerissen
[06] AAd’A ist ein Netzwerk von Architekten, Urbanisten, Landschaftsarchitekten, Künstlern, Anthropologen und Soziologen, die auf dem Gebiet der Transformation und Revitalisierung von brachliegenden oder vernachlässigten urbanen und ruralen Territorien arbeiten. 2002 gründeten Mauro Manna, Antonello Piccirillo, Luca Piccirillo und Anke Jaeger die römische Niederlassung des Netzwerks und bearbeiten seither das Thema der Peripherie im südlichen Quadranten der Stadt, u. a. indem sie das «Laboratorio Territoriale Laurentino » koordinieren. «Il Gabbiano» ist eine Cooperative, die sich seit zwanzig Jahren um die Integration von sozial benachteiligten Menschen bemüht. 1997 gründete die Cooperative einen Sitz im Laurentino 38, wo sie Arbeitsmöglichkeiten anbietet
[07] Associazione Laurentum Fonte Ostiense, Comitato Inquilini Laurentino, Associazione L’ancora 95, Associazione Ponte d’incontro, Laurentinokkupato, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione del Cuore, Banca Del Tempo, Club Hamici, Associazione Donne InsiemeTEC21, Fr., 2010.04.23
23. April 2010 Rahel Hartmann Schweizer