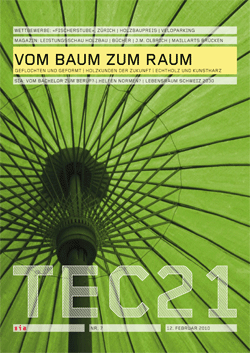Editorial
«Holz ist gemütlich», weiss der Volksmund. Daher erstaunt es nicht, wenn Häuslebauer vom eigenen Chalet träumen. Doch auch bei vielen Menschen, die sich an der elterlichen Wohnwand sattgesehen und vom Durchschnittsgeschmack vermeintlich losgesagt haben, löst Holz positi-ve Emotionen aus: Designbewusste kaufen verkratzte Bistrotische, Aussteiger richten sich in umgebauten Scheunen ein, Bankenkunden erwarten mit Edelfurnier verkleidete Tresen. Die haptischen und ästhetischen Qualitäten von Holz bedienen offenbar unterschiedlichste Sehnsüchte – welche dies sind und wie die Holzbauindustrie darauf zu reagieren gedenkt, ist Gegenstand der Forschung (S. 37ff.). Auch materialtechnisch er-weist sich Holz als verblüffend wandlungsfähig: Es eignet sich nicht nur für traditionelle Bauweisen, sondern auch für modernen Systembau, computergestützte Fertigung oder die Herstellung holzbasierter Hybridwerkstoffe (vgl. TEC21 11/2008, 8/2009, 3-4/2010). Selbst in ausgefallensten Formen wirkt Holz wohltuend vertraut.
In den letzten Jahren hat der Baustoff ein weiteres schmeichelhaftes Attribut erhalten: «Holz ist ökologisch». Dass der Begriff Nachhaltigkeit ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammt – bereits 1713 forderte Hans Carl von Carlowitz in «Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht» eine «nachhaltende Nutzung» der Wälder – mag zu dieser Wertung beigetragen haben. Tatsache ist, dass Holz ein natürlicher Rohstoff ist, der während seiner Entstehung unverzichtbarer Teil des ökologischen Kreislaufs ist und in verbauter Form CO2 bindet. Holz ist vielerorts vorhanden und meist gut verfügbar. Nach dem Orkan Lothar, der vor 10 Jahren Millionen von Bäumen in West- und Mitteleuropa fällte, war es auch billig: Grosse Mengen Bruchholz mussten rasch verbraucht werden, um weitere Waldschäden – etwa durch eine Massenvermehrung von Borkenkäfern – zu verhindern; die Preise sanken, das Umweltbewusstsein der Konsumenten stieg. Heute gilt aus zertifiziert umweltgerechter Waldwirtschaft stammendes Holz als politisch korrekter Baustoff par excellence.
Dennoch muss der reflexartig geäusserte Glaubenssatz über die ökologischen Vorzüge von Holz in manchen Fällen hinterfragt werden. Wird Holz lokal verarbeitet und verbaut, ist es in Bezug auf graue Energie ausgesprochen vorteilhaft; doch stimmt die Bilanz noch, wenn Bauteile aus grossen Blöcken gefräst und um den halben Erdball transportiert werden (S. 30ff)? Wie «natürlich» ist ein Hightech-Holzträger, dessen statische Eigenschaften durch ein eigens entwickeltes Kunstharz gesichert werden müssen (S. 40ff)? Der Weg vom Wald zum Gebäude ist manchmal indirekt – und führt über ebenso kunstvolle wie technisch hochstehende Umwege.
Judit Solt
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Restaurant Fischerstube, Zürich | Holzbaupreis Niederösterreich 2009 | Veloparking Süd am Bahnhof Aarau
12 PERSÖNLICH
Urs B. Roth: «Kein Mensch wartete auf mich»
15 MAGAZIN
Leistungsschau des Holzbaus | Bücher | Olbrich und sein Gesamtkunstwerk | Maillarts Brücken im Wägital | Günstiger Wohnraum ist planbar
30 GEFLOCHTEN UND GEFORMT
Charles von Büren, Hermann Blumer, Franz Tschümperlin
Der japanische Architekt Shigeru Ban hat in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit Schweizer Ingenieuren zwei Pionierbauten aus Holz fertig gestellt.
37 HOLZKUNDEN DER ZUKUNFT
Frieder Rubik, Franziska Mohaupt
Wo liegen die Chancen der Holzverwertungskette? Welche Bauherrschaften und Unternehmungen werden künftig mit Holz bauen? Ein Forschungsprojekt sucht Antworten.
40 ECHTHOLZ UND KUNSTHARZ
Tobias Götz, Thomas Strahm
Justus Dahinden und Pirmin Jung Ingenieure haben das Bad «aquabasilea» mit einem Holzdach ausgestattet, dessen Spannweite eine besondere Konstruktion erforderte.
46 SIA
Vom Bachelor zum Beruf? | Helfen Normen oder hindern sie? | Lebensraum Schweiz 2030 | Bauen am richtigen Ort
52 PRODUKTE
54 MESSE
Salon Bois, Bulle, vom 12. bis 14. März 2010
55 WEITERBILDUNG
Kurs Hochleistungs-Wärmedämmung
69 IMPRESSUM
70 VERANSTALTUNGEN
Geflochten und geformt
Der japanische Architekt Shigeru Ban hat in den letzten Monaten zwei neue Projekte vorgelegt: Ein Clubhaus bei Seoul in Südkorea wurde Ende 2009 fertig gestellt, das Centre Pompidou im französischen Metz wird im Mai 2010 eröffnet. Beide Bauten haben ein filigran geflochtenes, frei geformtes Holzdach. Konstruiert haben es die Schweizer Ingenieure Franz Tschümperlin (SJB Kempter Fitze) und Hermann Blumer (Création Holz).
Auch wenn traditionelle Erzeugnisse aus Asien – ein Sonnenhut bzw. ein Kissen aus geflochtenem Bambus – die netzartige Dachkonstruktion der Bauten in Metz und Yeoju inspiriert haben, ist das gebaute Ergebnis in beiden Fällen eine Hochleistung moderner Holzbautechnologie. Die Dächer wirken leicht, ausgewogen und organisch gewachsen; doch ohne digitale Hilfsmittel wären weder Planung noch statische Berechnung, Fertigung, Transport oder Baukoordination denkbar gewesen.
Centre Pompidou, Metz (F)
Der Neubau liegt im Quartier Amphithéâtre beim TGV-Bahnhof am Rand des Stadtzentrums von Metz. Es bildet das Kernstück eines ambitionierten Plans des Architekten und Urbanisten Nicolas Michelin, den Stadtraum aufzuwerten. Der Neubau enthält nebst zahlreichen Ausstellungsräumen auch ein Studio für Aufführungen und künstlerische Aktionen, ein Auditorium, eine Buchhandlung, ein Restaurant und ein Café. Der Standort Metz wurde gewählt, weil er nahe bei Luxemburg, Belgien, Rheinland-Pfalz und dem Saarland liegt; über TGV und Autobahnen erschlossen, kann die Hauptstadt von Lothringen eine internationale Ausstrahlung entwickeln. Der internationale Architekturwettbewerb für das Projekt wurde im März 2003 ausgeschrieben. Aus 157 eingegangenen Dossiers wurden sechs für die engere Wahl bestimmt. Das Projekt von Shigeru Ban, Jean de Gastines (Paris) und Philip Gumuchdjian (London) in Zusammenarbeit mit Cecil Balmond (Arup, London) erhielt einstimmig den Zuschlag. Bereits im Juni 2004 wurde das Vorprojekt erstellt, im September 2005 die Baubewilligung erteilt und im November 2006 der Grundstein gelegt. Die Eindeckung mit dem Holzdach und den Membranen begann 2009.
Gemäss Shigeru Ban soll der Neubau leicht und gleichzeitig stark erscheinen und das Publikum dazu einladen, unter sein Schutzdach zu kommen. In der Tat beruht die Wirkung der Architektur vorwiegend auf dem wie ein riesiger Strohhut gebauten Holzdach mit seiner transluziden Membran – doch ist dieser Strohhut 8000 m² gross. Das Dach besteht aus Holzstäben mit einem Querschnitt von 14 × 44 cm; 18 000 Laufmeter davon wurden auf CNCgesteuerten Maschinen zugeschnitten. Diese Holzstruktur wurde in der Schweiz berechnet. Ingenieur Hermann Blumer arbeitete eineinhalb Jahre daran, bestimmte die Flächengeometrie und berechnete die Vorstatik mit den notwendigen, neuartigen Verbindungen. Fabian Scheurer von designtoproduction (Erlenbach ZH) verfeinerte diese Vorgaben zur Dachgeometrie und verschaffte so der Produktionsfirma die notwendigen CAD-Tools, um die Details zu den rund 18 000 doppelt gekrümmten Brettschichtholzteilen zu erarbeiten. Für die Holzbaustatik war SJB Kempter Fitze mit Hermann Blumer, Création Holz (Herisau), verantwortlich. Die Membran wurde in Japan produziert und besteht aus Glasfasern mit einer Teflonbeschichtung (PTFE Poly-Tetra-Fluoro-Ethylen). Sie lässt 15 % des Tageslichts durch und schützt Dach und Fassade vor Wind und Wetter. Nachts scheint das Bauwerk wie eine Laterne zu glühen.
Die Form von Grundriss und Dach basieren auf einem Sechseck. In der Mitte steht ein 77 m hoher Turm, über den die drei Ausstellungsebenen erschlossen sind und der die Dachstruktur trägt. Die Ausstellungsebenen wirken wie rechteckige, übereinander geschobene Riesenschachteln. Ihre Enden durchbrechen die Dachstruktur, sind verglast und geben den Blick über die Stadt frei. Die Innenräume sind hell: Die Wände sind weiss gestrichen, die Böden aus perlgrauem Beton, das Dach aus hellem, natürlich belassenem Holz und mit der lichtdurchlässigen Membran versehen. Die Räume sind vielseitig nutzbar. Insgesamt weicht die Architektur des Centre Pompidou Metz weit vom Herkömmlichen ab und erinnert kaum an bereits Gebautes.
Clubhaus Hasley – Nine Bridges, Yeoju (SüdKorea)
Der Hasley Country Club in Yeoju, eine Fahrstunde südlich von Seoul, ist ein 18-Loch-Privatplatz, der dereinst zu den Top Ten der Golfclubs weltweit gehören will. Deshalb wurde auch für die Architektur eine besondere Gestaltung gesucht. Shigeru Ban setzte aus ökologischen und bautechnischen Gründen vor allem auf Holz (wobei die Vorzüge des Materials und der Vorarbeiten in der Schweiz trotz dem langen Transportweg überzeugt haben).
Die Anlage besteht aus drei Gebäudekomplexen: einem Clubhaus für reguläre Mitglieder, dem Trakt für VIP-Mitglieder und den Empfangsräumen für VIP. Jeder Bauteil ist unterschiedlich konstruiert. Das baulich prägende Clubhaus besteht aus einer Holzkonstruktion, die in ihrer Grundform auf das traditionelle, aus Holzspänen geflochtene, «bamboo wife» genannte Sommerkissen zurückgeht. Der VIP-Teil ist weitgehend eine Stahlkonstruktion, im VIPClubhaus finden sich zudem Betonstrukturen. Alle Bauten beziehen sich in zeitgemässer Sprache auf tradierte Architekturformen Koreas.
Das Clubhaus ist grosszügig angelegt und dreigeschossig. Die Empfangshalle erstreckt sich über die gesamte Gebäudehöhe von über 13 m (Abb. 17). Im Erdgeschoss finden sich eine Restaurantzone, Konferenzräume, ein Spa, kleine Appartements für Mitglieder und technische Räume wie Küchen, Vorratsräume und Büros. Die zweite Etage enthält weitere Räume des Spa, eine VIP-Lounge und Appartements. Im dritten Geschoss liegt ein Aufenthalts- und Esssaal mit Bar. Hier ist die Holzstruktur aus nächster Nähe sichtbar (Abb. 18); deshalb galt für die gesamte Konstruktion ein strikter Anspruch auf höchste Qualität der Detailausbildung und der Passgenauigkeit der Holzverbindungen. Die einzelnen vorgefertigten und als grosse Strukturen zusammengefügten Teile mussten sich wie ein Designermöbelstück in die Innenarchitektur integrieren.
Das Golfhaus ist als geometrisch ausgerichteter «Wald» aus 21 Bäumen entworfen. Diese Baumstützen tragen die 36 × 72 m grosse Dachfläche. Das zweiseitig Last abtragende «Astgeflecht» der Kronen verläuft bis in das 4.50 m breite Vordach. Die gesamte Höhe der Konstruktion misst 13.6 m. Wie in der Natur, so ist auch bei dieser Konstruktion kein Stab gerade. Sämtliche Flächen sind mindestens einfach, meist zweifach gekrümmt. Auf den Kronen ruht ein Trägerrost mit Haupt- und Nebenträgern, in denen 21 Lichtkuppeln mit einem Durchmesser von 3 m integriert sind. Den oberen Abschluss der Holzkonstruktion bildet eine Dreischichtplatte. Ban betont, dass diese Holzkonstruktion aus ökologischen Gründen gewählt wurde, und bezieht sich auf Fachpublikationen von Klaus Richter, Leiter der Holzabteilung der Empa in Dübendorf. Gleichzeitig legte er Wert darauf, ausschliesslich mit smarten EDV-Programmen und hochpräziser Vorfertigung zu arbeiten.
Für die Planung und Berechnung der Raumgeometrie, die Ingenieurarbeiten und die Produktion wurden Firmen und Personen aus der Schweiz beigezogen. Im Juni 2008 stellte sich die Blumer Lehmann AG in Gossau anlässlich einer Betriebsbesichtigung einer koreanischen Delegation vor. Diesem ersten unverbindlichen Kontakt folgte die Anfrage nach einer Kalkulation. Der Auftrag sah einen ausserordentlich engen Zeitrahmen vor: Das Dach sollte Ende Februar 2009 gebaut sein. Innert kürzester Zeit (rund eine Woche) war aufgrund der Konzeptpläne aus Korea eine zweifach gekrümmte Dachkonstruktion zu gestalten, zu erfassen und in Zahlen auszudrücken.
Für die Geometrieanalyse, auf der die weiteren Berechnungen und die Produktionsplanung basierten, zeichnete die Firma designtoproduction verantwortlich. Die Berechnungen und die Parameter zur Optimierung zwischen Geometrie, Statik und Wirtschaftlichkeit bildeten richtungweisende Kernpunkte. Der eigentlich einfache, rechteckige Grundriss führte zu technisch vorteilhaften Wiederholungen von Ausführungsdetails. Die Dachkonstruktion liess sich in fünf Elementtypen aufteilen. Ein sechsstelliges Nummernsystem sicherte die Identifizierung aller Bauteile. Aufgrund der grossen Anzahl Elemente, für deren Transport insgesamt 26 Container verschifft und 9 Flüge notwendig wurden, sowie der 8000 km langen Distanz zwischen Produktionsort und Baustelle war diese präzise Identifizierung wesentlich.TEC21, Fr., 2010.02.12
12. Februar 2010 Charles von Büren
Holzkunden der Zukunft
Das Potenzial von Holz als Baustoff ist unbestritten; Holzbau ist in Zeiten energiebewussten Bauens en vogue. Dass das Material dennoch als Nischenprodukt gesehen wird, liegt auch an der oft regionalen und kleinteiligen Struktur des Holzbaumarktes. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt untersuchte die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit am Beispiel der Holzbauunternehmen in der Region Allgäu (D).
Das Projekt «Zukunftsmärkte der Forst-Holz-Kette» untersuchte die Wertschöpfungskette vom Baum bis zum Endprodukt Holzhaus und Holzfenster. Im Rahmen der Studie konnten Marktpotenziale spezifiziert und Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen aufgezeigt werden. Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, auf Expertendiskussionen, Unternehmensfallstudien und Workshops. Neben der Einstellung der Verbraucher stand das Innovationspotenzial der Betriebe im Zentrum.
Holzbaubetriebe: Status Quo
Die Unternehmen der Holzbaubranche in Deutschland sind in der Regel klein- und mittelständisch, bis zu 97 % haben weniger als 20 Beschäftigte. Firmen werden teilweise über mehrere Generationen von derselben Familie geführt und bilden zum grossen Teil selbst aus. Marketing und Vertrieb funktionieren überwiegend regional. Die Kapital- und Personaldecke ist oftmals dünn, das operative Tagesgeschäft steht im Vordergrund, langfristige Strategieentwicklung wird vernachlässigt. Durch die geringen Betriebsgrössen und kleinen Produktionszahlen entstehen leicht Kostennachteile in Produktion, Verarbeitung und Einkauf. Aufgrund des mittelständischen Charakters ist die Fertigungstiefe in vielen Fällen gering, die Betriebe beziehen zum Teil stark vorgefertigte Bauteile. Durch die Vielzahl der Unternehmen ist das Angebot diffus und fragmentiert.
Voraussetzungen für Innovation
Für die Unternehmen der Holzbaubranche ist der Ruf ihrer Firma eine entscheidende Ressource. Viele Betriebe setzen fast ausschliesslich auf Empfehlungsmarketing, diverse Unternehmen vertrauen so stark darauf, dass sie auf Werbung völlig verzichten. Qualität und Service sind vor diesem Hintergrund besonders wichtig und beinhalten Dienstleistungen wie die Betreuung der Kunden während des gesamten Bauprozesses. Daneben sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine bedeutende Ressource für die Betriebe. Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Innovationsfähigkeit hängen stark vom jeweiligen Personal ab – kleinere Unternehmen verfügen jedoch nur über eine dünne Personaldecke. Die wenigen Beschäftigten werden im Betrieb ausgebildet und sind dort über lange Jahre tätig. Damit sind sie oft zu einer neutralen Analyse nicht mehr fähig – eingeschlichene Fehler verstetigen sich. Nach ihrem Ausscheiden sind sie zudem schwer zu ersetzen. Ein systematisches Personalmanagement, das eine gute Ausbildung garantiert und engagierte Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen bindet, ist daher vonnöten, ebenso wie der frühe Aufbau von Nachwuchskräften. Weiterbildung bietet gerade diesen Betrieben gute Möglichkeiten, sich zu positionieren und Nischen auszufüllen. Ebenfalls Potenzial für Innovationen bieten Kooperationen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erweist sich dabei als sinnvoll – so kann man als Komplettanbieter im Holzbau auftreten und damit die Marktchancen verbessern. Branchenübergreifende Kooperationen, z. B. mit Fachhochschulen und Universitäten, stärken die Wettbewerbsfähigkeit. Fehlendes Eigenkapital und der schwierige Zugang zu Krediten zählen oft zu den zentralen Hemmnissen für Innovation. Insbesondere die Anschaffung von neuen Maschinen für neue Produkte sind mit erheblichen Investitionen verbunden. Hier sind innovative Finanzierungskonzepte gefordert, wie das Leasing von Maschinen oder Händlerkredite in Form von Vorfinanzierung und verlängerten Zahlungszielen. Für die Erschliessung von Zukunftsmärkten ist relevant, wie stark Unternehmen Veränderungen antizipieren und in ihren Strategien berücksichtigen. Eine systematische Einbeziehung der Endkunden findet aber noch wenig statt. Das Wissen über die Zielgruppen ist eher vage. Marktanalysen können helfen, notwendige Kenntnisse über bestehende und potenzielle Kunden zu gewinnen.
Welche Einstellung haben Verbraucher zu Holz?
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden daher in einer repräsentativen Umfrage unter der Bevölkerung Deutschlands 1004 Verbraucherinnen und Verbraucher nach ihren Einstellungen zu Umwelt, Wald, Holz und den Produktgruppen Holzhaus und Holzfenster befragt. Generell verbindet die Bevölkerung mit Wald und Holz viele positive Eigenschaften. So zeichnet sich Holz aus Verbrauchersicht vor allem durch Gesundheits- und Wohlfühl- sowie ästhetische Eigenschaften aus. Die Einstellung zur Modernität von Holz ist diversifizierter: 45 % der Befragten stimmen dem voll zu, weitere 40 % sehen das Material als eher modern. Auch die Tragfähigkeit wird überraschend positiv beurteilt: 47 % halten Holz für tragfähig, weitere 37 % für eher tragfähig. Als grösster Nachteil wird die fehlende Feuerbeständigkeit angesehen: Etwa 80 % halten Holz für überhaupt nicht bzw. weniger feuerbeständig.
Potenzial für Holzhäuser
Auf dieser Grundlage lassen sich acht Verbrauchertypen unterscheiden (Abb. 1), von denen vier als potenzielle Kunden für Holzhäuser betrachtet werden können. Im Folgenden werden diese vier Typen anhand ihrer Beziehung zur Umwelt, ihren Bauabsichten, ihrer Einstellung zum Holzbau sowie Bildungs- und Einkommensstatus charakterisiert.
Die postmateriellen Holzaffinen (14 %) haben eine emotionale Beziehung zur Umwelt. Sie sehen Wald als erneuerbare Rohstoffquelle, deren Nutzung sinnvoll und ökologisch vorteilhaft ist. Sie äussern aktuell nur in geringem Masse Bauabsichten, haben ein hohes Bildungsniveau und ein hohes Einkommen. Sie stellen eine künftige Stammkundschaft der Holzbranche dar und könnten als Multiplikatoren für andere Zielgruppen dienen.
Die Holznewcomer (17 %) sehen keinen Widerspruch zwischen der Nutzung von Wald als Rohstoffquelle und der Betrachtung als Naturraum. Sie schätzen Holz als gesundes und umweltfreundliches Material ein, Begriffe wie «Wertstabilität», «Langlebigkeit» und «Feuerbeständigkeit » bringen sie jedoch nicht damit in Verbindung. Holznewcomer sind mittleren Alters bei mittlerer Bildung, die Einkommen sind eher niedrig, der Anteil der Selbstständigen ist hoch; sie sind eine städtisch geprägte Gruppe.
Die desinteressierten Holzaufsteiger (5 %) betrachten Wald nicht als unberührte Natur und sehen die Vorstellung von Wald als Rohstoffquelle skeptisch. Während sie ein eher negatives Bild von Holz als Baustoff sowie der exemplarisch gewählten Holzendprodukte zeichnen, ist die tatsächliche Verwendung von Holz als Baumaterial für Häuser jedoch sehr hoch. Die Gruppe zeichnet sich durch hohe Bildung und ein hohes Einkommen aus.
Die etablierten Holzaffinen (11 %) befürworten die Waldnutzung durch Holzentnahme und als Erholungsraum. Holz besitzt ein positives Image, insbesondere aufgrund gesundheitlicher und ökologischer Aspekte. Sie bewerten Holz als wertbeständig und langlebig. Sie haben eine mittlere bis gehobene Bildung bei einem hohen Einkommen (v. a. Selbstständige, Freiberufler), allerdings will nur ein kleiner Teil in den nächsten Jahren bauen. Dennoch können sie aufgrund ihrer Holzfreundlichkeit als Multiplikatoren wirken. Die Befragung ergab, dass 47 % der Bevölkerung als erreichbare Zielgruppe für das Bauen mit Holz eingestuft werden kann. Aktuell werden in Deutschland jedoch nur etwa 13 % der Wohnbauten aus Holz erstellt: Hier ergibt sich ein beträchtliches Potenzial für die Zukunft.
Entscheidende Faktoren bei der Baustoffwahl
Bei der Wahl des Baustoffes handelt es sich um eine grundlegende Richtungsentscheidung in einem Bauprojekt. Sie muss so früh wie möglich erfolgen, d. h. bereits bei der Klärung der Frage, wann und wie gebaut wird. Dabei sind eine Reihe von Faktoren entscheidend: Innerhalb des Familien- und Bekanntenkreises, der als wichtigster Einflussfaktor gilt, wird ein Bauvorhaben diskutiert. Damit werden die Eckpfeiler der Investition konkretisiert, etwa Haustyp, Standort, Finanzierung – und Baustoffwahl. Daneben zeigen Medien die Bandbreite möglicher Bauvorhaben auf, im Hinblick auf architektonische Trends, bautechnische Möglichkeiten oder die Finanzierung. Baumessen stellen den wichtigsten Erstkontakt zu Herstellern her. Sie informieren über Realisierungsmöglichkeiten und den Stand der Technik.
Weitere Informationsquellen sind die Besichtigung von Musterhäusern und persönliche Beratungsgespräche. Ein wenig beachteter Schlüsselakteur ist die Baufinanzierung durch Banken. Durch ihre Vergabekriterien für Baukredite haben sie grossen Einfluss auf ein Bauvorhaben. Kreditinstitute schätzen Massivbau im Vergleich zum Holzbau als dauerhafter und wertbeständiger ein und tendieren daher bei der Kreditvergabe dazu, Ersteren zu bevorteilen. Eine überragende Stellung besitzen die Architekten, die bereits beim Entwurf eines Hauses bestimmte Baumaterialien vor Augen haben. Da sie oft nur über geringe Erfahrungen mit Holzbau verfügen – etwa, weil dieser während des Studiums nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat –, bevorzugen sie andere Baustoffe. Zudem gibt es erhebliche Kooperationsdefizite zwischen Architekten und der Holzbranche.
Kunden der Zukunft – Empfehlungen für die Holzbaubranche
Zur Förderung von Holz als Baustoff ergeben sich aus diesen Einflussfaktoren und aus der Berücksichtigung von Schlüsselakteuren einige Anknüpfungspunkte für die Holzbaubranche zur besseren Nutzung vorhandener Potenziale. Wir empfehlen vier Massnahmebündel:
– Verbesserung und Garantie von Mindestqualitäten. Dies betrifft die qualitative Verbesserung der Produkte, die Garantie einheitlicher Produktqualitäten, Innovationen im Bereich vorgefertigter Systemlösungen bei Holzbauelementen, energieeffizientes Bauen sowie neue Produkt-Dienstleistungs-Systeme.
– Qualitäten sichtbar machen: Holzqualitäten kommunizieren, etwa durch das Setzen architektonischer Trends, Fassadeninnovationen, Herausstellung der Vorteile gegenüber anderen Baustoffen, Garantie der Dauerhaftigkeit von Holzbau, zielgruppenorientiertes Marketing.
– Wettbewerbsfähigkeit durch Brancheninnovationen, v.a. durch eine effizientere Gestaltung der Interessenvertretung, Erschliessung neuer Marktsegmente durch Spezialisierung und Arbeitsteilung, gewerkeübergreifende Kooperationen und Kompetenzaufbau während der gesamten Bauphase.
– Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen, v. a. stärkere Berücksichtigung des Holzbaus in den Curricula der Ausbildung, eine bessere Ausrichtung der Normung und der Standardisierung auf den Holzbau sowie der Ausbau der «politischen Priorisierung» des Holzbaus bspw. über die öffentliche Beschaffung.TEC21, Fr., 2010.02.12
12. Februar 2010 Frieder Rubik, Franziska Mohaupt