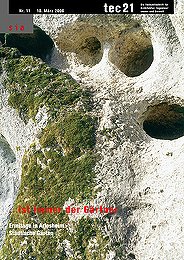Editorial
Lustwandeln
Gärtnern ist schwierig geworden, zum Beispiel im Zürcher Arboretum. Der historische Park am See ist inzwischen so beliebt, dass man im Sommer Angst um die Anlage haben muss. Parks sind für die Öffentlichkeit, und nichts ist schlimmer als ein verlassener, öder Park. In Zürich reden Fachleute schon von «Übernutzung». Da wird grilliert und gefeiert, gespielt und konsumiert, übernachtet und Abfall entsorgt. Die Verantwortlichen düngen als Reaktion die Liegewiese wie einen Sportrasen, Blumenbeete werden pro Saison mehrmals neu bepflanzt, und die mobilen WC-Häus-chen sollen jetzt zu veritablen WC-Häusern werden, was in einer geschützten Anlage nicht ganz einfach zu bewerkstelligen ist. Weil Zulieferer für die fliegenden Händler das Fahrverbot missachteten und die Äste der Bäume gefährdeten, verhindern heute schnell installierte Metalltore die Zufahrt von grossen Fahrzeugen. Und wehe, es herrscht wieder sonniges Wetter während der Streetparade. Denn dann tanzen sie wieder im Schatten unter den Bäumen und bedrohen das Wurzelwerk der über hundertjährigen «Grünsubstanz».
Also: Entweder passen die Gärtner die Parks uns an, oder wir versuchen, von den Gärtnern zu lernen. Offenbar suchen wir aber doch immer wieder das kleine Paradies in der Natur und nicht die massentaugliche und cleane Anlage. Bleibt uns noch, das Verhalten zu ändern. Aber wollen wir wirklich wieder ein «Rasen betreten verboten»? Wir lassen uns eben nicht stören bei dem, was inzwischen erlaubt ist. Müssen wir wieder promenieren lernen? Anders als lustwandelnd und naturbetrachtend können Besucher übrigens die Ermitage in Arlesheim gar nicht erfassen. Die Wege durch den diesjährigen Träger des Schulthess-Gartenpreises – ein 1785 konzipierter «Erlebnispark» – führen zu verschiedenen Gartenszenen und Attraktionen. Wie das bei der Gartendenkmalpflege immer häufiger gebrauchte Arbeitsinstrument des Parkpflegewerks in Arlesheim angewendet wird, erläutert Claudia Moll in diesem Heft. Sie hat den kaum bekannten Landschaftsgarten besucht. Begleitet wird der Text mit Bildern von Roger Frei, den wir losgeschickt haben, den Park zu erwandern. Die Gartendenkmalpflege kämpft wie in der Ermitage häufig gegen zu viele Pflanzen und gegen Überwucherung. Sie muss die Arten und Sorten kennen, die sie wieder pflanzen möchte oder die sie in grosser Vielfalt in den historischen Anlagen vorfindet. Dafür benötigt sie ein fundiertes «Gärtnerwissen».
Dieses fehlt ausgerechnet vielen Schweizer Landschaftsarchitekten. Landschaftsarchitektur als Design-Disziplin? Oder ist es nur die Angst vor den Pflegekosten, die auf Pflanzenvielfalt verzichten lässt? Oder aber fürchten sich unsere Landschaftsarchitekten tatsächlich, in die «Gärtnerecke» gestellt zu werden? Hansjörg Gadient zeigt in seinem Artikel, wie heutige Gärten aussehen können, wenn sie üppiger werden und die Pflanzenvielfalt zunimmt. Einen Garten zu entwerfen mit über hundert Arten – statt mit drei bis zehn – setzt solides Pflanzenwissen voraus. Dieses könnte auch das Ende für den Minimalismus in der Schweizer Landschaftsarchitektur bedeuten.
Gute Gärtner wünscht man sich. Schliesslich war es der Pariser Gärtner Joseph Monier, der seine Blumentöpfe aus Zement mit einem Drahtgeflecht verstärkte. 1867 meldete er sein Patent an und gilt damit als der Erfinder des Stahlbetons, eines Werkstoffes, der heute selten in einem Garten fehlt. Am Ende ist es dann doch immer der Gärtner.
Ivo Bösch, boesch@tec21.ch
Inhalt
Das geheimnisvolle Tal
Claudia Moll
Zu Besuch im noch kaum bekannten, aber doch grössten sentimentalen Landschaftsgarten der Schweiz: der Ermitage in Arlesheim. Der Schweizer Heimatschutz zeichnet sie dieses Jahr mit dem Schulthess-Gartenpreis aus.
Städtische Gärten
Hansjörg Gadient
Seit den 1960er-Jahren dominieren minimalistische Ansätze die Aussenraumgestaltungen. Sind sie noch aktuell? Zwei grosse öffentliche Anlagen lassen auf eine zeitgemässere Entwicklung hoffen.
Wettbewerbe
Neue Ausschreibungen und Preise | Zwei Wettbewerbe in Basel: Volta-Zentrum mit Vogesenplatz und die neuen Tramhäuschen | Bewährter Schulgrundriss in Altstätten | Campingkultur in Bern | Olma-Hybrid in St.Gallen
Magazin
Publikationen zur Landschaftsarchitektur | Erster Natur-Kongress | In Kürze | Internationaler Master in Geophysik | Wechsel in der tec21-Umweltredaktion | Alpen-Hochhaus | Regionalbahnhöfe
Aus dem SIA
SIA 118: Kommission prüft Anpassungsbedarf | Der SIA zur Aufhebung der Lex Koller | SIA Form: Kurse im 1. Halbjahr 2006
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Städtische Gärten
(SUBTITLE) Alte und neue Tendenzen in der Schweizer Landschaftsarchitektur
Seit den 1960er-Jahren dominieren minimalistische Ansätze die Aussenraumgestaltungen. Sind sie wirklich noch aktuell, und befriedigen sie die Bedürfnisse einer zunehmend städtischen Bevölkerung? Zwei grosse öffentliche Anlagen lassen auf eine zeitgemässere Entwicklung hoffen.
Fast 75% der Schweizer Bevölkerung leben heute in Agglomerationen oder Städten.[1] Damit geht ein Naturverlust einher, der schmerzlich spürbar wird. Die Landschaftsarchitektur hätte eine Chance, mit zeitgemässen Gestaltungen einen Teil dieses Verlustes zu kompensieren. Aber ihre Haupttendenz, ein oft ausgemagerter Minimalismus, wird dieser Herausforderung nicht gerecht.
Es gibt besondere Orte, wo reduzierte Konzepte Sinn machen. Vogt Landschaftsarchitekten haben in zwei Innenhöfen des neuen «Hyatt Park»-Hotels in Zürich[2] zwei so genannte Wettergärten geschaffen. Das sind zwei Dachterrassen im zweiten Obergeschoss, je dreiseitig von Wänden mit Hotelzimmern dahinter umgeben. Im ersten Hof blicken die Gäste auf eine Fläche von bemoosten Tuffsteinquadern. Im zweiten blicken andere auf leicht konkav und konvex geschliffene Steinplatten, auf denen trocknendes Wasser immer neue Bilder schafft. Auf dem dünnen Wasserfilm spiegelt sich der Himmel. Beide Gestaltungen reagieren auf die Situation, eine «Dachbegrünung» zu sein, und funktionieren als poetischer Gegenpol zur disziplinierten Architektur. Warum sind hier Reduktion und Minimalismus nicht enttäuschend und langweilig? Sie sind auf die Nutzer abgestimmt: Gäste verweilen kurz und nehmen den Hof nur als Bild wahr. Sie brauchen weder einen jahreszeitlichen Wechsel noch den Kontakt zu Pflanzen und Natur, denn beides suchen sie an diesem Ort nicht.
Benutzerbedürfnisse
Bei einem Stadtpark inmitten eines Wohnquartiers ist das anders: Die Bewohner leben ständig dort. Der Park könnte ihr Naherholungsraum sein, ihre tägliche Begegnung mit den Jahreszeiten, mit den Phänomenen der Natur, mit Pflanzen und Tieren. In Japan ersehnt und feiert das Volk die Kirschblüte. In Berlin gibt es Parks, in denen Nachtigallen brüten, und die Anwohner warten jedes Jahr geduldig, bis sie zu schlagen beginnen. Dann kann man Kinder sehen, die abends um elf von ihren Eltern in den Park geführt werden, um zu lernen, wie eine Nachtigall schlägt! Welches Kind bei uns (von den Erwachsenen ganz zu schweigen) könnte eine Nachtigall am Gesang erkennen?
Formaler Minimalismus gepaart mit einer auf wenige Arten reduzierten Pflanzenpalette und entleerten Räumen verhindert solche Erlebnisse. Parks müssten heute weit mehr sein als spartanische Exerzitien formaler Reduktion. Die Sehnsucht der städtischen Bevölkerung nach Natur ist stärker denn je.
Die zeitgenössische Schweizer Landschaftsarchitektur nimmt hier eine Aufgabe nicht wahr, die seit einigen Jahrzehnten[3] immer drängender wird: Natur in einer gestalterisch gekonnten Form in die Städte und Agglomerationen zu integrieren und Kompensation zu schaffen für verlorene Landschaft. Stattdessen vollzieht sie einen Minimalismus nach, den sie in der Architektur zu erkennen glaubt. Sie vernachlässigt eine ihrer wichtigsten Kernkompetenzen und ihr wichtigstes Material: die Pflanzen. Es gibt selbstverständlich – wie bei jeder Vereinfachung – Ausnahmen; die zwei wichtigsten und schönsten Beispiele dafür zeigt der Beitrag am Schluss. Im Folgenden sollen die Ursachen dieser Entwicklung aufgezeigt werden.
Aktuelle Ursachen
Es gibt viele praktische Gründe und einige historische Ursachen für die Tendenz zu reduzierten Anlagen. Da ist zuerst der gefürchtete Pflegeaufwand – ein nur bedingt stichhaltiges Argument, denn hohe Pflegekosten hängen eher mit falscher Planung zusammen als mit zu grossen Pflanzenpaletten. Ein echtes Problem sind die fehlenden Pflegefachleute. In öffentlichen Anlagen sind heute oft angelernte Arbeitskräfte beschäftigt, die kaum gärtnerische Kenntnisse haben. Ein grosses Hindernis ist der Mangel an Kenntnissen über Pflanzen und Pflanzenverwendung, an Erfahrung mit komplexeren Pflanzengesellschaften und generell an Interesse der Planenden für ihren Hauptwerkstoff. Den Ausbildungsstätten kann hier ein grosser Vorwurf nicht erspart werden. Aber die Studierenden sind auch Kinder ihrer Zeit, oft schon in Agglomerationen oder Städten ohne Kontakt zur Natur aufgewachsen und an Landschaftsarchitektur vor allem als Design-Disziplin interessiert. Als Folge enthalten minimalistische Anlagen vielleicht noch drei bis zehn Pflanzenarten, meist aus einem robusten, bekannten und bewährten Sortiment, während anspruchsvolle Anlagen es dagegen auf über hundert Pflanzenarten und -sorten bringen.
Der historische Grund für eine reduzierte Pflanzenwahl fusst auf einer Art Standesdünkel. Viele Landschaftsarchitekten fürchten, in die «Gärtnerecke» gestellt zu werden. Die leichte Verachtung gegenüber allem «Gärtnerischen» hat innerhalb der Profession tiefe Wurzeln.
Historische Gründe
Noch zu Beginn des Jahrhunderts waren die wichtigeren Landschaftsarchitekten gleichzeitig Gartenbau-Unternehmer.[4] Sie hatten eine enge Verbindung zu Zucht und Produktion von Pflanzen. Ihre Gestaltungen waren von den selbstverständlichen Kenntnissen des Materials geleitet und inspiriert; ihre Anlagen basierten auf den Errungenschaften des 19. Jahrhunderts und deren Obsession für Pflanzensammlung und -zucht. In den 1930er-Jahren begannen sich Gartenbau und -planung in verschiedene Berufe aufzuspalten. Seither bemühen sich viele Gestalter um künstlerische oder akademische Distanz.
Bis um die Jahrhundertwende dominierte der Landschaftsgarten englischen Stils, ziemlich unabhängig von Aufgabe oder Grundstücksgrösse. Dem folgte als kurze formale Gegenbewegung der Architekturgarten, eine von der Arts-and-Crafts-Bewegung in England inspirierte Tendenz. Ihre formalen, kontrollierten und oft auf wenige Pflanzenarten beschränkten Schöpfungen bildeten geometrische Räume aus beschnittenen Gehölzen. Die Bewegung hielt sich in der Schweiz nur kurze Zeit; es gibt kaum erhaltene Beispiele.
Im Gefolge der modernen Architektur der 1920er-Jahre wird der Architekturgarten vehement abgelehnt, und es erscheint eine Gegenbewegung in Richtung freierer Formgebung. 1927 bemerkt Le Corbusier: «Die Zeit der Garten-Architektur ist vorbei. Der Garten ist Natur ums Haus. (…) Die kristallinen Formen konkreten Denkens gehen nicht über den Architekturkörper hinaus, sondern treffen hier auf gegensätzliche, Spannung bereitende Formen: die der Natur.» [5] In dieser Zeit setzt sich der «Wohngarten» durch, der weitgehend Le Corbusiers Forderung entspricht: Pflanzen und gärtnerisches Konzept sind die konstituierenden Elemente; allfällige Bauten folgen freieren Formen, vermeiden harte Geometrien. Bis in die späten fünfziger Jahre ist der Wohngarten in der Schweiz der vorherrschende Stil.
Ikone der Entleerung
1959 legt Ernst Cramer mit dem «Garten des Poeten» den Grundstein für eine bis heute anhaltende minimalistische Entwicklung. Inmitten der als «Blumen-Landi» apostrophierten ersten Schweizer Gartenbau-Ausstellung, der «G59», legt er ein Wasserbecken an, um das er vier Rasenpyramiden und einen gestuften asymmetrischen Kegelstumpf gruppiert. Die Pflanzliste enthält zwei Positionen: Rasen für die Erderhebungen und – wie ein ironischer Kommentar zu den Blumenrabatten der restlichen Gartenschau – rote Geranien in einem runden Betonkübel. Alle Beläge und selbst die Sitzgelegenheiten sind aus Beton, einem bis dahin im Garten undenkbaren Material.
Der Garten machte Furore und gilt bis heute als die früheste und konsequenteste Anlage ihrer Art. Ab 1960 setzen sich in der Gartenarchitektur geometrische Formensprache und gestalterische Reduktion durch, die in der Architektur seit der klassischen Moderne Gültigkeit haben. Als Vorbilder beziehen sich die Landschaftsarchitekten auf Architekten und auf die Land-Art.
Es mutet anachronistisch an, dass zu einer Zeit, in der sich in der Architekturtheorie bereits die Postmoderne ankündigt,[6] in der Landschaftsarchitektur der Moderne erst zum Durchbruch verholfen wird.
Der «Garten des Poeten» wirkte auch als erstes Vorbild für die rigorose Reduktion der Pflanzenpalette. Seit den 1960er-Jahren kamen neue Anlagen mit ganz wenigen Pflanzenarten aus, diese aber meist auf grossen Flächen massiert. Mit solchen strengen Freiräumen wollten sich die Gartenarchitekten nicht nur von den veralteten Wohngärten, sondern vor allem auch vom ungezügelten Wildwuchs der Privatgärten abgrenzen.
Naturgarten als Gegenbewegung
Im Siedlungsbau der sechziger und siebziger Jahre wurde die gestalterische Reduktion in Form von Rasen-, Koniferen- und Cotoneaster-Wüsten erbarmungslos durchexerziert. Eine Gegenbewegung wurde überfällig. Die Naturgartenbewegung bildete einen kurz auflebenden Gegenpol zur gestalterischen Radikalität der modernistischen Gärten und des sterilen Abstandsgrüns. Sie wurde zur Zivilisationskritik hochstilisiert und als Glaubensfrage behandelt. In der Landschaftsarchitektur war sie bis in die Anfänge der 1980er-Jahre von einigem Einfluss; ganz durchsetzen konnte sie sich nie, nicht zuletzt weil ihre Anlagen gestalterisch meist hilflos waren und ebenso langweilten wie sterile Rasenflächen. Der Verzicht auf eingeführte Pflanzen und gezüchtete Formen war sicher einer der Gründe dafür.[7]
Aufbau-Arbeit
Nach Entleerung und Naturgarten-Mode war in Sachen Landschaftsarchitektur viel Wiederaufbau-Arbeit zu leisten. Den wesentlichsten Beitrag dazu leistete in der Schweiz das Büro Kienast Vogt Partner. Die beiden sahen sich nie als Teile einer Tendenz oder Gegentendenz, obschon die früheren Arbeiten teilweise noch als formale Gegenreaktion auf die informelle Naturgartenbewegung oder als Fortführung cramerschen Gedankengutes gelesen werden können. Später prägen Übergänge zwischen formalen und informellen Tendenzen, zwischen Reduktion und Kultivierung von Pflanzenpaletten die Entwürfe. Es geht nicht um Rezepte, sondern um Lösungen für Orte. In einigen Fällen ist auch schon eine vorsichtige Hinwendung zu gärtnerischeren Themen zu erkennen. Günther Vogt führt heute diese Zweige – sowohl die Reduktion als auch das üppige Schwelgen und alle möglichen Zwischenstufen – fort, als je vom Ort abhängige Interventionsmöglichkeiten.
Versteinerung der Entwürfe
Cramers «Garten des Poeten» und die daraus folgende
Reduktion der Pflanzenlisten und Gestaltungsmittel führten zu einer ersten, lang andauernden Minimalisierung. Die Naturgartenbewegung brachte alles Eingeführte und alle Zuchtformen in Verruf. Als dann in den 1980er-Jahren die neuen spanischen Stadtplätze weltweit für Aufsehen sorgten, erhielt die Minimalisierungswelle einen neuen Schub. Der Landschaftsarchitekt Roland Raderschall spricht in diesem Zusammenhang von einer «Versteinerung der Entwürfe»[8]. Weltweit wurden die kargen Konzepte nachgeahmt. In der Schweiz kam ein landestypischer Hang zu Understatement und Minimalismus hinzu. Aber wie schon in den 1960er-Jahren beschleicht einen auch hier ein Gefühl des Anachronismus. Hierzulande setzt sich in der Landschaftsarchitektur der Minimalismus in einer Zeit breit durch, in der die Architektur mit Dekonstruktivismus und Blobs ihre wildesten Blüten seit dem Jugendstil treibt.
Die neue Tendenz
Aber es gibt zunehmend Gegenbeispiele, die zeigen, dass einige Landschaftsarchitekten von der zelebrierten Reduktion genug haben und üppigere, fast barocke Konzepte mit reichhaltigen Pflanzungen vorschlagen. Im Privatgarten ist das vor allem bei einigen Blumenliebhabern und Pflanzenspezialisten möglich, entfaltet aber keine Wirkung in der Öffentlichkeit. Im öffentlichen Raum ist es noch die seltene Ausnahme.
Nach vier Jahren, so sagt man, fängt ein neuer Garten an, sein Gesicht zu zeigen. Im Frühling und im Herbst des Jahres 2002 wurden zwei grosse öffentliche Anlagen fertig gestellt, die vor allem in Sachen Pflanzenverwendung neue Wege beschritten. Beide gingen erhebliche Risiken ein, vor allem was die Pflege und die Entwicklung der Pflanzen betrifft. Heute liegen bei beiden gesicherte Erfahrungen vor, und sie sind bei beiden Anlagen so positiv, dass sich eine Präsentation als erste gelungene Beispiele einer höchst wünschenswerten neuen Tendenz aufdrängt: öffentliche Gärten.
Pflanzenhalle
Beim Gang durch Neu-Oerlikon stösst man auf ein stählernes Gerüst mit unterschiedlichsten Pflanzen[9]. Beim Nähertreten zeigt sich, dass alle Pflanzen auf Stahltäfelchen doppelt beschriftet sind. Dem Neugierigen erschliessen sich so die korrekte botanische Bezeichnung auf Lateinisch und der gängige Name auf Deutsch: Rose, Geissblatt, Waldrebe, Glyzinie, Baumwürger, Wilder Wein und auf der Nordseite Efeu in verschiedensten Spielarten. Aufmerksame Besucher werden erkennen, dass es die Rosen nur bis ins erste oder zweite Obergeschoss schaffen, die Glyzinien aber schon beim Dach angekommen sind. Und sie werden sich vielleicht erinnern, dass sich das gleiche Kraut an den Turm des Landesmuseums klammert und dort spielend rund 40 m Höhe erreicht. Wer spät im Oktober noch einmal vorbeikommt, wird sich am Feuer der Herbstfarben freuen: Wein und Baumwürger glühen in Rot, Orange und Gelb. Das riesige Rankgerüst der Planergemeinschaft Burckhardtpartner Architekten und Raderschall Landschaftsarchitekten ist typologisch eine auf den städtischen Massstab übersetzte Gartenlaube. Solche Lauben sind in der Regel mit nur einer Pflanzenart bestückt, seien es Kletterrosen oder Weinstöcke. Dass bei diesem Beispiel über hundert Arten und Sorten von verschiedenen Kletterpflanzen verwendet wurden, ist die gärtnerische Besonderheit der Anlage und trägt viel zum reizvollen Gegensatz zwischen strenger Gitterstruktur und barocker Üppigkeit der Bepflanzung bei. Die Idee dazu entstand aus den unterschiedlichen Standortqualitäten der zu begrünenden Fassaden. So fiel die Wahl auf der Südseite auf Sonnenliebhaber wie Wein und Passionsblume, in absonnigen Partien auf Schattenspezialisten wie Efeu und Clematis.
Die Anlage ist auch ein Experiment. Es gibt keine Erfahrungen mit solchen Dimensionen. So sind die Fusspunkte, an denen die Pflanzen dicht gedrängt gesetzt sind, wegen der Wurzelkonkurrenz kritisch. Ein anderer Schwachpunkt ist (noch) die Gruppe der Waldreben, die sich nicht so ganz mit der Besonnung und dem heissen Boden anfreunden will. Abgängige Pflanzen werden nur zwei Mal durch dieselbe Art ersetzt. Wenn das nicht funktioniert, wird für den Standort eine andere gesucht. Das wird mit der Zeit zu einer Reduktion auf die am besten angepassten Arten und Sorten führen. Auch die langfristige Entwicklung wird eine Wandlung der Pflanzengesellschaft nach sich ziehen. Je dichter das Gerüst bewachsen wird, desto leichter werden sich die Schatten liebenden Kletterer behaupten. Und die Waldreben werden aufblühen.
Das Pflanzenkonzept des Büros Raderschall war völlig neu und barg einige Risiken. Seit der Fertigstellung der Anlage zeigt sich aber, dass es tragfähig ist und nach ein paar weiteren Jahren Wandlung und Erfahrung eine zwar etwas reduzierte, aber eingespielte und stabile Pflanzengesellschaft mit vielfältigsten Reizen ergeben wird. Die Pflege der Anlage ist im Vergleich mit den anderen Pärken in Oerlikon teurer. Die Stadt Zürich schätzt den Aufwand auf etwa eine Stelle pro Jahr. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Ursache dieses Aufwandes weniger in der Pflanzenvielfalt als in der Höhenentwicklung des Bauwerkes zu suchen ist. Schneiden und Aufbinden der Pflanzen ist in weiten Teilen nur mit einem Skylift möglich. In absoluten Zahlen allerdings erscheint der Aufwand gerechtfertigt, zieht die Anlage doch gerade wegen ihrer Pflanzenvielfalt die Menschen an.
Blumenberge
Die Pflegekosten waren auch beim zweiten gärtnerischen Grossprojekt eine Hauptsorge. Würde sich das über 5000 m² grosse Blumenbeet mit vernünftigem Aufwand unterhalten lassen? Nach vier Jahren Erfahrung mit der Pflanzung kann sich Rita Illien, die Projektleiterin im Büro Vogt Landschaftsarchitekten, beruhigt zurücklehnen. Ihre Nachkalkulationen haben ergeben, dass die Pflegemassnahmen nur unwesentlich über den Kosten für einen gepflegten Rasen liegen, nämlich bei rund 15 Franken pro Quadratmeter und Jahr. Eine wüchsige und robuste Pflanzung einerseits und qualifiziertes Pflegepersonal andererseits machen dies möglich.
Die Anlage, von der die Rede ist, liegt in St. Gallen. Es sind die so genannten Blumenberge beim Neubau der Helvetia Patria von Herzog und de Meuron[10]. Vor den Fassaden liegt ein riesiger Blumenteppich, der über sanft geschwungene Hügel gelegt ist. Zerschnitten und gespiegelt wird er von den Gebäudefassaden vervielfacht und verfremdet. Der Eindruck von Bau und Garten ist höchst barock. Die Anlage mutet trotzdem oder gerade deswegen sehr zeitgemäss an und lässt jeglichen Minimalismus als obsolet erscheinen. 193 Arten und Sorten (121 Stauden, 52 Gehölze, 20 Zwiebeln) sind darin enthalten. Schon im Februar zeigt der Blumenteppich mit den Krokussen die ersten Blüten. Ihnen folgen Narzissen und Tulpen; im Mai blühen die ersten Stauden. Während des ganzen Sommers wechseln sich über dem Blättermeer unterschiedliche Blüten in gezielt programmierten Farbabläufen ab. Bis zu den ersten Frösten im Spätherbst blühen die Astern, die Silberkerzen noch darüber hinaus. In einem sich ständig wandelnden Spiel erscheinen während der ganzen Vegetationsperiode neue Farben, Formen und Strukturen. Selbst im Winter bilden die Gehölzstreifen und die Samenstände der Stauden abwechslungsreiche Strukturen und Bilder.
Auch langfristig wird sich der Garten verändern. Noch sind die neu gepflanzten Bäume relativ klein. Sie werden den Boden im Lauf der Jahre zunehmend beschatten, und es wird sich eine andere Pflanzengemeinschaft etablieren. Die Kunst der Pflege wird dann darin bestehen, auch in den Schattenzonen abwechslungsreiche Bilder zu erhalten. Und der Garten wird von Angestellten geliebt und von Fremden respektiert. Als gestalterischer Einzelfall, aber auch als gärtnerisch gelungenes Experiment sind die Blumenberge beispielhaft für das, was möglich wird, wenn Planende die ewig gleichen festgetretenen Pfade verlassen und Neues wagen.TEC21, Fr., 2006.03.10
Anmerkungen:
[1] Aktuelle Erhebungen des Bundesamtes für Statistik
[2] Architekten: Meili, Peter, Zürich
[3] Seit den 1950er-Jahren hat sich der Bestand an Bauten in der Schweiz mehr als verdoppelt. Das heisst, dass in den letzten fünfzig Jahren mehr gebaut wurde als in allen Zeiten davor zusammengenommen.
[4] Zur Entwicklung der Schweizer Landschaftsarchitektur im 20. Jahrhundert: Archiv für Schweizer Gartenarchitektur und Landschaftsgestaltung (Hrsg.): Vom Landschaftsgarten zur Gartenlandschaft. Zürich 1996.
[5] Zit. nach Hans Rudolf Heyer: Historische Gärten der Schweiz. Basel 1980, S. 252.
[6] 1965 erscheint Mitscherlichs «Die Unwirtlichkeit unserer Städte», 1966 Rossis «L’architettura della città» und Venturis «Complexity and Contradiction in Architecture».
[7] Eine der unerfreulichen Folgen fast aller Naturgartenbewegungen des ganzen 20. Jahrhunderts ist die Forderung nach einheimischen Pflanzen. Oft ging die Vorliebe nach naturnaher Gestaltung einher mit chauvinistischem Gedankengut. Besonders profiliert hat sich damit der Deutsche Willy Lange, der schon 1927 die Ansicht äusserte, dass der Naturgarten mit einheimischen Pflanzen die höchste Form von Gartenkultur darstelle, die zu erreichen nur die nordischen Völker imstande seien. Abgesehen von der Unmöglichkeit, «einheimisch» zu definieren, ging mit der ausschliesslichen Verwendung von einheimischen Pflanzen das gärtnerische Kulturgut von Hunderten von Jahren vergessen. Zu den internationalen Naturgarten-Bewegungen s. Janet Waymark: Modern Garden Design, Innovation since 1900. London 2003.
[8] In einem Interview mit dem Schreibenden vom 20.2.2006
[9] «Die Pflanzenhalle», tec 21, Nr. 46/2002
[10] «Blühende Phantasie», tec 21, Nr. 25/2002
Zusatz:
«Gartenräume – Gartenträume»
(rhs) Obwohl immer wieder bemerkenswerte neue Gärten und Parkanlagen geschaffen oder bestehende unter Schutz gestellt werden und kaum je so viel Literatur zum Thema produziert wurde wie in den vergangenen Jahren, ist die Meinung noch keineswegs vom Tisch, es handle sich vor allem um pflegeintensive «Zugemüse» von Villen und Stadträumen oder um potenzielle Bauparzellen. So etwa im Falle des Patumbah-Parks, der noch 1985 von einem Altersheimbau bedroht war, oder der Gartenanlage der Villa Boveri in Baden, die die ABB kurz vor ihrer Unterschutzstellung 1994 mit einem Ausbildungszentrum überbauen wollte. Sie oder, genauer, ihr Gartenpavillon war denn auch Austragungsort der Lancierung des «Gartenjahrs 2006», mit dem die sechs Organisationen die Bevölkerung für die Qualitäten von Gärten und Parkanlagen sensibilisieren wollen.
Die Initianten haben ein reichhaltiges Programm von Ausstellungen, Führungen und Publikationen organisiert. Eben eröffnet wurde die Ausstellung «Stadtpark» im Kornhausforum Bern, die durch die 5000-jährige Geschichte der Gartenarchitektur führt – «von den Sumerern im Vorderen Orient bis zu den spektakulären, städtischen Parkkonzepten der letzten Jahre». Intime Einblicke in zeitgenössische Gartenanlagen lassen sich auf Führungen gewinnen, die der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter (VSSG) an den vier Mai-Wochenenden jeweils in einem Landesteil anbietet (6./ 7. Mai 2006 Wallis, 13./14. Mai 2006 Westschweiz, Bern, Solothurn, 20./21. Mai 2006 Nordwestschweiz, Innerschweiz, 27./28. Mai 2006 Zürich, Ostschweiz).
Auch der Europäische Tag des Denkmals im September unter dem Patronat der Nationalen Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (Nike) öffnet dieses Jahr unter dem Titel «Gartenräume – Gartenträume» die Tore zu über hundert Parkanlagen. Die von der Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege von Icomos Schweiz erarbeitete Liste, in der historische Gärten und Anlagen in der Schweiz erfasst werden, fügt sich ebenfalls ins Gartenjahr 2006 ein. Neben der Verleihung des Schulthess-Gartenpreises und der Publikation einer Begleitbroschüre dazu widmet sich der Schweizer Heimatschutz dem Thema auch in zwei Nummern seiner Zeitschrift und veröffentlicht zum Frühlingsbeginn einen Führer über die «schönsten Gärten und Parks der Schweiz». Ausserdem hat er ein Instrument für den Unterricht geschaffen, «Lernwerkstatt Gärten und Parks», das ebenfalls im Frühling erscheint.
Schliesslich stellt Pro Patria ihre diesjährige Sammlung unter das Thema «Historische Gärten und Parkanlagen». Unterstützt werden sollen «Schloss-, Villen-, Vorstadt- und Bauerngärten von hervorragender denkmalpflegerischer Bedeutung, allenfalls aber auch öffentliche Parkanlagen, Quaianlagen, Alleen».
Das Programm, das laufend aktualisiert wird, findet sich unter www.gartenjahr.ch.
10. März 2006 Hansjörg Gadient
Das geheimnisvolle Tal
(SUBTITLE) Zu Besuch in der Ermitage in Arlesheim
Der diesjährige Schulthess-Gartenpreis geht an die Stiftung Ermitage Arlesheim und Schloss Birseck. Der Schweizer Heimatschutz zeichnet damit das Engagement der Stiftung aus, die sich für den Erhalt des grössten sentimentalen Landschaftsgartens der Schweiz einsetzt.
In einem schattigen Tal östlich des historischen Ortskerns von Arlesheim liegt eine der bedeutendsten Gartenanlagen der Schweiz: die Ende des 18. Jahrhunderts entstandene Ermitage.
Der landschaftliche Stil des Parks hatte als Gegenströmung zu den streng gestalteten Barockgärten in den 1770er-Jahren in Europa Einzug gehalten. Neu stand die wilde, ungezähmte Natur als Schönheitsideal im Mittelpunkt. Die Landschaft selbst wurde als Garten begriffen und mit wenigen Eingriffen zu diesem gewandelt. So auch bei der Ermitage in Arlesheim.
Früher Erlebnispark
Das über dem Tal thronende Schloss Birseck, die im Talgrund stehenden Gebäude, der von Grotten und bizarren Felsformationen durchsetzte Schlosshügel boten die optimalen Voraussetzungen für die Anlage eines romantischen Gartens. Die beiden Urheber, die Baronin Balbina von Andlau-von Staal und ihr Vetter Domherr Heinrich von Ligertz, erkannten die Reize des Waldtales und wandelten es in einen romantischen Park. Haupteingriff war die Anlage eines labyrinthischen Wegnetzes, das die Besucher zu Aussichtspunkten führte, von denen aus die Blicke gezielt auf die Schönheiten der Umgebung gerichtet wurden: die weite Birsebene, die im Talgrund gelegenen Fischweiher, die zum Anwesen gehörenden Ökonomiegebäude oder die Domkirche von Arlesheim. Zudem führten die Wege die Besucher zu Gartenszenen, die sie mit Attraktionen überraschten oder als Orte der Besinnung zur Naturbetrachtung einluden. So wurden Szenen aus der antiken Mythologie in den bestehenden Höhlen nachgestellt, zum Beispiel in der Dianagrotte oder in der Appollogrotte. Von einem als Holzstoss getarnten Kabinett wurde der Blick des Eintretenden durch ein Fenster auf das Tal und seine drei Weiher gerichtet. Drei Gartenszenen widmeten sich – ganz im Sinne der Zeit – der christlichen Askese: die Grotte des Eremiten, der Eremitengarten und die Eremitenhütte. Diese Einsiedelei gab dem Garten, der anfangs noch «Solitude romantique près d’Arlesheim» hiess, bald seinen noch heute verwendeten Namen: die Ermitage.
Als der Garten 1785 eingeweiht wurde, befanden sich darin 15 dieser Gartenszenen. Die von Beginn an öffentlich zugängliche Anlage wurde schnell berühmt und erfreute sich sogar im Ausland eines grossen Ansehens; Reisende aus ganz Europa besuchten sie und gaben Anregungen zu ihrer Erweiterung und Verbesserung.
Umgestaltung, Zerstörung und Wiederaufbau
So wurde das Programm in den folgenden Jahren laufend verändert und neuen Moden angepasst. 1787 entstand zum Beispiel – sehr wahrscheinlich beeinflusst vom Epos «Die Alpen» von Albrecht von Haller aus dem Jahr 17291 – das Chalet des Alpes, eine rustikale Sennhütte, in der sich ein Konzert- und Speisesaal befand. Der Tod des Zürcher Idyllendichters Salomon Gessner gab 1888 den Ausschlag zur Umgestaltung der Grotte des Eremiten zur Gessnergrotte.
1793 wurde der Besucherstrom vorübergehend jäh unterbrochen: Im Zuge der Französischen Revolution zerstörten Franzosen und Einheimische die Anlage komplett und setzten die Ermitage und das Schloss in Brand. Balbina von Andlau kehrte danach nicht mehr in ihren Garten zurück und starb 1798 im Exil. Ihr Sohn, Conrad von Andlau, erwarb 1808 den Hof, den Burghügel und die Ruine des Schlosses Birseck. Zusammen mit dem schon alten Heinrich von Ligertz baute er die Ermitage wieder auf. Sie stellten einige der Gartenszenen wieder so her, wie sie ursprünglich waren; neue kamen hinzu, so zum Beispiel die Sophienruhe, ein Aussichtskabinett am mittleren Weiher. Als wichtigste Änderung integrierte Conrad von Andlau die Schlossruine in den Garten: Ein neu gebauter Rittersaal und die bestehende Kapelle wurden in neugotischem Stil ausgemalt und brachten als neues Thema das Mittelalter in die Gartenanlage.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts blieb die Ermitage im Besitz der Familie Andlau. Danach kaufte die Industriellenfamilie Alioth das Anwesen und bewohnte es bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Julius Achilles Alioth gestaltete die Anlage ebenfalls in einigen Bereichen nach seinem Geschmack weiter, er liess zum Beispiel zwischen dem mittleren und dem unteren Weiher eine Kaskade bauen. Zudem liess er als Erster in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts detaillierte Pläne vom Gut und auch von der Ermitage zeichnen. Mitte des 20. Jahrhunderts kam die Ermitage in den Besitz der Familie Iselin. Diesen Besitzern ist es zu verdanken, dass der gesamte Bereich – die Ermitage und die daran angrenzenden Baumgärten, Wiesen, Waldflächen und ein Rebhügel – dem wachsenden Bebauungsdruck ab Mitte des 20. Jahrhunderts standhalten konnte und frei blieb. So ist das ganze Ensemble mit der Ermitage als Kern bis heute als Einheit erlebbar.
Ort der Stille
Seit 1997 gehören Garten und Schloss Birseck der Stiftung Schloss Birseck und Ermitage Arlesheim. Zum Stiftungsrat gehören Vertreter des Kantons Baselland und der Gemeinde Arlesheim sowie Nachkommen der Familie Iselin. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass das wichtige geschichtliche Erbe auch heute noch weiterbestehen kann. Als ersten Schritt veranlasste sie, dass Parkanlage und Schlossruine 1999 unter Denkmalschutz gestellt wurden.
Die kosten- und pflegeintensiven Unterhaltsarbeiten wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte immer weiter reduziert. Heute sind grosse Teile der ursprünglich offenen Wiesenflächen verwaldet, wichtige Sichtachsen zugewachsen und die Gartenszenen teilweise verschwunden. Ein 1992 erstelltes Konzept zur Parkpflege und ein daraus resultierender Massnahmenkatalog von 2002 dienen seit der Unterschutzstellung als Leitfaden für Pflegemassnahmen, die von der Gemeinde Arlesheim ausgeführt werden. 2003 gab der Kanton Baselland ein Nutzungskonzept in Auftrag, das als Leitlinie für künftige Nutzungen gelten soll. Das Resultat dieser Arbeit kann in einem Satz zusammengefasst werden: Die Ermitage ist «ein Ort der Stille und Abgeschiedenheit». Dieser Leitgedanke wurde von allen beteiligten Partnern als verbindlicher Grundsatz verabschiedet. Konkret heisst das: Die Anlage ist zwar nach wie vor öffentlich zugänglich, es sollen aber keinerlei wirtschaftliche Nutzungen, wie zum Beispiel ein Wirtsbetrieb in einem der Waldhäuser, dazukommen. Die Ermitage soll weiterhin ein ruhiger, beschaulicher Ort bleiben, der vor allem von Spaziergängern genutzt wird.
Parkpflegewerk
Im Zusammenhang mit der Unterschutzstellung und der weiteren Mittelbeschaffung für die Unterhalts- und Pflegearbeiten forderte die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) ein umfassendes Parkpflegewerk. Seit April letzten Jahres ist das Wettinger Büro SKK Landschaftsarchitekten AG damit beauftragt. Das Parkpflegewerk wertet zum ersten Mal alle bislang entdeckten historischen Grundlagen aus: Gästebücher, Reisebeschreibungen, Stiche, Aquarelle und Pläne. Zudem orientieren sich die Landschaftsarchitekten an einer Bestandesaufnahme aller Elemente, die ein Ingenieurbüro im Auftrag der Denkmalpflege 2005 angefertigt hat, sowie an vegetationskundlichen Untersuchungen. Diese Fülle an Grundlagenmaterial zeichnet ein präzises Bild der Anlage und bildet die Grundlage für ein Leitkonzept und Massnahmenpläne.
Laut der mit der Arbeit beauftragten Landschaftsarchitektin Petra Schröder ist es wichtig, die Entwicklungsgeschichte der Anlage in ihrer ganzen Spannweite zu erforschen. Bislang wurden vor allem die beiden ersten Epochen der Entstehungsgeschichte – die Zeitspanne zwischen der Einweihung 1785 und 1792 und der Wiederaufbau ab 1812 – analysiert. Die späteren Besitzer beeinflussten die Anlage aber auch, genauso wie die heutigen neuen Nutzungsanforderungen oder die aktuelle Pflegesituation an ihr ablesbar sind. Dem zeitgenössischen Ansatz einer aufgeklärten Denkmalpflege folgend ist die Mehrschichtigkeit des Parks genauso schützens- und beachtenswert wie die ursprüngliche Anlage an sich. Ziel des Parkpflegewerkes soll laut Schröder auf keinen Fall die Rekonstruktion der ersten Epoche sein, vielmehr eine Darstellung des Wandels, den die einzelnen Orte im Laufe der Jahrzehnte erlebt haben. Vor allem sollen in Zukunft die unterschiedlichen Raumerlebnisse – enge und weite Situationen, bewachsene und freie Flächen sowie die Blickachsen – wieder erfahrbar werden. So ist auf den unter Alioth erstellten Plänen erkennbar, dass die Bewaldung ehemals offener Bereiche stark zugenommen hat – zum Beispiel bei der offenen Wiese, auf der früher das Chalet des Alpes stand. Heute unterliegt diese Fläche dem Waldgesetz. Es gilt nun nach Wegen zu suchen, um damit einen Umgang zu finden.
Die Bestandesaufnahme und die Analyse der Grundlagen sind weitgehend abgeschlossen. Im Moment werden das Leitkonzept und Massnahmenpläne erarbeitet. Diesen April soll das Parkpflegewerk als Entwurf der Stiftung vorgelegt werden. Die Stiftung will dann die darin enthaltenen Empfehlungen etappenweise umsetzen.TEC21, Fr., 2006.03.10
Anmerkung:
[1] In seinem Epos verherrlichte Albrecht von Haller das einfache Leben in der Natur und verband die Freiheit der Natur mit der Freiheit der Menschen. Das Epos gab dem Gedanken der Rückkehr zur Natur und der Abkehr von Luxus grossen Auftrieb (vgl. Heyer, S.5).
Literatur:
Hans-Rudolf Heyer: Die Eremitage in Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft. Schweizerische Kunstführer GSK Nr. 672, Bern 2000.
Ortsmuseum Trotte Arlesheim (Hrsg.): Die Ermitage in Arlesheim, ein Spazier- und Gedankengang. Arlesheim 2003.
Brigitte Frei-Heitz: Die Ermitage in Arlesheim – quo vadis?, in: NIKE-Bulletin 2–3/03, S.18–23.
Brigitte Frei-Heitz: Ermitage Arlesheim, in: anthos 1/05, S.30–32.
Zusatz 1:
Der Schulthess-Gartenpreis
Der Schweizer Heimatschutz verleiht jährlich den Schulthess-Gartenpreis, der dank dem grosszügigen Stifterehepaar Marianne und Dr. Georg von Schulthess 1998 geschaffen werden konnte. Ziel des Gartenpreises ist es, die Gartenkultur in der Schweiz zu fördern und Verständnis zu schaffen.
Mit dem Preis werden Private, Institutionen oder Gemeinden ausgezeichnet, die herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Gartenkultur nachweisen können. Die Bestimmung der Preisträger erfolgt durch eine Fachkommission. Eine preiswürdige Leistung muss botanisch und architektonisch innovativ, ökologisch fortschrittlich und für längere Zeit angelegt sein. Auch beispielhafter Umgang mit historischer Substanz oder Grundlagenarbeit können ausgezeichnet werden.
Die Feier zur diesjährigen Preisübergabe findet am 12. Mai statt.
Zusatz 2:
Parkpflegewerk
«Ein Parkpflegewerk ist ein Instrument zur Analyse, zur Dokumentation, zur denkmalgerechten Pflege, zur Erhaltung und Restaurierung historischer Gärten, Parks, Plätze und Grünanlagen.»1 In einem ersten Schritt wird die Geschichte der Anlage von ihrer Entstehungszeit bis zur Gegenwart erforscht, wertungsfrei dargestellt und untersucht; anschliessend analysiert der Gartendenkmalpfleger in einer Bestandesaufnahme den aktuellen Bestand aller Elemente (Pflanzen, Bauten, Wege etc.). Basierend auf den Resultaten aus der geschichtlichen und der aktuellen Analyse wird die Anlage bewertet. In dieser Phase können eventuelle Konflikte, zum Beispiel zwischen den Zielen der Denkmalpflege, des Naturschutzes und der heutigen Nutzung, aufgezeigt werden. Aufbauend auf der Bewertung und der Analyse der Zielkonflikte erarbeiten Gartendenkmalpfleger in einem nächsten Schritt ein Leitkonzept, dessen einzelne Punkte anschliessend in konkreten Massnahmenplänen und -vorschlägen ausformuliert werden. Ein Parkpflegewerk würdigt eine Anlage als Kulturdenkmal und dient in der Regel als Grundlage für ihre Unterschutzstellung.
[1] Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur DGGL (Hrsg.): Historische Gärten in Deutschland – Denkmalgerechte Pflege. Neustadt 2000.
10. März 2006 Claudia Moll
verknüpfte Bauwerke
Ermitage Arlesheim