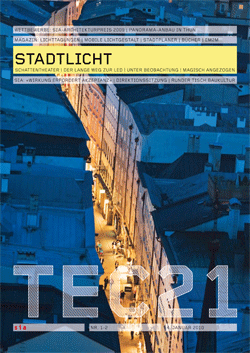Editorial
Seit der Antike werden Strassen beleuchtet und damit das Sicherheitsgefühl der Menschen bei Nacht erhöht. Dafür wurden Kienspäne oder Fettlampen, später Öllampen eingesetzt. Ab dem 19. Jahrhundert kam die Gasbeleuchtung auf, die sich für viele Jahre durchsetzen sollte und heute noch in einigen Städten zu finden ist. Ende des 19. Jahrhunderts war schliesslich auch elektrisches Licht verfügbar und hielt in den Strassen Europas Einzug. Die elektrische Beleuchtung wurde fortan aber nicht nur zur Erhellung von Strassenzügen, sondern auch für die Akzentuierung von Gebäudefassaden verwendet. Das Resultat: Mit den Jahren wurde die Nacht immer heller, und die Städterinnen und Städter suchten den Sternenhimmel zunehmend vergebens.
Geht es um die Frage, wo und wie Energie gespart werden kann, wird deutlich, dass die Strassenbeleuchtung ein grosses Potenzial bietet. Viele technisch veralteten und nicht mehr wirtschaftlichen Strassenbeleuchtungen, die aufgrund ihres Alters keine ausreichende Leuchtstärke mehr haben, müssen in den nächsten Jahren saniert werden. Neben den gängigen Leuchtmitteln rückt dabei auch immer mehr die Licht emittierende Diode (LED) in den Vordergrund, da sie farbechtes Licht bei geringem Energieverbrauch verspricht. Die ersten Leuchtentypen, die LED einsetzen, sind mittlerweise erhältlich und teilweise im Einsatz. Die TU Darmstadt baute eine Teststrasse mit verschiedenen Leuchten und befragte Testpersonen zur Wahrnehmung und Akzeptanz des neues Lichts (vgl. «Der lange Weg zur LED» und «Unter Beobachtung»).
Doch auch bei der Beleuchtung von Fassaden können Licht und Energie gespart werden. Heutige Fassadenbeleuchtungen strahlen meist an den Fassaden vorbei in die Umgebung und den Nachthimmel. Diese Energievergeudung soll das Projekt «Lichtprojektionsverfahren» beenden. In die Leuchtkörper, die die Fassaden erhellen, werden Schablonen eingelegt. Diese zeichnen die Kontur des Gebäudes genau nach und lassen Licht nur auf die Flächen durch, die beleuchtet werden sollen. Diese bedarfsgenaue Beleuchtung verringert nicht nur den Energieverbrauch, sondern verhindert auch die Abstrahlung in die Umgebung (vgl. «Schattentheater»). Das ist wichtig, denn künstliches Licht beeinflusst den Schlaf-Wach-Rhythmus von Mensch und Tier, es verändert den Wachstumszyklus von Pflanzen oder stört die Orientierung nachtaktiver Insekten und Zugvögel (vgl. «Magisch angezogen»). Die Reduktion des städtischen Lichts, der sinnvolle Einsatz von Leuchtmitteln und eine sparsame Akzentuierung mit Licht könnten dazu beitragen, dass die Nächte wieder dunkler sein dürfen als heute – zum Wohl von Mensch, Tier und Pflanze.
Katinka Corts