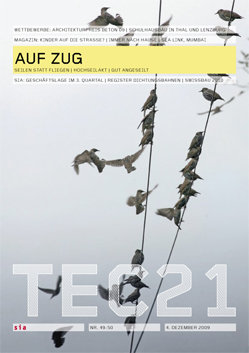Editorial
Aus Freude am Nervenkitzel begeben sich die Besucher des Seilparks in Grindelwald zur Unterhaltung aufs gespannte Hochseil («Gut angeseilt», S. 33). Wind und Wetter sind sie dabei nicht ausgesetzt, denn die Konstruktion des ersten Indoor-Seilparks in der Schweiz ist sicher und gut geschützt im Innern der Eishalle am Stahlfachwerk der Dachkonstruktion aufgehängt.
Nerven wie Drahtseile brauchten hingegen die Brückenbauer, die den Hängelaufsteg über die Triftschlucht im Berner Oberland montierten («Hochseilakt», S. 27). Das Arbeitsumfeld ist rau: Ein paar in schwindelerregender Höhe gespannte Seile müssen zu einer sicheren Brückenkonstruktion verbunden werden. Der Abwind des Helikopters, für die Montage der Brücke herbeigezogen, erschwert die Handgriffe zusätzlich.
Arbeiten ist hier nur am gesicherten Seil zu verantworten. Es ist natürlich nicht der Adrenalinschub, der die Arbeiter dazu treibt, nach nur vier Jahren Betriebszeit einen Ersatzsteg zu montieren, den alten Hängelaufsteg abzubauen und an einem neuen Standort im Kanton Uri – erneut zwischen steilen Felsen – einzubauen. Die Bauarbeiten dokumentiert hat der bekannte Schweizer Fotograf und Bergführer Robert Bösch. Er hat sowohl die spannenden Momente während der Montage festgehalten als auch schöne, friedlich anmutende und eindrückliche Bilder eingefangen.
Wenn die Montage – wie bei der Triftbrücke – nur mithilfe des Helikopters erfolgen kann, müssen der gesamte Bauablauf und die Arbeitsvorgänge auf die Flüge abgestimmt werden. Auch den Planern des Neubaus der SAC-Hütte Spitzmeilen bot sich der Einsatz eines Helikopters an. Sie suchten jedoch ein weniger witterungsabhängiges Transportmittel, um das Material auf dem Luftweg zur Baustelle zu bringen. Die ablaufspezifisch und wirtschaftlich attraktivste Lösung fanden sie in einer Materialseilbahn («Seilen statt fliegen», S. 22).
Diese drei Beispiel zeigen – so unterschiedlich sie sind –, dass Seile, obwohl sie nur Zugkräfte aufnehmen können, enorm leistungs-fähig sind und dabei sehr effiziente und ästhetische Konstruktionen ermöglichen.
Clementine van Rooden
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Architekturpreis Beton 09 | Schulhausersatzbau in Thal | Schulhausneubau in Lenzburg
12 MAGAZIN
Kinder auf die Strasse? | Immer nach Hause| Bandra–Worli Sea Link, Mumbai | Klimagespräch an der ETH Zürich | Bücher | Stadt-baum: künftig Föhre statt Linde? | Bauingenieur Jörg Schlaich 75-jährig
22 SEILEN STATT FLIEGEN
Rolf Bachofner
Die Materialversorgung auf Baustellen in alpiner Höhe erfolgt meist mit Helikoptern. Materialseilbahnen können eine effiziente und kostengünstige Alternative sein. Spitzmeilen ist ein Beispiel dafür.
27 HOCHSEILAKT
Hans Pfaffen, Walter Brog, Clementine van Rooden
Der nur vier Jahre alte Hängelaufsteg in der Triftschlucht musste ersetzt werden, weil heftige Winde die Konstruktion regelmässig beschädigten. Die neue Brücke ist den Windböen weniger ausgesetzt.
33 GUT ANGESEILT
Angela Bruderer
Der bisher einzige Indoor-Seilpark in der Schweiz wurde in Grindelwald gebaut. Er hängt in der Dachkonstruktion der Eishalle und ist seit einem Jahr in Betrieb.
38 SIA
Geschäftslage im 3. Quartal 2009 | Register Dichtungsbahnen | Swissbau 2010
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Hochseilakt
Der Hängelaufsteg unterhalb des Triftgletschers im Berner Oberland wurde 2004 gebaut, um nach dem rasanten Schwund des Gletschers den Zustieg zur Trifthütte zu gewährleisten. Doch der Wind am speziellen Standort beschädigte seither die Konstruktion. Deshalb wurde in diesem Sommer eine neue Brücke an einer günstigeren Stelle aufgebaut und die alte demontiert.
Der Weg von der Sustenpassstrasse zur Trifthütte führte ursprünglich über den Triftgletscher: Über steil abfallende Leitern stiegen die Alpinistinnen und Alpinisten hinunter auf die Gletscherzunge, von dort aus überquerten sie den Gletscher bis auf eine Höhe von 1900 m ü. M., via «Telliblatti» führte der Weg dann dem Südhang entlang hinauf zur Trifthütte auf 2520 m ü. M. In den letzten Jahren ist die Gletscherzunge abgeschmolzen, allein im Sommer 2004 um 164 m. Es ist ein grosser See entstanden, und die Triftschlucht hat sich geöffnet, sodass ab etwa 2003 der Abstieg via Leitern nicht mehr möglich war. Die Bergsteiger waren gezwungen, am Nordhang entlang einen mühsamen Aufstieg zu bewältigen, um dann wieder etwa 200 m abzusteigen, damit sie den Triftgletscher oberhalb des Abbruches überqueren konnten. Diese Route war gut ausgerüsteten und erfahrenen Alpinisten vorbehalten, da die Gletscherquerung hier in Spaltenrichtung erfolgte, was vor allem im Frühsommer und Spätherbst eine genaue Routenwahl und Lagebeurteilung erforderte.
Der Hängelaufsteg, der im September 2004 nach nur fünfmonatiger Planungs- und Ausführungszeit eröffnet wurde, machte den Weg wieder einfacher: Auf ihm konnte man die Triftschlucht etwa 30 m unter ihrem oberem Ende 70 m über dem Wasser überqueren.
Konstruktion der ersten Brücke
Die Brücke wurde als einfaches, unversteiftes Tragwerk mit einem Eigengewicht von 100 kg/m2 und einer maximalen Belastung von 750 kg/m2 konzipiert. Schwingungen wurden toleriert – wobei sie gering ausfielen, weil die Tragseile wenig durchhingen. Das nach nepalesischer Bauweise[1] erstellte Tragwerk bestand aus sechs Stahlseilen mit 32 mm Durchmesser und einer daran angehängten einfachen Stahlunterkonstruktion. Die zwei oben liegenden Tragseile wurden im Abstand von 120 cm montiert, sodass sich eine Person beim Überschreiten der Brücke rechts und links am Seil halten konnte. Sie waren zu den beiden in etwa 1.5 × 1.5 m grossen Fundamenten eingegossenen, 1.60 m hohen Pylonen geführt und dahinter mit Schwerlastanker im Fels verankert. Ebenso waren die vier unten liegenden Spannseile verankert, die jeweils als Paar pro Seite 117 t Zugkraft aufnahmen. Die Tragseile bildeten zusammen mit darunter angebrachten weiteren Drahtseilen das Geländer. Es wurde kein Drahtgeflecht montiert, da durch Schneeverwehungen die Windlast auf die Konstruktion erhöht worden wäre. Die Lauffläche war mit einheimischen, druckimprägnierten Lärchenholzplanken belegt. Jede einzelne Planke war luftumflossen und auf den im Abstand von 1.50 m montierten Querbalken der Unterkonstruktion verschraubt (Abb. 1).
Ursprünglicher Standort
Die Lage der ersten Brücke wurde gewählt, weil sie sich dank der nahezu perfekten Felsstruktur (kompakter Granit) für Verankerungen eignete und ausserdem die engste Stelle war, wo noch ein verantwortbarer Ein- und Ausstieg möglich war. Eine Zerstörung durch Lawinenniedergang konnte ausgeschlossen werden, da die Brücke im Schutz einer Felsrippe im Gebiet «Drosi» auf der Ostseite lag. In den vier Betriebsjahren hat sich diese Annahme bestätigt. Auch entlang des neuen Weges waren keine aussergewöhnlichen Gefährdungenbekannt – kleine Rutschungen konnten mit Unterhaltsarbeiten kontrolliert oder umgangen werden. Zwar wäre ein Standort weiter oben in der Schlucht bereits damals sinnvoller gewesen, war aber angesichts der zu Baubeginn noch unsicheren Finanzierung zu teuer.
Unterschätzter Wind
Nach den ersten vier Betriebsjahren zeigte sich, dass die lokalen Windverhältnisse unterschätzt worden waren und die Konstruktion beschädigten. Für die erste Brücke berücksichtigte der Bauingenieur Föhnstürme um 120 km/h, wie sie von der Messanlage auf dem «Bänzlauistock» gemessen werden. Wegen des Venturieffekts sind die Windgeschwindigkeiten in der Schlucht aber wesentlich höher, am Standort der ersten Brücke gibt es Böen von bis zu 200 km/h. Die starken Turbulenzen bewirkten zudem Kräfte auf das Tragwerk, die in diesem Masse für die Bemessung der Konstruktion nicht berücksichtig worden waren. Zahlreiche Holzplanken wurden darum durch das Kippen der Brücke abgerissen, viele Zugstangen zwischen Tragseil und Gehsteg mussten ersetzt werden. Einige Windabspannungen, die nachträglich montiert worden waren (wegen der topografischen Verhältnisse in sehr spitzem Winkel), hielten der Beanspruchung nicht stand.
Bei der Planung 2004 war man davon ausgegangen, dass vorwiegend Alpinistinnen und Alpinisten die Brücke benutzen würden. Mit der Eröffnung der Triftbahn im Frühling 2005 und dem Bekanntwerden des spektakulären Gletscherrückgangs etwa zur gleichen Zeit kamen aber auch weniger geübte Wanderer auf diese Route. Bis zu 35 000 Personen überquerten pro Jahr den längsten Hängelaufsteg im Alpenraum. Sie unterschätzten häufig den alpinen Zustieg zur Brücke hinunter, wodurch dieser zu einem Sicherheitsrisiko wurde.
Neuer Standort
Um den technischen Problemen zu begegnen und den erhöhten Sicherheitsanforderungen zu genügen, entschieden sich die Verantwortlichen 2007 dafür, die Brücke an einen weniger gefährdeten Standort zu versetzen bzw. eine neue aufzubauen. Die Finanzierungsmöglichkeiten hatten sich dank der Attraktivität der ersten Brücke stark verbessert. Der neue Standort befindet sich 20 m talauswärts und 30 m höher, wo die Schlucht breiter ist und die Windgeschwindigkeiten deshalb tiefer sind (Abb. 4 und 5).
Konstruktion der Neuen Brücke
Die neue Brücke wurde vom gleichen Ingenieur konzipiert wie die alte und hat eine ähnliche Tragkonstruktion. Der neue Hängelaufsteg ist jedoch 170 m statt 100 m lang und hat Abspannungen, die als parabolische Zugspannseile unter der Brücke angeordnet sind.
Diese Zugspannseile mit 32 mm Durchmesser sind mit senkrecht zum Laufsteg montierten Drahtseilen (16 mm) verspannt (Abb. 6) und geben der Brücke ihre Stabilität gegen Windeinwirkungen. Die gesamte Traglast verteilt sich auf die sechs Tragseile. Masse, Anordnung und Auslegung entsprechen der Konstruktion der ersten Brücke. Für die Stabilisierung des Geländers, mit zusätzlichen horizontalen und vertikalen Seilen zwischen den Tragseilen ausgespannt, und auch um die Tragseile auszusteifen, sind in den Drittelspunkten des Stegs Stabilisationsrahmen aus Stahl und in U-Form platziert. Sie erhöhen das Sicherheitsgefühl der Benutzer ebenso wie die Kanthölzer am Rand der Lauffläche, die wie die alte Brücke mit einheimischen, druckimprägnierten Lärchenholzplanken belegt ist (Abb. 6 und 7). Der Bau der neuen Brücke dauerte zwei Monate. Eingeweiht wurde sie am 12. Juni 2009 – rechtzeitig zur Saison- und Bahneröffnung. Vor allem der Einbau der Spannseile mit dem Helikopter war ein spektakulärer Vorgang, der von Windturbulenzen geprägt war (Abb. 2). Die alte Brücke wurde für den Montagevorgang genutzt und deshalb erst nach dem Einbau der neuen demontiert. Sie hat unterdessen eine neue Aufgabe erhalten: Seit August verbindet sie am Salbitschijen im Urner Göscheneralptal die SAC-Hütten Salbit und Voralp direkt miteinander.[2]
Anmerkungen:
[01] Hans Pfaffen: Hängebrücken in Nepal, in: Schweizerische Technische Zeitschrift STZ, Ausgabe Nr. 21/22, 1. Juni 1978
[02] www.salbitbruecke.chTEC21, Fr., 2009.12.04
04. Dezember 2009 Clementine Hegner-van Rooden, Hans Pfaffen, Walter Brog