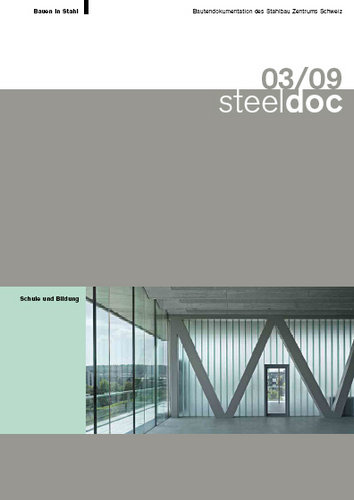Editorial
Das Schulhaus prägt Kinder, den Volksgeist und den öffentlichen Raum. Wer erinnert sich nicht an die grossen Hallen «seiner Schule» und den Blick aus dem Fenster des ersten Schulzimmers? Die Identitätsstiftung wirkt aber nicht nur auf Erstklässler – das Schulhaus ist nebst der Kirche und dem Rathaus wohl das wichtigste Gebäude einer Gemeinde. Und so wird der Schulhausbau immer auch zum Politikum. Nicht zu pompös, aber doch ehrwürdig soll er sein. Er darf nicht zu viel kosten, aber doch von bester Qualität zeugen. Er soll Ausdruck des erzieherischen Auftrages sein und doch die Kreativität und Entwicklung der Schüler unterstützen. All diese Ansprüche müssen Architekten, Planer und Unternehmen erfüllen, wenn ein Schulhaus gebaut wird. Nicht selten entzünden sich darüber die Gemüter, denn es ist nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen wenn Pädagogen, Politiker, Eltern und Baubehörden mitreden. Aber es ist eine schöne und sinnvolle Aufgabe – mit nachhaltiger Wirkung. Und am Ende sieht alles so einfach aus.
Im vorliegenden Heft von steeldoc konnten wir für einmal ausschliesslich auf Schweizer Projekte zurückgreifen. Denn der Schulhausbau ist in der Schweiz, dank dem neuen Babyboom, derzeit en Vogue. Den Auftakt macht das wohl umstrittenste, aber auch das interessanteste aktuelle Schulhausprojekt der Schweiz: das Schulhaus Leutschenbach. Hier steht alles Kopf: die Turnhalle thront wie eine grosse Laterne auf einem kompakten, geschichteten Volumen. Fast meint man, das Haus schwebe über dem Boden, denn Stützen sind von aussen keine zu sehen. Die strukturelle Dominanz zeichnen grosse Fachwerkverbände, die damit zum eigentlichen Fassadenornament werden. Das Schulhaus Leutschenbach ist ein Manifest der Kühnheit und wurde natürlich mit dem Prix Acier 2009 ausgezeichnet. Ergreifend ist indes, dass in diesem Schulhaus, das man getrost als architektonisches Kunstwerk bezeichnen kann, Schüler der Vorstadt ihren ersten Schultag erleben – und sich ganz bestimmt immer an den Blick aus ihrem Klassenzimmer erinnern werden.
Dass ein schönes Schulhaus auch einfach, günstig und fein detailliert sein kann zeigt das Collège von Cugy, das für Schüler von vier kleinen Gemeinden bei Lausanne errichtet wurde. Der «sanfte Riese», wie wir ihn nennen, ist ein Manifest der Angemessenheit – im Sinne der Ausgewogenheit aller Ansprüche, die an diesen Bau gestellt wurden. Ein weiteres ausserordentliches Schulhaus steht in Neuchâtel. Es zelebriert die kubische Lochfassade und keiner würde vermuten, dass dahinter ein Stahlbau steckt. Doch eigentlich spielt diese Struktur genau die modularen Vorteile des Stahlbaus aus, insbesondere die Erdbebensicherheit. Auch Manager erinnern sich an den Blick aus ihrem Schulzimmer und in die Lobby: elegante Weiträumigkeit spricht aus dem Neubau des Managementinstituts IMD am Genfer See – grosse Spannweiten, weitgehend stützenfreie Räume und ein offener Raum- und Lichtfluss.
Wie das alles funktioniert zeigt Steeldoc wie immer im Detail. Wir wünschen viel Vergnügen beim Studium sowie der Lektüre der nachfolgenden Seiten.
Evelyn C. Frisch
Inhalt
03 Editorial
04 Schulanlage Leutschenbach, Zürich
Manifest der Kühnheit
12 IMD – Mærsk Mc-Kinney Møller Center, Lausanne
Elegante Weiträumigkeit
20 Collège de la Combe, Cugy
Der sanfte Riese
26 Ecole de la Maladière, Neuenburg
Lichter Baukasten
31 Impressum
Manifest der Kühnheit
(SUBTITLE) Schulanlage Leutschenbach, Zürich
Das Schulhaus Leutschenbach gehört zu den ambitioniertesten neuen Stahlbauten der Schweiz. Als eine der grössten Schulanlagen Zürichs ist das Gebäude sowohl typologisch, als auch aufgrund seiner besonderen Tragstruktur ein gelungenes Experiment.
Im ehemaligen Industriequartier erhebt sich der Bau in mitten einer Grünanlage. Im Hintergrund die Kehricht anlage der Stadt Zürich und rundum noch weitgehend unbebaute Flächen, inszeniert sich das Schulhaus durch seine betont selbstbewusste Haltung. Von weitem fällt das Gebäude durch die überwiegend transparente Erscheinung und die prägnante Stahlkonstruktion auf, die sich aussen sichtbar ablesen lässt. Es setzt dadurch in der heterogenen Umgebung einen herausragenden Kontrapunkt. Gleichzeitig bildet es den perfekten Auftakt für das aufstrebende Entwicklungsgebiet. Kommt man näher, beeindruckt der Stahlbau durch aussergewöhnliche Proportion und Präsenz.
Das Schulhaus wirkt wie ein architektonisches Manifest. Um den kleinstmöglichen Fussabdruck zu hinterlassen, sind Unterrichtsräume, Turnhalle und Aula, die üblicherweise nebeneinander angeordnet sind, übereinander gestapelt. Zuoberst thront auf dem 33 Meter hohen Haus repräsentativ die Turnhalle. Zu diesem nachhaltigen Kunstgriff, durch den die umliegende Grünfläche weitgehend unberührt bleiben konnte, führte der Wunsch nach einem grossen öffentlichen Schulpark mit ausgedehnten Spiel- und Pausenplätzen. Die vermeintliche Auf hebung der Grenzen durch das rundum verglaste Erdgeschoss unterstützt zusätzlich den fliessenden Übergang zwischen Innen- und Aussenraum.
Der minimierte Fussabdruck wurde im Gebäude intelligent für die Organisation genutzt. Der Entwurf sieht keine endlos langen Flure und schmalen Verkehrswege im klassischen Sinne vor, dagegen breit angelegte, die Kommunikation fördernde Treppenanlagen. Diese münden jeweils in grosszügige Gemeinschaftszonen vor den Klassenräumen. Akustisch sind diese Zonen so konzipiert, dass man dort genauso unterrichten wie auch Gruppenarbeiten durchführen kann.
Inszeniertes Gebäudekonzept
Der Kubus mit einer Grundfläche von rund 30 auf 50 Metern umfasst neben dem Kindergarten und 22 Klassenzimmern auch Spezialräume wie Labors, Werk- oder Computerräume und die Dreifachturnhalle. Vom niedrigen Eingangsgeschoss mit Cafeteria und Schülerklub entwickelt sich ein virtuos inszenierter Spannungsbogen über die Klassenzimmerebenen bis hinauf in die vierte Etage mit Aula, Bibliothek und Lehrerzimmer. Betritt man das oberste Geschoss über die bewusst schmal gehaltene, zweiläufige Treppe, überwältigt der sieben Meter hohe, stützenfreie Raum der Turnhalle mit seinem atemberaubenden Panoramaausblick umso mehr. Innovativ am Schulhaus ist nebst dem Tragwerk und der Materialwahl vor allem die räumliche Konzeption. Auf drei Etagen ordnen sich die Klassenzimmer rund um das zentrale Treppenhaus an. Anstelle von geschlossenen Trennwänden unterteilen transluzente Profilbauglasscheiben die Räume. Sie lassen das Tageslicht hindurch strömen bis tief ins Innere des Gebäudes. Das Tragwerk bilden hohe, umlaufende Fachwerkträger, die sich mit dem architektonisch-räumlichen Konzept zu einer Einheit verbinden.
Signifikante Struktur
Die komplexe Struktur des Tragwerks konnte nur als Stahlkonstruktion ausgeführt werden, da hierdurch Gewicht und aufgrund der Vorfertigung Zeit eingespart wurde. Das Tragwerk besteht aus einem System von aufeinander gestellten und abgehängten Fachwerken. Zwei drei Geschosse überspannende Fachwerkverbände sind im Erdgeschoss auf nur sechs dreibeinige, raumhohe Stützen aufgelagert. Sie tragen zwei Fachwerkverbände in Gegenrichtung. Auf ihnen ruht die Turnhalle. Der gesamte Unterrichtstrakt hängt an den auskragenden Fachwerken des vierten Obergeschosses und bildet dadurch im Erdgeschoss ein mehr als zehn Meter auskragendes Dach. So wirken Erdgeschoss und das vierte Obergeschoss von aussen stützenfrei.
Das Fachwerk aus Stahl ändert sich von einem Funktionsbereich des Schulgebäudes zum nächsten. Es verbindet die verschiedenen Bereiche statisch und architektonisch zu einer lebendigen, vielschichtig gestalteten Einheit. Für das Gemeinschaftsgeschoss entsteht somit grösste Durchlässigkeit. Die Schultreppen enden in einer grosszügigen Halle, zu der sich Bibliothek und Aula seitlich öffnen. Das Lehrerzimmer erhält eine unmittelbare Verbindung zur Bibliothek. Im Schulhaus gibt es keine massiven Wände, nur die Geschossdecken sind zur Aussteifung in Beton ausgeführt. Es bedeutete eine zusätzliche statische und haustechnische Herausforderung, dass sie sämtliche Installationen aufnehmen.
Sichtbezug ohne Einschränkung
Im Innenraum schaffen Industrieglaswände semitransparente, ineinander fliessende Übergänge und separieren die Zimmer akustisch. Eine nahezu aufgelöste Glashaut trennt die Räume vom Aussenraum ab. Sowohl die Innenwände aus Profilit-Glas, als auch die Isoliergläser der Aussenfassade werden rahmenlos in Decken- bzw. Bodenschlitzen versenkt.
Transparente Glasschwerter zur Aufnahme der Windlasten fördern den uneingeschränkten Ausblick in die Natur. In der Turnhalle sind die Schwerter auf Grund erhöhter Verletzungsgefahr beim Turnen nur in den oberen zwei Dritteln der Fassade angeordnet. Ein umlaufender Stahlträger fängt die ankommenden Windlasten aus den Schwertern auf.
Hoch belasteter Stahlbau
Die Tragstruktur des Gebäudes ist eine Stapelung von Fachwerkverbänden. Ein erster Fachwerkverband umfasst die ersten drei Geschosse mit den Klassenzimmern, ein zweiter die Turnhalle. Die beiden querliegenden Fachwerkscheiben im vierten Geschoss übernehmen eine zentrale Funktion. Die gesamte Turn hallenkonstruktion liegt auf diesen zwei Fachwerken auf, an ihnen sind gleichzeitig die umlaufen den Fachwerke der unteren Geschosse aufgehängt. Die hoch belasteten Fachwerkstäbe der gesamten Tragstruktur sind Hohlprofile aus geschweisstem Blechen unterschiedlicher Stärke, abhängig von Position und Statik. Im obersten Geschoss wurden für die Querbinder warmgewalzte, nahtlose Hohlprofile verwendet.
Im Werk in transportabler Grösse vorgefertigt, mussten die riesigen Fachwerkträger auf der Baustelle nur noch verbunden werden. Bei den Fachwerkkörpern der unteren drei Geschosse sowie der Turnhalle wurde die Fassade innerhalb des Tragwerks gelegt. Insbesondere beim unteren Fachwerkkörper mussten Wärmebrücken zwischen den innen- und aussenliegenden Fachwerkteilen vermieden werden. Ein Vorteil des aussenliegenden Fachwerks waren hingegen verminderte Brandschutzanforderungen. Eine Sprinkleranlage und ein dämmschichtbildendes Anstrichsystem für das Fachwerk stellen den Brandschutz des Gebäudes sicher. Die lichtgraue Farbe für die Stahlbauteile ist bewusst an den Ton der Betondecken angeglichen. Die Konstruktion wirkt dadurch umso einheitlicher.
Lastabtragung über Bohrpfähle
Der ganze Fachwerkkörper leitet die Kräfte über die sechs dreibeinigen Stahlstützen im Erdgeschoss in das Fundament ein. Der schlechte Baugrund erforderte eine Pfahlfundation, um die Lasten der Stahlkonstruktion abzufangen. Die Fundation des im Erdgeschoss auf den sechs Punkten gestützten Bauwerkes erfolgt über rund 30 Meter lange Bohrpfähle.
Aus gestalterischen Überlegungen und auch wegen ihres geringeren Gewichts sind die Geschossdecken in Leichtbeton mit variabler Höhe konzipiert. Sowohl für die Pfahlbankette, als auch für die Bodenplatte, die Untergeschosswände und Deckenplatten wurde Recyclingbeton verwendet.
Auszeichnung Prix Acier 2009
Die Stärke dieses Beitrages liegt im innovativen Ansatz der Stapelung von unterschiedlichen Nutzungseinheiten und damit verbunden im anspruchsvollen Umgang mit der Gebäudestatik. Die gesamte Tragstruktur bleibt überall sicht- und erlebbar, der Verlauf der Kräfte wird deutlich offen gelegt. Form und Tragwerk bilden eine Einheit, wobei der Aufwand in Konstruktion und Ausführung eher im Sinne eines Experimentes zu sehen ist. Die Jury des Schweizer Stahlbaupreises hat diesen Bau aufgrund seines ungewohnten, expressiven und kohärenten Konzeptes und der herausragenden Qualität der Ausführung mit dem Prix Acier 2009 ausgezeichnet.Steeldoc, Fr., 2009.12.04
04. Dezember 2009 Cordula Rau
Lichter Baukasten
(SUBTITLE) Ecole de la Maladière, Neuenburg
Zwischen den Bäumen eines Parks im Quartier de la Maladière von Neuenburg wirkt der Baukörper der neuen Schule fast wie eine Skulptur von Bernard Tschumi. Die tragende Gebäudehülle aus Stahl ist gleichzeitig eine erdbebensichere Struktur und ermöglicht grösste Gestaltungsfreiheit sowohl für die Fassade als auch im Innern.
Das Quartier de la Maladière ist ein aufstrebendes Wohn- und Geschäftsviertel der Stadt Neuenburg. Die Lage des Schulhauses im Park eines ehemaligen Friedhofes ist exquisit. Das Volumen geht deshalb durch eine differenzierte kubische Komposition auf die Vorzüge der Umgebung ein. Einmal bietet es durch einen Rücksprung des Sockelgeschosses einen grosszügigen, gedeckten Vorplatz für den Eingangsbereich, während im Obergeschoss eine Terrasse mit Weitblick entsteht.
Das strenge Fassadenraster mit grosszügigen, quadratischen Öffnungen entspricht der tragenden Gebäudestruktur und bietet gleichzeitig den Rahmen für eine verspielte, farbige Flächengestaltung. Durch Stapelung der Räume über vier Geschosse bleibt viel von der Grundstücksfläche unverbaut. Dass diese Tragstruktur gleichzeitig auch beispielhaft punkto Erdbebensicherheit ist, zeichnete sich erst während des Planungsprozesses ab.
Erfrischend anders
Das klassische Raumprogramm für ein Schulgebäude wurde hier so spielerisch und abwechslungsreich wie möglich umgesetzt. Jedes Schulzimmer hat eine besondere Ausrichtung und Lichtatmosphäre. Untergeschoss und Erdgeschoss nehmen die Turn halle, den Kindergarten, den Mehrzwecksaal sowie die Wohnung des Abwarts auf. In den beiden Obergeschossen befinden sich die eigentlichen Räume der Primarschule. Die 12 Klassenzimmer sind, entsprechend der Ausformung des Baukörpers, in Längs- oder Querrichtung angeordnet – anders als dies typischerweise in Schulgebäuden anzutreffen ist. Je nach Lage werden sie von bis zu drei Fassaden umschlossen, durch deren quadratische Fenster viel Tageslicht in die Schulräume gelangt.
Das Fassadenbild wird durch das markante Raster der aussen bündigen Fenster gleicher Grösse sowie der sichtbaren Trennfugen zwischen den Fassadenpaneelen aus glasfaserverstärktem Kunststoff geprägt. Die Farbgestaltung der Paneele mit hellen Gelb- und Grüntönen variiert das Thema Rahmen.
Komplexes Raumgefüge
Im Prinzip ist die Tragstruktur ein Stahlskelett auf einer Betonwanne. Um die komplexe kubische Form des Volumens auszusteifen, wurden in jeder Fassadenebene Vierendeel-Rahmen aus massivem Stahlblech eingesetzt, welche über drei Geschosse reichen und zwei oder mehr Fensterachsen einfassen. Diese Rahmen mit steif verbundenen Ecken wirken wie Scheiben – damit sind diagonale Verbände sowohl in der Vertikalen wie auch in der Horizontalen überflüssig. Gleichzeitig nehmen diese Scheiben die Lasten der Auskragung auf. Dadurch kann auch das Innere vollkommen frei von aussteifenden Elementen gestaltet werden.
Die insgesamt fünf Fassadenscheiben bestehen aus biegesteif verbundenen Stahlblechteilen, die gelenkig auf die Betonwände des Untergeschosses gesetzt sind. Um eine hohe Qualität der Schweissnähte zu gewährleisten, wurden Teilstücke bereits in der Werkstatt vorgefertigt und auf der Baustelle zu ganzen Fassadenteilen zusammengeschraubt. Hilfskonstruktionen stützen die Rahmen bis zur endgültigen Aufrichtung. Danach erfolgt die Montage des übrigen Stahltragwerks aus Lochstegträgern und Profilstützen. Die in das Stahltragwerk eingebauten Verbunddecken bestehen aus Trapezblech mit Ortbeton.
Mit Stahl gegen Erdbeben
Die Erdbebensicherheit ist neben der freien Grundrisseinteilung ein weiterer Vorteil des gewählten Tragsystems. Ausschlaggebend dafür sind seine Leichtigkeit und die Fähigkeit, Schwingungen abzudämpfen. Dies kann durch die optimale Abstimmung der Steifigkeiten der tragenden Bauelemente erreicht werden. Die Stahlbauweise bietet aufgrund der günstigen physikalischen Eigenschaften, wie z.B. hohe plastische Verformbarkeit, generell entscheidende Vorteile gegenüber anderen Konstruktionen. Im vorliegenden Fall leiten die dreistöckigen Vierendeel-Rahmen die Schwingungen in beiden Richtungen über die Fassade ab. Die Verbindungen der Stahlrahmen selbst wurden steif ausgebildet, die Anschlüsse an die übrige Konstruktion halbsteif und die Auflagerpunkte der Stahlrahmen auf der Betonwand des Untergeschosses gelenkig. So ist die Tragstruktur zwar ausgesteift, aber insgesamt duktil.
Die Gebäudehülle ist hoch wärmegedämmt und erfüllt damit auch den Minergiestandard. Die weitgehend trockene Bauweise unter Verwendung von Profilen aus Recyclingstahl, die hohe Flexibilität in der Anordnung der Räume und die Möglichkeit, die Konstruktion am Ende des Lebenszyklus einfach zurückzubauen, sprechen für die Nachhaltigkeit dieses Gebäudes.Steeldoc, Fr., 2009.12.04
04. Dezember 2009 Evelyn C. Frisch, Johannes Herold