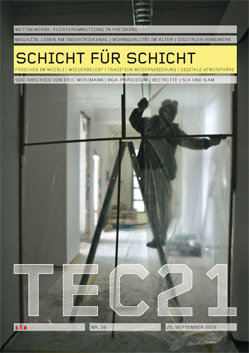Editorial
Dass Umbauten mitttlerweile über ein Drittel aller Bauaufgaben in der Schweiz ausmachen, ist bekannt. Oftmals handelt es sich dabei um Transformationen von Gebäuden, bei denen neue Nutzungen in bestehende Hüllen integriert werden. Die Spuren des ehemaligen Gebrauchs bleiben erhalten und überlagern sich mit den Ablagerungen der neuen Nutzung.
In diesem Heft werden andere Umbauten gezeigt, Gebäude, bei denen nicht die Umnutzung im Vordergrund stand, sondern weiterhin der gleiche Gebrauch, aber mit neuen Ansprüchen an den Raum. Bei der Erneuerung der Siedlung Stadtrain in Winterthur («Frisches im Müesli», S.28ff.) wurden die bestehenden Kreuzreihenhäuser durch einen horizontalen Anbau um mehr als bloss einen zusätzlichen Raum erweitert.
Heute wohnen hier keine Arbeiter mehr, die kompakte Typologie und die Qualitäten der Zwischenräume werden gleichwohl geschätzt. Mindestens zwei dieser Häuser würden in eine der drei Wohnungen passen, die diesen Sommer im ehemaligen «Grandhotel» am Zürcher Bellevue entstanden sind. Sieben Jahre lang wurde der denkmalgeschützte 150-jährige Solitär umgebaut, Haustechnik und Tragwerk wurden saniert und das Dachgeschoss mit Wohnungen für das gehobene Segment ausgebaut («Neu geordnet, wiederbelebt», S.33ff.).
Ein Bellevue der anderen Art, mit Sicht auf das Wildstrubelmassiv, steht im Zentrum des dritten Artikels. Das «Parkhotel Bellevue» in Adelboden wurde über Jahrzehnte immer wieder erweitert und den jeweils aktuellen Nutzungsansprüchen angepasst. Mit der Wahl eines «Hausarchitekten» haben sich die Eigentümer vor einigen Jahren für eine gesamtheitliche Gestaltungsstrategie ausgesprochen. Seither sind drei Bauetappen realisiert worden – jeweils in der Betriebspause von zwei Monaten. Der aktuelle Umbau betraf den teilerneuerten und erweiterten Wellnessbereich («Modernisierung als Tradition», S. 37ff.).
Aus Schichten schliesslich, oder Layern, setzt sich das Schmuckstück des Umbaus, der «parametrisierte Wandteppich», im Büro der Webunternehmung Liip zusammen. Mit wenigen effektiven Eingriffen schufen die Architekten aus einer beliebigen Bürotypologie ein reales «corporate environment» für die Arbeiter der digitalen Welt («Atmosphäre des Digitalen», S. 42ff.).
Die vier Beispiele zeigen ein Spektrum verschiedener Eingriffstiefen und eine Vielzahl von entwerferischen Schwerpunkten. Ob städtebauliche Überlegungen grosses Gewicht hatten wie bei den ersten beiden Beispielen oder gestalterisch-atmosphärische wie bei den letzteren, alle Umbauten erforderten von den Beteiligten eine vertiefte Auseinandersetzung mit den bestehenden Gebäuden – Schicht für Schicht.
Tina Cieslik
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Klosterumnutzung in Freiburg
14 MAGAZIN
Neues Leben am Industriekanal | Bücher | Zeitschrift «archi» in neuen Händen | Wohnqualität im Alter | «Age Report 2009» | Handwerk goes digital
28 FRISCHES IM MÜESLI
Tina Cieslik
Die horizontale Erweiterung der Kreuzreihenhäuser einer ehemaligen Arbeitersiedlung in Winterthur vergrössert die Wohnfläche, ohne die Siedlungsstruktur zu zerstören.
33 NEU GEORDNET, WIEDERBELEBT
Hansjörg Gadient
In siebenjähriger Planungs- und Bauzeit ist in Zürich das ehemalige «Grandhotel Bellevue» saniert und umgebaut worden – bei laufendem Betrieb.
37 MODERNISIERUNG ALS TRADITION
Nadine Schütz
Bereits drei Umbauetappen hat das «Parkhotel Bellevue» in Adelboden mit Buchner Bründler Architekten aus Basel realisiert. Diesen Sommer wurde der neue Wellnessbereich eröffnet.
42 ATMOSPHÄRE DES DIGITALEN
Albert Kirchengast
Virtuelle Welt trifft auf reales Umfeld: In Zürich wurde das Büro einer Webunternehmung umgebaut. Entstanden ist ein Corporate Environment.
48 SIA
Abschied von Eric Mosimann | BGA-Präsidium neu zu besetzen | Beitritte zum SIA im 2. Quartal 2009 | Partnerschaft von SIA und SAM
55 PRODUKTE
69 IMPRESSUM
70 VERANSTALTUNGEN
Frisches im Müsli
Zwischen 1928 und 1943 entstand im Osten von Winterthur das sogenannte Bichermüesli-Quartier, konzipiert und realisiert von Adolf Kellermüller. Aufgrund der Rohstoff knappheit während der Kriegsjahre kam zum Teil mangelhaft es Baumaterial zum Einsatz – schliesslich war die Bausubstanz so schlecht, dass von 2006 bis 2009 eine Komplettsanierung durchgeführt wurde. Durch eine horizontale Erweiterung der Reihenhäuser gelang den Zürcher Architekten Knapkiewicz & Fickert eine Aufwertung, die die Wohnqualität steigert und den Charakter der Siedlung betont.
Anfang des 19. Jahrhunderts begann Winterthurs Entwicklung zur Industriestadt; 100 Jahre später stellte die Maschinenindustrie 60 % der Arbeitsplätze. Der hohe Bedarf an Arbeitern führte zu einem Mangel an Wohnraum, dem man mit dem Bau von Reihenhäusern nach dem Vorbild der englischen Gartenstädte begegnete. Auch der Bau der Siedlung Stadtrain im Osten von Winterthur geht auf eine solche Initiative zurück. Im Volksmund wird der Stadtteil wegen der Strassennamen «Quitten-», «Kirschen-», «Pfirsich-», «Aprikosen-», «Birnen-» und «Apfelweg» auch «Birchermüesli»-Quartier genannt. Die Bauherrin, die 1923 gegründete Heimstättengenossenschaft HGW, hatte das Ziel, insgesamt 277 Wohnungen zu erstellen, beginnend beim Spitzweg in Westen und endend an der Talackerstrasse im Osten. Mit dem Bau wurde Adolf Kellermüller beauftragt, der in Zusammenarbeit mit Hans Bernoulli bereits die Siedlungen Weberstrasse (1923–25), Bachtelstrasse (1924) und Eichliacker (1924–25) für die HGW realisiert hatte. Bei Planung und Bau der Siedlung Stadtrain arbeitete Kellermüller mit seinem Büropartner Hans Hoffman zusammen.
Kellermüllers Ansatz bestand darin, mit standardisierten Elementen auf der Basis handwerklicher Bauweisen das Kleinhaus als kostengünstige Alternative zur Mietwohnung zu realisieren. Er wählte dafür Kreuzreihenhäuser, eine Typologie, die er bei seiner Tätigkeit beim Wiederaufbau in Litauen und Ostpreussen kennengelernt hatte[1] und die sich durch extreme Kompaktheit auszeichnete. Es entstanden sieben Wohnblöcke à 18 Einheiten in Ost-West-Orientierung mit jeweils einem vorgelagerten Garten sowie mehrere Mehrfamilienhäuser am Blockrand. Durch die Anordnung «Rücken an Rücken» konnte sehr dicht gebaut werden, der Typus brachte aber Belüftungs- und Belichtungsprobleme mit sich, die durch eine Flachdachkonstruktion gelöst wurden: Ein doppeltes Oberlicht liess Licht und Luft ins Obergeschoss. Neben den Bauten, die formal dem «Bauen der neuen Sachlichkeit»[2] verpflichtet waren, zeichnete sich die Siedlung durch ein hierarchisch aufgebautes Erschliessungsnetz aus, das sich bis heute bewährt hat. 1930 waren bereits fünf Reihen fertiggestellt und an Private verkauft, als die Wirtschaftskrise die ursprüngliche Absicht, die Siedlung in einem Zug zu bauen, zunichtemachte. Die Realisierung wurde etappiert, zwei während des Krieges erbaute Häuserreihen sowie ein Mehrfamilienhaus an der Talackerstrasse blieben im Besitz der Genossenschaft. Sie wurden um 1943 fertiggestellt. Durch den Krieg herrschte ein Mangel an Baumaterial, statt in Beton wie bei den früheren Siedlungsteilen wurden die Dächer aus Holz konstruiert. Eine fehlerhaft ausgeführte Erneuerung der Dachabdichtung in den 1980er-Jahren hatte die Konstruktion verfaulen lassen. 2005 war der Zustand so desolat, dass eine vollumfängliche Sanierung nötig wurde.
Wettbewerb, Abriss und Neubau
Ein geladener Wettbewerb unter sechs Schweizer Architekturbüros wurde ausgeschrieben: Neben den Sanierungen im konstruktiven und energetischen Bereich waren eine Anpassung der sanitären Anlagen an heutige Standards und die Schaffung von grosszügigeren räumlichen Verhältnissen erwünscht. Im Juli 2005 konnten die Zürcher Architekten Knapkiewicz & Fickert die Auslobung für sich entscheiden (vgl. TEC21 35/2005). Ausschlaggebend dafür war unter anderem die geplante horizontale Erweiterung zur räumlichen Entspannung der Wohnfläche. Die Mehrheit der Teams hatte eine Aufstockung der Gebäude vorgeschlagen – im Hinblick auf die vorherrschenden Volumina im Quartier wurde dies jedoch abgelehnt. Für die Sanierung wurde eine differenzierte Herangehensweise gewählt und das Projekt in drei Bauphasen aufgeteilt. Die erste Etappe umfasste die Mehrfamilienhäuser an der Talackerstrasse. Die Bauten waren in sehr schlechtem Zustand und ausserdem mit einem Hochparterre versehen, was die angestrebte rollstuhlgängige Nutzung erschwerte. Hier wurden der Abriss und die Erstellung eines Ersatzbaus mit zwölf barrierefreien Dreizimmerwohnungen projektiert. Dadurch liess sich auch eine unterirdische zweigeschossige Einstellhalle mit 63 Plätzen realisieren, die den Bedarf der gesamten Siedlung deckt. Per Lift besteht ein Direktanschluss an die Wohnungen des Neubaus.
Den Architekten war es ein Anliegen, den kleinteiligen Volumina der Kreuzreihenhäuser keinen überdimensionierten Block gegenüberzustellen. Der dreigeschossige Neubau orientiert sich daher an den Proportionen des Abbruchbaus, durch den Wegfall des Hochparterres konnte aber ein zusätzliches Geschoss realisiert werden. Darüber hinaus wurde über die Wahl der Materialien versucht, eine Zusammengehörigkeit mit den Reihenhäusern herzustellen: Die dem Quartier zugewandte Fassade ist mit Eternit verkleidet und korrespondiert mit den ebenfalls eternitverkleideten Anbauten der Reihenhäuser. Süd-, Ost- und Nordfassade sind massiv gemauert, aussen isoliert und grau verputzt. Im Innern herrscht Genossenschaftscharme: Alle nichttragenden Wände sind aus Holz in Leichtbauweise erstellt, die Fugen mit hellgrauen Deckleisten belegt (Abb. 8). Die Kassettierung thematisiert den Kontrast zwischen massiven und Leichtbauelementen – ein Motiv, das durch die Schiebetüren zusätzlich akzentuiert wird. Im Grundriss orientierten sich die Architekten an Kellermüllers kompakten Typologien: Es gibt keine Verkehrsflächen, analog zur zunehmenden Privatsphäre reihen sich Nebenräume, Wohnzimmer und Schlafzimmer in drei Schichten hintereinander (Abb.10).
Horizontale Erweiterung / Vertikale Lichtführung
Die zweite Bauphase von 2008 bis 2009 umfasste die 18 Kreuzreihenhäuser zwischen Quittenund Kirschenweg. Hier stand neben der bautechnischen und energetischen Sanierung die Steigerung der Wohnqualität durch zusätzliche Fläche im Vordergrund. Mit einer Grundfläche von 53 m² waren die Reihenhäuser bescheiden dimensioniert. Das Erdgeschoss beherbergte die Küche, das Wohnzimmer und ein Bad mit Waschküche; im Obergeschoss gab es drei Schlafzimmer und ein WC. Neben den engen Raumverhältnissen und dem unbefriedigenden Zustand der Sanitärräume war primär auch die Erschliessung ein Problem: Durch das Fehlen von Verkehrsfläche befand man sich beim Eintreten praktisch bereits auf der Treppe ins Obergeschoss, der Keller konnte nur durch die Küche erschlossen werden.
Die Erweiterung lösten die Architekten durch einen nach Süden ausgerichteten eingeschossigen Anbau für Küche und Wohnzimmer, eine Holzkonstruktion mit Eternitverkleidung, die auf einer Bodenplatte aufgeständert ist. Die Küche wurde als Küchenzeile in den Verbindungsgang zwischen Bestand und Anbau platziert. Der durchgängige Linoleumboden betont den fliessenden Grundriss; es entsteht eine – an den Proportionen des ehemaligen Arbeiterhauses gemessen – geradezu grosszügige Enfilade. Der Vorteil dieser horizontalen Erweiterung liegt auf der Hand: Die Zusatzfläche wird für Wohnräume geschaffen, dort, wo die Bewohner sie am dringendsten benötigen. Darüber hinaus entsteht durch den neuen L-Grundriss im Aussenraum ein semiprivater Hof. Dem Anbau haftet etwas Provisorisches an, Assoziationen mit Schrebergärten, Schuppen drängen sich auf – eine bewusste Reverenz an die Geschichte der Siedlung.
In den Innenräumen verfolgte man eine Strategie der sanften wertsteigernden Eingriffe: Alle Gebrauchsräume – Küche, Wohnzimmer, Esszimmer und das Badezimmer mit Waschmaschine – sind im Erdgeschoss auf einem Niveau untergebracht. Ein zusätzlicher Aussenzugang zum Keller entspannt zudem die Erschliessungssituation. Die dringend nötige Sanierung des Daches wurde mit vorfabrizierten isolierten Holzelementen durchgeführt. Auf diese Weise konnte das Dach angehoben und eine Raumhöhe von 2.55–2.75 m im Obergeschoss ermöglicht werden. Die analog zum ursprünglichen Bestand projektierte Terrasse im Obergeschoss fiel Einsparungen zum Opfer. Zudem befürchtete die Bauherrschaft durch mögliche Einblicke in das Nachbargrundstück Einbussen in der Privatsphäre der Bewohner. Während des Umbaus stellte sich heraus, dass die Bausubstanz noch schlechter war als befürchtet: Im Treppenhaus war das Mauerwerk teilweise stehend vermauert, was eine Berechnung des Tragwerks praktisch verunmöglichte. Als Konsequenz versuchte man, zusätzliche Schwächungen des Mauerwerks zu vermeiden sowie – ganz allgemein – einen möglichst hohen Anteil der Originalsubstanz zu erhalten. Ein Beispiel: Während im ganzen Haus ein neuer Bodenbelag aus orange-gelbem Linoleum verlegt wurde, findet sich in einem der Räume im Obergeschoss ein Parkettboden. Dies ist der einzige Raum, in dem keine Abbrucharbeiten an den bestehenden Wänden vorgenommen wurden, das Parkett konnte übernommen werden. Da die Kreuzreihenhaus-Typologie natürliches Licht lediglich von der Fassadenseite her erlaubt, betraf ein wichtiger Eingriff die Lichtführung. Das bestehende Oberlicht wurde ersetzt, statt nur ins Obergeschoss leitet ein Lichtschacht neu natürliches Licht bis ins Wohn- / Esszimmer im Erdgeschoss. Das darüberliegende Schlafzimmer ist zum Schacht hin verglast und profitiert auf diese Weise ebenso von der zusätzlichen Helligkeit. Neben der Steigerung der Wohnqualität war auch die energetische Sanierung ein wichtiges Thema. Hier war die Kreuzreihenhaus-Typologie von Vorteil, die einzelnen Häuser konnten als gesamthaftes Volumen betrachtet werden. Eine Innendämmung wurde von der Bauherrschaft aus Platzgründen abgelehnt, die Architekten wollten aber ein «Verpacken» der Fassade möglichst vermeiden. Isoliert wird nun über die vorgefertigten Holzelemente des Daches, lediglich die Kopfbauten erhielten eine zusätzliche Dämmung an den Aussenfassaden. Daneben wurde die Fassade auch farblich aufgewertet: Die ehemals einheitlichen Fronten der Häuserreihe werden nun differenziert behandelt, während die vorgestellten Anbauten, die jetzt die neue Fassade gegen aussen bilden, mit grauem Eternit verkleidet sind. Als Reverenz an den Bestand wurden die neuen Haustüren rot gestrichen.
Heterogen statt zusammenhängend
Nach Fertigstellung der 18 Reihenhäuser im Mai 2009 sollte die anschliessende Reihe zwischen Kirschen- und Pfirsichweg nach dem gleichen Konzept saniert werden. Dazu wird es nicht kommen: Aufgrund von Differenzen zwischen Bauherrin und Architekten entschloss sich Erstere, die Zusammenarbeit zu beenden. Statt einer Sanierung ist ab April 2010 der Abriss der originalen Kreuzreihenhäuser geplant. An ihrer Stelle entstehen Ersatzbauten, die aufgrund des Volumenschutzes den sanierten Reihenhäusern samt Anbauten entsprechen werden. Der Entscheid ist zu bedauern, zeugt aber – von der Fragwürdigkeit einer solchen Rekonstruktion abgesehen – immerhin für die städtebauliche Qualität des Entwurfs von Knapkiewicz & Fickert: Mit den Anbauten gelang eine erhebliche Steigerung der Wohnqualität, ohne den Charakter der Siedlung zu zerstören. Sie bereichern das Quartier auf spielerische, selbstverständliche Art und ermöglichen eine zeitgemässe Nutzung.
Anmerkungen:
[01] Christoph Luchsinger, «Adolf Kellermüller (1895–1981). Drei Siedlungsunternehmen». archithese 6/1983
[02] Kellermüller bevorzugte den Ausdruck «Bauen der neuen Sachlichkeit» gegenüber «Neues Bauen». Es ging ihm nicht um die Erfindung einer neuen Baukultur, sondern um das Wiederfinden verlorener Qualitäten. Vgl.: Adolf Kellermüller, «Gedanken über Wesen und Aufgabe des Architekten», handschrift - liches Manuskript für ein Referat für die Oberklassen der Kantonsschule Winterthur, 8.2.1946, S.4TEC21, Fr., 2009.09.25
25. September 2009 Tina Cieslik