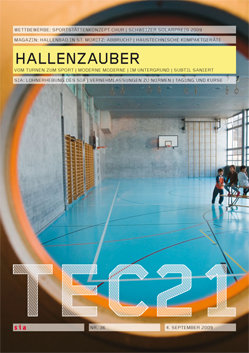Editorial
Sport – in der Schule, im Verein und immer häufiger individuell betrieben – ist kaum mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Das war nicht immer so: Breitensport ist ein Phänomen der modernen Gesellschaft. Die Ursprünge in der Schweiz legte die Turnbewegung, der Konflikt zwischen den Befürwortern der englischen «Sports» und den Vetretern des deutschen Turnens dauerte nahezu ein Jahrhundert. Lange behielt das politisch und reformpädagogisch motivierte Turnen die Oberhand: Die Ausstattung von Turnhallen orientierte sich bis in die 1960er-Jahre an militärischen Bedürfnissen («Vom Turnen zum Sport», S. 32ff.).
Dass es beim «Ausführen von Leibesübungen» um weit mehr als um schweiss-getränktes Kräftemessen geht, wusste bereits der Schweizer Turnvater JohannesNiggeler: «Ein Hauptzweck des Turnens ist auch Weckung des Sinnes für Schönheit und Bildung zur Schönheit.»1 Besonders gut wecken lässt sich Ersterer in der Doppelturnhalle der Schule Neumarkt in Biel: Das Gebäude der Bieler Moderne wartet mit einem ungewöhnlichen Raum- und einem sensiblen Farbkonzept auf. Ähnlich ausgewogen wie der Bau ging auch die Sanierung vonstatten. Sie bewegte sich fein austariert im Spannungsfeld zwischen Denkmalpflege und energetischen Bedürfnissen («Moderne Moderne», S. 38ff.).
Die aus den 1970er-Jahren stammende Turnhalle der Volksschule im Berner Tscharnergut ist wie viele Hallen unterirdisch angeordnet. Ihr Flachdach bildet den Pausenplatz der Schule. Im Lauf der Zeit wurde dieses undicht, es tropfte in den wegen seiner Farbgebung «Aquarium» genannten Raum. Momentan wird die Halle saniert – auch aufgrund der bei Turnhallen aus dieser Zeit häufig auftretenden Schadstoffbelastung («Im Untergrund», S. 43ff.). Auch die Zürcher Polyterrasse erfuhr eine Neugestaltung. Auf den ersten Blick nicht ersichtlich: Unter den versetzt angeordneten Ebenen der Anlage befinden sich die Turnhallen der ETH Zentrum («Subtil saniert», S. 46ff.).
Bei einem Heft zum Thema Turnhallen darf ein Ereignis nicht unerwähnt bleiben: Am 24. Februar diesen Jahres stürzte das Dach der im Juli 2006 eingeweihten Dreifachturnhalle der Gewerbeschule Riethüsli in St.Gallen ein. Da sich das Unglück vor Schulbeginn ereignete, gab es glücklicherweise keine Opfer. Über die Gründe für den Einsturz können wir (noch) nicht berichten – die Staatsanwaltschaft St. Gallen erwartet den ursprünglich für Anfang Juli angekündigten Bericht der Empa Ende September.
Tina Cieslik
Anmerkung
[01] Johannes Niggeler: Turnschule für Knaben und Mädchen. 8. Auflage, Schulthess, Zürich 1888, S. 17
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Sportstättenkonzept Chur | Schweizer Solarpreis 2009
14 MAGAZIN
Hallenbad in St. Moritz: Abbruch? | Haustechnische Kompaktgeräte | Usic: zuversichtlich in die Zukunft | Neue Sporthallen | Energie und Baudenkmäler | Wechsel in Zürcher AG für Kunst
27 MESSEN
Vom 3.–7. September 2009 findet in der Messe Zürich zum 40. Mal die «Bauen & Modernisieren» statt. Parallel dazu ist vom 4.–7. September die «Eigenheim-Messe Schweiz» zu sehen.
32 VOM TURNEN ZUM SPORT
Tina Cieslik
Die Entwicklung von politisch motivierten Leibesübungen zum heutigen Gesundheits- und Eventsport widerspiegelt sich in der Anlage und der Ausstattung von Sportstätten.
38 MODERNE MODERNE
Katja Hasche
Bei der Sanierung einer Bieler Doppelsporthalle aus den 1930er-Jahren gelang die Berücksichtigung denkmalpflegerischer sowie energetischer Ansprüche.
43 IM UNTERGRUND
Daniel Engler
Im Berner Tscharnergut wird derzeit die unterirdische Turnhalle aus den 1970er-Jahren erneuert.
46 SUBTIL SANIERT
Hansjörg Gadient
Die über den unterirdischen ETH-Turnhallen liegende Polyterrasse hat eine Neugestaltung erfahren.
52 SIA
Die Lohnerhebung des SIA liegt vor | Vernehmlassungen zu Normen | Tagung und Weiterbildungskurse SIA
59 FIRMEN
77 IMPRESSUM
78 VERANSTALTUNGEN
Vom Turnen zum Sport
Gespielt und gewetteifert wurde schon immer. Während in der Antike und im Mittelalter Turniere und Wettkämpfe bestritten wurden, brachte die Aufklärung eine Betonung des Gesundheitsaspektes für die gesamte Bevölkerung. Es entstanden Hallen zur Ausübung der Körperertüchtigung, die sich in Grösse und Raumprogramm an den Bedürfnissen des Turnens orientierten. Die Zunahme der englischen Teamsportarten seit Anfang des 20. Jahrhunderts führte zu einer kontinuierlichen Adaptierung der Gebäudetypologie.
Jahrhundertelang war die systematische, leistungsorientierte Leibesertüchtigung dem Adel vorbehalten, während sich das Volk mit punktuell stattfindenden Spielen amüsierte. Im Gegensatz zur Antike und zum Mittelalter zeichnet sich der «moderne Sport» daher durch seine Breitenwirkung aus, die alle Gesellschaftsschichten umfasst. Die Grundlagen für diese Entwicklung wurden durch die Ideen der Aufklärung gelegt. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde in Europa über den Stellenwert des Körperbewusstseins und der Körperertüchtigung debattiert. In seinem pädagogischen Werk «Émile ou de l’éducation» von 1762 betonte Jean-Jacques Rousseau die Bedeutung von Spielen und Bewegung als Teilen der Erziehung. Johann Heinrich Pestalozzi schuf die Idee der ganzheitlichen Entwicklung (Kopf, Hand, Herz) und formte daraus seine Elementargymnastik. 1793 erschien mit der «Gymnastik für die Jugend» von Johann Christoph Friedrich GutsMuths das erste systematische Lehrbuch der Turnkunst.
Realer Hintergrund dieses Prozesses war die Industrialisierung, die den Übergang von der Selbst- zur Fremdversorgungsgesellschaft und die Automatisierung der Produktion brachte. Die neue Klasse der Arbeiter stellte sozialpolitische Forderungen, etwa nach der Fünftagewoche und dem Achtstundentag, und schuf damit die Voraussetzung für etwas, das bis anhin nur die Herrschenden kannten: Freizeit. Allmählich hatte auch die Unterschicht Zeit, Musse und das Bedürfnis, sich Anerkennung ausserhalb des Arbeitsplatzes zu verdienen – eine Freiheit, die es auszufüllen galt.
„Sports“ in England - „Turnen für das Vaterland“ in Deutschland
In den europäischen Ländern bildeten sich verschiedene Modelle der Leibesertüchtigung aus, wegweisend waren England und Deutschland. In England, dem Ursprungsland der industriellen Revolution, waren Arbeitsteilung und individuelle Leistungsorientierung bereits Mitte des 18. Jahrhunderts weit fortgeschritten. Der sportliche Ansatz bestand hier darin, die traditionellen Volksspiele wie Rugby und Fussball stärker zu formalisieren und zu pädagogischen Zwecken zu nutzen. Die Begriffe «Fair Play» und «Gentlemanly Behaviour» sollten auch ausserhalb des Sports für breite Bevölkerungsschichten Bedeutung erlangen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann das englische Sportmodell auf den europäischen Kontinent überzuschwappen. Im deutschsprachigen Raum stiess es dabei auf erbitterten Widerstand der Turnvereine, die sich als Vertreter der körperlichen Bewegung etabliert hatten. Leibesübungen waren hier gleichzusetzen mit Turnen, und sehr oft: Turnen fürs Vaterland. Die Besetzung weiter Teile Deutschlands Anfang des 19. Jahrhunderts durch französische Truppen weckte den Drang zu bewaffnetem Widerstand, was den Stellenwert eines gesunden, wehrhaften Körpers erhöhte. Der bekannteste Protagonist innerhalb dieser nationalen Bewegung war «Turnvater» Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852). 1811 eröffnete er vor den Toren Berlins den Turnplatz Hasenheide, der eine hierarchiefreie deutsche Nation symbolisierte, wo sich alle mit «Du» ansprachen und ähnliche Kleidung trugen. Das galt allerdings nur für den männlichen Teil der Bevölkerung: Die Betonung des Wehrcharakters schloss die Teilnahme von Turnerinnen aus. Die stark nationalistisch motivierte Turnbewegung mit ihrem Streben nach einer einheitlichen Nation entwickelte sich jedoch zunehmend zu einer Provokation für die regierenden Kreise der deutschen Kleinstaaten: 1820 verhängte Preussen eine «Turnsperre», viele der deutschen Fürstentümer folgten. Jahn wurde verhaftet und unter Arrest gestellt, etliche seiner Anhänger flohen ins Ausland.
Turnbewegung und Nationalbewusstsein in der Schweiz
Zu dieser Zeit existierten in der Schweiz nur vereinzelt Einrichtungen zur Körpererziehung, etwa der Turnbetrieb, den der Turnlehrer Phokion Heinrich Clias (1782–1854) auf der Kleinen Schanze in Bern initiierte. 1816 schlossen sich Studenten unter Clias’ Führung zur «Vaterländischen Turngemeinde» und damit zum ersten Turnverein der Schweiz zusammen. Mit der Turnsperre in Deutschland gelangte das Jahn’sche Turnen auch in die Schweiz, wo es sich rasch verbreitete: 1832 erfolgte die Gründung des Eidgenössischen Turnvereins in Aarau. Ein wichtiges Bindeglied der zahlreichen Turngemeinden waren die jährlichen gesamtschweizerischen Turnfeste. Neben dem Sechskampf, bestehend aus Freiübungen, Wettlaufen, Springen sowie Übungen an Pferd, Barren und Reck, wurden 1855 Schwingen, Ringen, Steinstossen und Steinheben als «Nationalturnen» und als eigenständiger Wettkampf eingeführt.
Die Turnbewegung bildete in der Schweiz des 19. Jahrhunderts nicht nur die massgebliche Form der körperlichen Ertüchtigung; sie spielte auch eine sozialpolitische Rolle. Die Vereine waren Orte der Begegnung und der Festkultur. An den Feiern wurden patriotische Gefühle und Rituale gepflegt und das Nationalbewusstsein beschworen. Zwar gab es auch in der Schweiz restaurative oder sittlich-moralische Kritik an der Turnbewegung, etwa aus Sorge um etwaigen Autoritätsverlust von Pfarrern oder anderen Respektspersonen. Ein wesentlicher Unterschied zur Entwicklung in Deutschland war jedoch, dass sich die 1834 in den Statuten des Eidgenössischen Turnvereins festgeschriebene «Einigung der schweizerischen Turnerschaft» und die «nationale Erziehung der schweizerischen Jugend» nicht gegen die Regierung richtete.1 Dazu gab es auch keinen Grund, seit der Helvetischen Republik galt die Volkssouveränität. Im Gegenteil: Die Vereine fungierten als Stütze und Übungsfeld basisdemokratischer Verfahrensformen.
Die Pflege einheimischen Volkstums und nationaler Gesinnung inerhalb der Turnbewegung zeugt von einem Streben nach einer Gemeinschaft, die alle Bevölkerungsschichten umfasste.
Bauten und Dimensionen
Zu Beginn der Bewegung fand der Turnbetrieb in der Regel an fest installierten Geräten im Freien statt. So hatte eine Turnanlage gemäss Friedrich Ludwig Jahn primär folgende Kriterien zu erfüllen: «Jeder Turnplatz muss wo möglich folgende Beschaffenheit, Gelegenheit und Örtlichkeit haben. – Er muss eben sein, muss hoch liegen [...]; er muss festen, mit kurzem Rasen bedeckten Boden haben, und mit Bäumen bestanden sein [...]. Ein Hauptbedürfnis für jeden Turnplatz [...] ist eine verschliessbare feste Hütte [...] zur Aufbewahrung des beweglichen Turnzeugs und Geräthes [...]».[2] Die zunehmende Institutionalisierung und die Integration des Turnens in die schulische Erziehung führte aber bald zum Bau von einfachen Turnhallen. Johannes Niggeler (1816–1887), einer der bekanntesten Exponenten der Bewegung und Förderer des Schulturnens in der Schweiz, forderte 1860 eine Grundfläche von 2400 Fuss (ca. =12 × 24 m) pro gedeckte Anlage, damals für Klassen mit bis zu 50 Schülern und Schülerinnen.[3]
Im Zusammenhang mit dem ersten offiziellen Lehrmittel für den Schulturnunterricht, der 1876 erschienenen «Turnschule für Knaben und Mädchen» von Johannes Niggeler, publizierte die dem Militärdepartement angegliederte Eidgenössische Turnkomission (ETK) ab 1878 regelmässig Empfehlungen zum Turnstättenbau. Ab 1911 erschienen sie unter der Bezeichnung «Normalie». Das Reglement vom 1. August 1911 sah Hallenmasse von 9 × 18 m vor; Platz finden mussten ein Rollbalken, vier Rollrecke, acht Kletterstangen und vier Klettertaue. Diese Dimensionen waren ausschliesslich auf das Geräteturnen und damit auf die Bedürfnisse des Militärs bei der Aushebung abgestimmt. Trotz der abnehmenden Bedeutung des Wehrcharakters des Turnens und der zunehmenden Verbreitung der Ballspiele blieben diese Masse bis in die 1960er-Jahre hinein ausschlaggebend für den Sporthallenbau.
Polyvalente Bauten für den polysportiven Betrieb
Anfang des 20. Jahrhunderts geriet die militärische Ausrichtung des Turnens in die Kritik. Die Reformpädagogik kritisierte Künstlichkeit und Militarisierung des Schulturnens, während sich der Freizeitsport mit dem Aufkommen von Wanderbewegung, Leichtathletik und Ballsportarten immer weiter diversifizierte und institutionalisierte. Gleichzeitig setzte eine Professionalisierung ein, die sich auch in Dimension und Ausstattung der Sportstätten manifestierte. Schliesslich erlaubte erst die Standardisierung von Sportstätten und -geräten den objektiven Leistungsvergleich.
Ab den 1960er-Jahren war bei den Ballsportarten, die vorwiegend draussen gespielt wurden, ein Trend zur Verlagerung in die Halle zu erkennen. Die Wettspielmasse der Mannschaftssportarten beeinflussten die Dimensionen der Sporthallen, es entstanden die ersten Mehrfachhallen. Die heute bekannte klassische Dreifachhalle mit den Massen 45 × 27 m wurde in Deutschland aus der damals vorherrschenden Einfachhalle (15 × 27 m) entwickelt. Seit Oktober 2008 empfiehlt das Bundesamt für Sport (Baspo) für den Neubau von Dreifachhallen eine Grösse von 49 × 28 m. Dabei wird von einem Modul ausgegangen, das sich an einem Basketballfeld (26 × 14 m) inkl. umlaufenden Sicherheitsabstands von 1 m und dem Platzbedarf mobiler Trennwände (je 0.5 m) aufbaut (vgl. Abb.11). Auch die Anzahl der Kriterien, die es beim Sporthallenbau zu beachten gilt, ist gewachsen. Immer mehr und immer schnelllebigere Trends im Sport führen zu baulichen Anpassungen. Ausser den eigentlichen Turngeräten bieten die Hallen heute eine Vielzahl an Sportmöglichkeiten, wie das Anfang Mai eröffnete, vom Bregenzer Architekturbüro Dietrich/ Untertrifaller realisierte Sport Center an der ETH Hönggerberg zeigt. Dessen «konventionelles Angebot» wurde u.a. auf dem Dach um Plätze für Tennis, Bogenschiessen und Beachvolleyball erweitert. Seit 2004 kommen bei der militärischen Aushebung keine Kletterstangen mehr zum Einsatz. Sie werden daher – dem aktuellen Sportklettertrend folgend – zunehmend durch Kletterwände ersetzt. Beim Innenausbau ist neben der Wahl des richtigen Bodens (punkt-, kleinflächen-, flächen- oder kombielastisch) das Prinzip der «glatten Wand» zu berücksichtigen: Das bedeutet, dass die Oberfläche nicht rau und bis auf mindestens 2.70 m ab Boden flach, geschlossen und splitterfrei ausgebildet sein muss.
Die Zuwendung zu Ball- und Laufspielen hat die Zahl der Unfälle durch den Aufprall an der Hallenwand markant erhöht, eine nachgiebige Wandverkleidung ist daher wünschenswert. Die «glatte Wand» beinhaltet auch den flächenbündigen Einbau von ausklapp- oder hochfahrbaren Sportgeräten wie Sprossenwänden oder Ballspieltoren sowie den bündigen Einbau von Fenstern, Türen oder Heizungselementen.
Je nach Niveau gelten zudem Mindeststandards bei der Beleuchtung. Als Richtwerte sind für das Training 300 lx vorgesehen, bei regionalen Wettkämpfen 500 lx sowie 750 lx bei internationalen Konkurrenzen. Darüber hinaus sollte eine Halle möglichst blendungsfrei und gleichmässig ausgeleuchtet sein. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Akustik: Um den Lombard-Effekt, das Aufschaukeln des Schalls, zu minimieren, gilt für Mehrfachhallen eine maximale Nachhallzeit von ≤ 2.5 s.[4] Durch die Professionalisierung des Breitensports müssen die Hallen auch zuschauertauglich sein, was erhöhte Anforderungen an Brandschutz, Fluchtwege und unterstützende Infrastruktur mit sich bringt. Mit dem Wunsch nach energetischer Effizienz sowohl im Bau als auch im Betrieb ist in letzter Zeit ein weiterer Aspekt hinzugekommen, den es bei der Planung zu berücksichtigen gilt. Dass dies möglich ist, zeigen die 44 Neu- und Umbauten von Hallen, die in den letzten Jahren den Minergie- Standard für Sportbauten erreicht haben.[5]
Zeitgenössische Bauaufgabe
Aus den militärisch und politisch motivierten und bald standardisierten Körperübungen von Niggeler, Clias und Jahn ist längst eine diversifizierte Freizeitbeschäftigung geworden. Sporttreibende sind heute Individualisten, die zwischen verschiedenen Angeboten wechseln, je nach Mode, Bedürfnis oder Lebensphase. Diese Komplexität drückt sich in den dazugehörigen Bauten aus: Ein Blick auf die Wettbewerbslandschaft in der Schweiz zeigt, dass in den nächsten Jahren etliche neue Sporthallen entstehen und bestehende Anlagen den heutigen Anforderungen angepasst werden. Der Sport ist also tatsächlich im Alltag angekommen, ein Massenphänomen, dessen «fruchtbare Wirkungen nicht bloss das Leben auf dem Turnplatze sondern (…) auch für das gesellschaftliche und staatliche Leben (…) von Nutzen sind (…).»[3]
Anmerkungen:
[01] Zum Vergleich: «Das Turnwesen in Deutschland ist ein allgemeiner Männerbund zum Sturze der Tyrannei, zur Begründung der Freiheit, des Lichtes und der Einengung von Willkür.» Aus dem Protokoll des Frankfurter Turnfestes von 1847
[02] Friedrich Ludwig Jahn: Die deutsche Turnkunst. Berlin 1816, S. 188
[03] Johannes Niggeler: Turnschule für Knaben und Mädchen. 8. Auflage, Schulthess, Zürich 1888, S. 18
[04] Richtlinien zum Sporthallenbau finden sich u.a. in der Baspo-Norm 201 (2008) und der bfu-Dokumentation «Sporthallen-Sicherheitsempfehlungen für Planung, Bau und Betrieb»
[05] Bei Neubauten gilt eine Energiekennzahl von 25 kWh/m2, bei Umbauten 40 kWh/m2TEC21, Do., 2009.09.03
03. September 2009 Tina Cieslik
Moderne Moderne
Gespielt und gewetteifert wurde schon immer. Während in der Antike und im Mittelalter Turniere und Wettkämpfe bestritten wurden, brachte die Aufklärung eine Betonung des Gesundheitsaspektes für die gesamte Bevölkerung. Es entstanden Hallen zur Ausübung der Körperertüchtigung, die sich in Grösse und Raumprogramm an den Bedürfnissen des Turnens orientierten. Die Zunahme der englischen Teamsportarten seit Anfang des 20. Jahrhunderts führte zu einer kontinuierlichen Adaptierung der Gebäudetypologie.
Das Übereinanderstapeln sportlicher Einrichtungen ist en vogue. Was zeitgemäss scheint, wurde schon in der Klassischen Moderne praktiziert: In Biel steht eine Anlage aus den 1930er-Jahren, in der ein Schwingraum, zwei Turnhallen und eine off ene Gymnastikterrasse übereinandergestapelt sind. Das Beispiel zeigt nicht nur, dass die Gebäudetypologie heutigen Ansprüchen genügt, sondern auch, wie eine energetische Sanierung gestalterisch überzeugend umgesetzt werden kann.
Was als räumliches Konzept spektakulär erscheint, macht vor Ort einen ganz selbstverständlichen Eindruck. Südlich der Bieler Altstadt am Schüsskanal gelegen, fügt sich das Gebäude der Moderne eher zurückhaltend in die dreiteilige Schulanlage Neumarkt ein. Die zwischen der Errichtung der drei Gebäude liegende Zeitspanne von 43 Jahren zeugt von einer rasanten geschichtlichen Entwicklung. Das älteste, im Stil der Neurenaissance gestaltete Schulhaus stammt von 1889 – einer Zeit, als die boomende Uhrenindustrie eine starke Bevölkerungszunahme auslöste. Bereits zehn Jahre später war das Gebäude für die steigenden Schülerzahlen zu klein und erhielt eine Aufstockung. 1913 folgte mit dem benachbarten, im Heimatstil gestalteten Schulhaus Logengasse 4 die nächste Erweiterung. Als letztes Glied zwängte sich 1931 das Turnhallengebäude in die Reihe. Sein bestechendes architektonisches Konzept verdankt das Gebäude dem Stadtarchitekten Otto Schaub, der die Moderne in Biel durch Reglemente wie das Flachdachgebot im Bahnhofquartier stark förderte. Mittlerweile ist das Turnhallengebäude im Bauinventar der Stadt Biel als «schützenswert» verzeichnet. Typisch für die 1930er-Jahre, erscheint das Gebäude als kompakter, geschlossener Kubus. Entsprechend der funktionalen Einfachheit des Neuen Bauens ist die innere Nutzung von aussen klar ablesbar. Im Süden befinden sich die beiden Turnhallen, von denen die untere als Gerätehalle, die obere als Leichtathletikhalle genutzt wurde. Die darüber liegende, mit geschosshohem Maschendraht umzäunte Dachterrasse diente als offener Gymnastikraum, mit Blick auf die Stadt Biel und den Jura.
Seit ihrem Bau war keines der drei Schulgebäude grundlegend saniert worden. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Stadt Biel – Mitte des 20. Jahrhunderts stagnierte erst die Uhren-, dann die Maschinenindustrie – fiel auch der Unterhalt der Bauten sparsam aus. Wie stark sich die Bevölkerung im Jahr 2005 für die rund 17 Mio. Fr. teure Gesamtsanierung der Schulanlage Neumarkt einsetzte, bewies das mit 80 % Ja-Stimmen positive Abstimmungsergebnis.
Wertehaltende Eingriffe
Die von den Bieler spaceshop architekten projektierten und begleiteten Sanierungsarbeiten dauerten von Mai 2006 bis Juli 2007. Während der Bau von 1913 nur partielle Eingriffe erfuhr, wurden das Schulhaus von 1889 und das Turnhallengebäude aufwendig saniert. Die Analyse von Letzterem legte erhebliche Schäden offen: Mehrfache Korrektionen der Juragewässer und der torfige Boden hatten zu einer Absenkung der Bodenplatte um 20 cm geführt. Die inneren Fundamente waren desolat, die Wände rissig. Probleme bereitete auch das aufgehende Mauerwerk, das an mehreren Orten feuchte Stellen aufwies. Um weiteren Senkungen vorzubeugen, mussten die nichttragende Bodenplatte und die Zwischenwände des Untergeschosses entfernt werden. Mit einer Vielzahl von Mikropfählungen wurde eine neue Platte eingebracht. Nach der Entfeuchtung des Mauerwerks wurde der Aussenputz stellenweise ausgebessert. Der Ersatz der Fenster bleibt im Nachhinein ein Wermutstropfen, da originale Fenster nicht mehr häufig anzutreffen sind. Nach Aussage der beteiligten Plane rliess sich der Fensterersatz jedoch aufgrund des schlechten Zustandes nicht vermeiden. Immerhin konnten die aufgesetzten Drehbeschläge wieder verwendet werden.
Für die weitere Nutzung des Turnhallengebäudes stellte die Kleinteiligkeit der Innenräume ein Problem dar. Vor allem die beiden Turnhallen genügten mit 12 x 24 m den heutigen Anforderungen nicht mehr. Statt dem Bestehen auf starren Normen war hier Umdenken angesagt. Mit dem Beschluss der Stadt, auf dem benachbarten Gaswerkareal eine neue Dreifachturnhalle zu erstellen, wurde diese Problematik entschärft. Im September 2009 wird die neue, von GXM Architekten aus Zürich erstellte Sportstätte bezogen. Durch das auf diese Weise zusätzlich generierte Raumangebot konnte im alten Turngebäude eine der beiden Hallen als Aula umgenutzt werden. Trotz der ungünstigeren Erschliessungssituation entschieden sich die Planer für die obere Halle: Diese Variante bereitete weniger Trittschallprobleme, bedingte jedoch einen zweiten Fluchtweg. Also fügten die Architekten analog zu dem bestehenden Treppenhaus ein zweites Treppenhaus auf der gegenüberliegenden Gebäudeschmalseite an. Von aussen beinahe etwas zu stark mit dem Altbau verschmolzen, setzt es sich im Innenraum durch subtil gestaltete Details vom Bestand ab.
Bei der Gestaltung der neuen Aula war es den Architekten wichtig, dass diese weiterhin als Turnhalle nutz- und ablesbar bleibt. Dementsprechend elastisch ist der neue Bodenaufbau ausgeführt, und auch die für den Sportbetrieb charakteristische Symbolik wurde in reduzierter Form wieder aufgebracht. Wie bei der unteren Turnhalle, die weiterhin ausschliesslich Sportzwecken dient, wurden auch bei der Aula die ursprünglich markant in Erscheinung tretende Rippenkonstruktionen bündig eingekleidet. Dieser Eingriff trägt den heutigen Sicherheitsbestimmungen der «glatten Wand» Rechnung, beeinträchtigt jedoch den räumlichen Eindruck. Dafür bietet der neue Zwischenraum genügend Platz für Haustechnik- Installationen und Lüftungskanäle. Und auch die Verkleidungselemente haben eine doppelte Funktion: Teilweise perforiert, blasen sie Frischluft in die Halle oder dienen, mit Dämmmaterial hinterlegt, dem Schallschutz. Während die Turnhallen ihre räumliche Struktur und ursprüngliche Farbigkeit bewahrten, erfuhren die anschliessenden Nebenräume wie Garderoben, Turnmaterialraum und Sanitärräume grössere Veränderungen. Zugunsten zusammenhängender Flächen wurde die kleinteilige Raumaufteilung geöffnet sowie die Farbigkeit neu interpretiert – aufbauend auf einer umfassenden Untersuchung durch einen Restaurator zu Beginn der Planungsphase. Vor der Aula befindet sich heute ein Foyer, das bei Anlässen von der einen Stock darüber liegenden Schulküche bewirtschaftet wird. Als zusätzliche Veranstaltungsfläche dient der umgestaltete Attikaaufbau auf dem Dach.
Energiesanierung versus Denkmalpflege
Während die funktionellen Interventionen im Gebäude sichtbar sind, gilt dies für die Massnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz glücklicherweise nicht. Im Laufe des Planungsprozesses konnte die Energiebilanz mit Hilfe einer externen Energieberatungsstelle so optimiert werden, dass sowohl das Turnhallengebäude als auch der Bau von 1889 heute den Minergie-Standard für Umbauten erfüllen, inklusive der Sekundäranforderungen an Beleuchtung und Warmwasser.
Einen grossen Schritt in Richtung Minergie bedeutete die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien. Statt der alten Gas-Öl-Heizung liefert heute eine Pellets-Heizung im Altbau rund 80 % der jährlichen Energie für Heizung und Warmwasser. Die Spitzen werden im Hochwinter über einen zusätzlichen Gaskessel abgedeckt. Auch bei der neuen Lüftung im Turnhallengebäude setzten die beteiligten Partner mit Wärmerückgewinnung auf eine energieeffiziente Lösung. Bei der Isolation des Gebäudes musste man sensible Massnahmen ergreifen, da aus denkmalpflegerischen Gründen eine Aussendämmung nicht zur Debatte stand. Das bislang ungedämmte, massive Mauerwerk der Aussenwände wies eine Stärke von 45 cm auf. Statt das gesamte Gebäude einzupacken, feilschten Architekten und Ingenieure bei der Berechnung um Zentimeterstärken. Neu gedämmt wurden Teile der inneren Südfassade mit 10–20 cm Glasfaserplatten, das Flachdach mit 16 cm XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum) sowie die Dachterrasse mit 14 cm Schaumglas. Die Bodenplatte im Kellergeschoss erhielt eine Dämmung aus 12 cm XPS. Insgesamt konnte so der jährliche Heizenergieverbrauch beider Gebäude um etwa ein Drittel reduziert werden. Das Erreichen des Minergie-Standards für Umbauten wurde frühzeitig von der Bauherrschaft als Zielvorgabe definiert – allerdings immer unter der Prämisse der denkmalpflegerischen Verhältnismässigkeit. Diese Überlegungen hatten konstruktive und gestalterische Konsequenzen.
Dass es nicht immer gelingt, die Wahrung von Altbausubstanz und Energiesanierung so gut unter einen Hut zu bringen, beweisen zahlreiche ehrgeizige Übersanierungen, bei denen Altbauten komplett eingepackt oder durch andere Massnahmen entstellt werden. Der Konflikt zwischen energietechnischen und substanzerhaltenden Anforderungen ist präsent und wird in Zukunft vermehrt Thema sein (vgl. TEC21, 45/2008). Gemäss Rolf Weber von der Kantonalen Denkmalpflege Bern ist ein gutes Ergebnis nur dann möglich, wenn alle beteiligten Partner intensiv nach einer verträglichen Lösung suchen. Die Sanierung des Schulgebäudes Neumarkt sei ein Glücksfall – dank bewusst diskret gewählten Eingriffen habe das Gebäude seine Seele behalten. Diese Seele manifestiert sich auch in dem Kunst-am-Bau-Schriftzug auf dem Hauptgebäude: «Erinnerst Du Dich» steht dort in grossen Lettern – angesprochen sind alle Ehemaligen, für die das Schulhaus ein Träger von Erinnerungen ist.TEC21, Do., 2009.09.03
03. September 2009 Katja Hasche