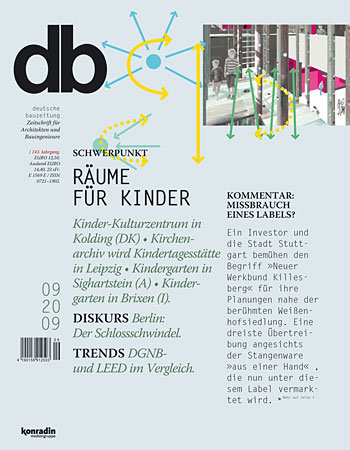Editorial
Wie sollte Architektur für Kinder aussehen? Allgemein gültige Lösungen, wie man sie noch in den 60er Jahren für erstrebenswert hielt, gibt es aus heutiger Sicht nicht. Aber eins ist klar: Individualität und Flexibilität sind wichtige Parameter. So müssen die Gebäude und Räume sensibel auf Lage und Umgebung, Gruppengröße und Alter der Kinder zugeschnitten sein und sich flexibel bespielen lassen, ohne dabei unverbindlich zu wirken. Doch die Architektur soll Kindern nicht nur Raum bieten, sondern auch deren Sinn für Dimensionen, Formen, Strukturen, Materialien sowie Farben wecken und schärfen. Architekten und Planer haben hierzu vielfältige gestalterische Möglichkeiten. Auf den folgenden Seiten zeigen wir, wie qualitätvolles Bauen für Kinder aussehen kann, wenngleich sich bei dem einen oder anderen Projekt dennoch kritische Fragen ergeben haben. uk
Dreidimensionaler Hintergrund
(SUBTITLE) Kindergarten mit zwei Sprachsektionen in Brixen
Der städtische Kindergarten »Rosslauf« in der Südtiroler Gemeinde Brixen präsentiert sich als bereitwilliger Rahmen für alle nur denkbaren Aktivitäten. Klare Formen und der sparsame Einsatz von Materialien machen ihn für Kleinkinder übersichtlich und durchschaubar. Nach behördlichen Vorgaben gibt es zwischen italienisch und deutsch sprechenden Kindern allerdings kaum Berührungspunkte.
Zahlreiche vielbeachtete Neubauten haben die Südtiroler Architekturszene in den vergangenen Jahren in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Als eine der Ursachen hierfür gilt die Etablierung eines offenen Wettbewerbswesens, das nicht nur zu anspruchsvollen Resultaten, sondern auch zu einer belebenden Internationalisierung geführt hat. Im Vergleich zu dieser Weltoffenheit wirken die politischen Strukturen in der »Autonomen Provinz Bozen« relativ antiquiert. Noch immer gibt es unüberwindbare Barrieren und Konflikte zwischen italienischen und deutschen bzw. ladinischen Sprachgruppen. Und noch immer fordern Splitterparteien politische Unabhängigkeit und »Freiheit für Südtirol«.
Nun lässt sich dieses Konfliktpotenzial keineswegs mit jenem von Nordirland oder dem Baskenland vergleichen, bei näherer Betrachtung ist die Trennung von italienischen und deutschen Strukturen im Alltag dennoch deutlich sichtbar. Vor allem, wenn es um das Bildungswesen geht. Schulen wie auch Kindergärten sind nämlich nicht nur organisatorisch und räumlich, sondern in den allermeisten Fällen auch baulich strikt voneinander getrennt. Eine Ausnahme bildet der im Herbst 2007 eröffnete städtische Kindergarten »Rosslauf« in Brixen. Anders als in weiteren elf deutsch- und zwei italienischsprachigen städtischen Einrichtungen gibt es dort Kindergartengruppen beider Sprachen.
Geplant wurde der Kindergarten vom Stuttgarter Architekten Thomas Keller mit seinem damaligen Büro Peters + Keller auf der Grundlage eines im Jahr 2000 gewonnenen Wettbewerbs, der zugleich auch den Bau eines pädagogischen Gymnasiums vorsah. Als städtebauliches Ensemble befinden sich beide Gebäude in einem heterogenen Wohngebiet im Norden der mit rund 20 000 Einwohnern nach Bozen und Meran drittgrößten Stadt Südtirols. Der dreigeschossige Baukörper des Schulhauses orientiert sich dabei U-förmig mit einer Art Ehrenhof zum nördlich anschließenden Kindergarten mit einer italienischen und drei deutschsprachigen Gruppen mit jeweils 25 Kindern. Bei beiden Gebäuden handelt es sich um sehr übersichtliche und klar strukturierte orthogonale Stahlbetonbauten, die sich am deutlichsten in der Ausbildung der vorgehängten Gebäudehüllen unterscheiden. Während die Schule mit ihrer eher kühlen Aluminiumfassade gestalterisch an Universitätsbauten erinnert, präsentiert sich der Kindergarten von allen Seiten in den warmen Farbtönen unbehandelter Lärchenholzlamellen.
Italienische und deutsche »Sektion«
Von außen erscheint der zweigeschossige Kindergarten mit seinen fünf, nach Süden kammartig gereihten »Einzelhäusern« als abgeschlossene in sich ruhende Einheit. Dieser Eindruck bestätigt sich beim Blick auf die Grundrissorganisation, die im Wesentlichen durch drei langgestreckte Raumschichten charakterisiert wird: eine nördliche Spange mit Nebenräumen (Technik, Diensträume, Küche, Aufzug), großzügige, über Treppen an beiden Enden verknüpfte Spielflure sowie vier identische Gruppenräume nebst zweigeschossigem Mehrzweckraum im Erdgeschoss bzw. vier etwas kleinere, ebenfalls identische Ruhe- und Bewegungsräume im Obergeschoss. Nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist die vertikale Trennung zwischen italienischem und deutschem Bereich. So befinden sich Gruppen- und Diensträume – wie auch der separate Eingang – der »italienischen Sektion« (Scuola Infanzia Rosslauf) ausschließlich im Einzelhaus am äußersten westlichen Rand des Kindergartens. Alle anderen Flächen zählen zur »deutschen Sektion«. Gemeinsam bespielt werden Mehrzweckraum, Küche, Haustechnik, Garten und die Dachterrasse über der nördlichen Nebenraumspange. Damit entspricht der Kindergarten den Vorgaben des Wettbewerbsprogramms, das nach einer vollständigen räumlichen Trennung der beiden Sprachbereiche verlangte. Um dieser Forderung zu genügen ohne den Kindergarten auf unsinnige Weise zu zerschneiden, beinhaltete das Entwurfskonzept von Thomas Keller – letztlich nicht ausgeführte – Glastrennwände im unteren und oberen Flur.
Pädagogisches Konzept
Nachdem Jacken und Straßenschuhe an den Garderobennischen in den kurzen Stichfluren zum Garten abgelegt wurden, beginnt der Kindergartentag der deutschen Kindergartensektion gegen acht Uhr mit einer zweistündigen Freispielzeit. Das pädagogische Konzept basiert dabei auf einem »offenen System«. Das heißt die Kinder zwischen drei und sechs Jahren sind zwar im Prinzip einem festen Gruppenraum zugeordnet, in dem beispielsweise gemeinsam zu Mittag gegessen wird. Die meiste Zeit können sie jedoch selbst bestimmen, in welchen Räumen sie sich aufhalten und welcher Aktivität der zehn Erzieherinnen sie folgen möchten. Neben dem Mehrzweckraum und den drei Gruppenräumen, die in der Freispielzeit als Kreativraum, Spielzimmer bzw. Bauraum fungieren, stehen hierzu ein Montessoriraum, eine Kinderwohnung mit maßstäblich verkleinerter Küche sowie ein Ruheraum im Obergeschoss zur Verfügung. Nach der Freispielzeit teilen sich die Kinder in Kleingruppen auf, um für kurze Zeit an konzentrierten Programmen teilzunehmen. In regelmäßigen Abständen werden dabei immer wieder neue pädagogische Konzepte von Studenten der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen erprobt, für die die Einrichtung als Praxiskindergarten fungiert. Vor und nach dem gemeinsamen Mittagessen haben die Kinder schließlich die Gelegenheit, auf der Dachterrasse oder im Garten zu spielen.
Dreidimensionaler Hintergrund für die Kreativität der Kinder
Die Gruppenräume sind als neutrale Funktionseinheiten mit unmittelbar angeschlossenen Sanitärräumen angelegt und werden als dreidimensionaler Hintergrund für die Kreativität der Kinder verstanden. Deren ebenso einfache wie kostengünstige Ausführung mit Linoleumböden bzw. weiß gestrichenen Wänden und Decken hat sich im Alltag durchaus als geeignet erwiesen (aus Kostengründen wurde die analog zur Außenfassade geplante Verkleidung aller Oberflächen mit Lamellenparkett gestrichen). Erstens, weil sämtliches, gerade nicht benötigtes Spielmaterial in den direkt zugeordneten Abstellräumen verstaut werden kann, Boden und Wände also tatsächlich voll und ganz im Fokus der jeweiligen Aktivitäten stehen. Zweitens, weil die Räume durch unterschiedliche Raumhöhen und eine ausgezeichnete natürliche Belichtung reichlich Entfaltungsmöglichkeiten und Anregungen bieten, ohne sich selbst in manierierter Verspieltheit in Szene setzen zu müssen.
Beim Blick in den Bereich unmittelbar vor der sechs Meter hohen Südfassade wirft die Zweigeschossigkeit dennoch Fragen auf. Schließlich sind akustische Bezüge zu den Ruhe- und Bewegungsräumen im Obergeschoss (deren Ausstattung exakt jener der Gruppenräume entspricht) ausdrücklich unerwünscht. Zusätzlich zur Außenfassade wurde dadurch ein weiterer Raumabschluss notwendig, der als rahmenlose Festverglasung ausgeführt wurde und damit zwar zur Belichtung, nicht aber zum direkten Kontakt in den Gruppen- bzw. Außenraum oder zur Belüftung geeignet ist. Die Frischluftzufuhr erfolgt über Oberlichter und – wie auch im Erdgeschoss – über jeweils zwei seitliche Lüftungstüren, die den Kindern einen unerwarteten Einblick in die Holzlamellenfassade geben und zur nächtlichen Auskühlung auch geöffnet bleiben könnten. Von dieser Möglichkeit musste bisher allerdings kaum Gebrauch gemacht werden, weil der Dachüberstand und die vollflächige Verschattungsmöglichkeit durch Jalousien eine sommerliche Überhitzung erfolgreich verhindern. Die passive Solarnutzung führt überdies zu niedrigen Wärmeenergieverbräuchen, die mit dem Anschluss an ein Fernwärmenetz gedeckt werden.
Bauliche Integration
Die klare Grundrissstruktur und die zurückhaltende, aber gestalterisch präzise Ausformulierung von Flächen, Kubaturen mit nur wenigen verschiedenen Materialien führen zu einem übersichtlichen und von Kleinkindern schnell durchschaubaren Bauwerk, das sich zudem über die durch zwei Treppen verknüpften Flure sowie zahlreiche Zugänge zu Dachterrasse und Garten als bereitwilliger Rahmen aller denkbaren Aktivitäten präsentiert. Allerdings gilt dies nur für den Bereich der »deutschen Sektion«. Für die Kinder der »italienischen Sektion« sieht der Kindergartenalltag weitaus weniger anregend aus, weil die beiden Bereiche tatsächlich strikt getrennt betrieben werden und es eigenartigerweise keinerlei integrative Ansätze oder Durchmischungen der Gruppen gibt. Wie im Wettbewerbsprogramm gefordert, hat Thomas Kellers Entwurf diesen getrennten Betrieb möglich gemacht. Allerdings hat er sich nicht darauf eingelassen, dies auch noch baulich sichtbar zumachen. Im Gegenteil. Seine vereinheitlichende Form hat zu einer visuellen Zusammengehörigkeit der Sektionen geführt, die angesichts der absurden Separierung ein integriertes Konzept für beide Sprachgruppen geradezu herausfordert. Die Chancen für ein Umdenken der hierfür verantwortlichen Behörden stehen gut. Schließlich finden Projekte wie die während der langen Sommerferien angebotenen zweisprachigen »Sommerkindergärten« bei der Bevölkerung großen Zuspruch.db, Mi., 2009.09.09
09. September 2009 Roland Pawlitschko
Das grosse vier mal eins
(SUBTITLE) Schulkindergarten in Buchen/Odenwald
Bauzeit und Baukosten sind für die Auftraggeber von Kindergärten oft wesentliche Vergabekriterien – so auch bei dem Schulkindergarten »Pusteblume« für fünf Kleingruppen körper- und sprachbehinderter Kinder im Neckar-Odenwald-Kreis. Ein klug geplanter Holzsystembau setzte sich hier gegen eine schnöde Container- Lösung durch: Für lediglich 223 Euro/m³ in acht Monaten errichtet, bietet der Bau den Kindern nachvollziehbar gefügte Architektur und behagliche Räume.
So zeigte sich der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises denn auch einsichtig, als die Architektin Dea Ecker gegen seinen Plan protestierte, den dringend benötigten Schulkindergarten in Containern unterzubringen. Doch mehr kosten dürfe die Alternative freilich nicht. Buchstäblich über Nacht entwickelte das junge Büro den Gegenvorschlag – und überzeugte den zuständigen Ausschuss.
Vier identische Einheiten
Auf einem ehemaligen Sportgelände im Süden der Stadt, umgeben von banalen Schul- und Gewerbebauten, planten die Architekten den Kindergarten-Neubau. Die Pädagogen der bereits bestehenden Einrichtung, die bis dahin völlig unzureichend im dritten Stock eines Altbaus untergebracht war, unterstützten sie dabei. – Die Lehrkräfte fördern ungefähr 40 körperlich, geistig oder sehbehinderte Kinder im Alter von drei bis acht Jahren in fünf Gruppen. Vormittags schulen die speziell ausgebildeten Lehrer vorwiegend die Wahrnehmung der Kinder, nachmittags gehen sie meist ins Freie, um die motorischen Fähigkeiten zu entwickeln oder einfach die Möglichkeit zum »Luft ablassen« zu bieten. Ziel der Einrichtung ist es, die zum Teil auch nur entwicklungsverzögerten Kinder auf den Schulalltag vorzubereiten, sie »schulreif« zu machen.
Der Name »Pusteblume«, auf den der Schulkindergarten getauft wurde, soll diese »Hilfe zur Selbsthilfe« zum Ausdruck bringen. Barrierefreiheit, einfache Orientierung, Bezug zum Freiraum waren daher wichtige Aspekte des Entwurfs. Die Architekten fügten den eingeschossigen Baukörper aus vier identischen, im Werk weitgehend vorgefertigten, annähernd quaderförmigen Holzrahmenbau-Modulen zusammen (die Dachneigung beträgt drei Grad), die sich um einen quadratischen Innenhof gruppieren. Dieser überdachte Hof übernimmt die Funktion als Verteiler der Erschließung, als Treffpunkt, Turnraum und Aula. In der Form von Windmühlenflügeln führen von diesem »Marktplatz« die Flure respektive »Gassen« zu den einzelnen Gruppenräumen.
Die drei nach Osten, Westen und Süden orientierten Module enthalten jeweils zwei etwa quadratische Gruppenräume (zwei Achsen der Konstruktion) und einen kleineren Therapieraum (eine Achse); der nördliche, zum Eingang gewandte Baustein dient als Lehrerzimmer und Sekretariat; hier sind auch die Küche, die Toiletten und ein Wickelraum untergebracht. Um die Orientierung zu erleichtern, sind die Linoleum-Fußböden und die Einbaumöbel jedes Moduls in einer eigenen Leitfarbe gehalten.
Orientierung via Sonnenstand
Vor allem aber soll die Gestaltung des zentralen Raums Orientierung bieten. Mächtige, 60 cm hohe Unterzüge überspannen den quadratischen Zentralraum und teilen die Decke in vier kleinere Quadrate. Über jedem dieser Quadrate erhebt sich ein 45 Grad spitzer, fünf Meter hoher Pultdachkörper mit großen Fenstern, »Zipfelmützen« genannt. Jede der senkrechten Fensteröffnungen weist in eine andere Himmelsrichtung, und jeder Dachraum ist in einer anderen Farbe gehalten: Hellgrün gen Osten, Pink gen Süden, Rot gen Westen und Dunkelgrün gen Norden. Je nach Tageszeit taucht diese Konstruktion den Raum also in unterschiedliches Licht – der Morgen leuchtet hellgrün, der Mittag pink, später dominiert das Abend-Rot. Reicht das Sonnenlicht nicht aus, hilft elektrisches Flutlicht nach. Ähnliche »Lichtduschen« baute Le Corbusier im Kloster La Tourette ein (Architektin Dea Ecker, die selbst eine Tochter im Kindergartenalter hat, nennt ihre Konstruktion »Lichtampel«). Die Nuancen der Farbgebung, die Kombination ähnlicher und komplementärer Farben, verweist auf Josef Albers' Farb- studien, die zeigten, wie benachbarte Farbtöne die Wirkung von Farb- flächen beeinflussen.
Gleichwohl »zerfällt« der symmetrisch angelegte Zentralraum durch die Farbgebung etwas, er scheint aus der Balance zu geraten. Auch wirkt er konstruktionsbedingt mit rund drei Metern etwas zu niedrig in Relation zu seiner großen Fläche, jedenfalls für Erwachsene.
Kamineffekt ersetzt Lüftungsanlage
Die »Zipfelmützen«, die das Flachdach um rund fünf Meter überragen, dienen indes nicht nur als Lichtquelle, sie sind auch das Markenzeichen des Schulkindergartens im Stadtraum. Schon von Weitem sieht man die in golden eloxiertes Aluminiumblech gekleideten Dächer aus der Bebauung aufragen, und im Dunkeln verstrahlen die Farbflächen ein intensives Leuchten, das sicher auch den Kindern ein Gefühl von »zweiter Heimat« vermittelt, wenn sie in der Frühe mit Bussen aus dem ganzen Landkreis herbeikutschiert werden. Unbeteiligte mögen bei dem Anblick sogar sakrale Assoziationen hegen.
Im Low Budget-Projekt erfüllen die spitzen Mützen noch einen anderen Zweck: Sie ersetzen die Lüftungsanlage. Dank Kamin-Effekt steigt die warme Luft im Zentralraum auf und entweicht über regelbare Lüftungsklappen an der Spitze der Pultdächer. Über Lüftungsöffnungen an den Fassaden strömt Außenluft nach und sorgt auch im Hochsommer für eine angenehme Temperierung der Räume. Man kennt ähnliche Konstruktionen als Windturm aus heißen Ländern. Die ursprünglich eingeplante und auch in der Konstruktion vorbereitete Lüftungsanlage konnte auf diese Weise eingespart werden.
Die 2,50 m breiten Dachkrempen der Module über den Pfosten-Riegel-Fassaden bieten nicht nur den Kindern geschützte zusätzliche Spielräume, sie verhindern auch den direkten Sonnenlichteinfall im Sommer (ein zusätzlicher Sonnenschutz aus dunkler Gewebeplane wurde allerdings nachgerüstet); winters erlaubt die Konstruktion aber passiven Zugewinn an Energie. Der Heizwärmebedarf, der von einer Gastherme über Fußbodenheizung und zusätzliche Radiatoren gedeckt wird, liegt bei etwa 60 kWh/(m²a).
Nachvollziehbare Fügung der Bauteile
Das Gebäude verleugnet nirgends seine rationelle Entstehung. Die vier Module sind von außen deutlich ablesbar. Eine weiße Stülpschalung überzieht die Schmalseiten, während die schwarze Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium die gesamte äußere Breitseite überzieht. Zum Zentralraum hin bringen Oberlichtbänder etwas zusätzliches Licht in die Gruppenräume.
Die im Achsabstand von 3 m verlaufenden Dachbinder aus Brettschichtholz bestimmen die Raumgrößen und -höhen in den Modulen: Es gibt nur ein- oder zweiachsige Räume, die kleinen Therapie- und die Nebenräume wirken in der Proportion zu hoch.
Die Stützen wie die Untersicht der Binder bleiben im Innenraum sichtbar; dazwischen sind Holzwerkstoffplatten als Akustikpaneele eingebaut. Die über gut sieben Meter spannenden Träger sind 36 cm hoch, was zu einer sehr breiten Ortgang- bzw. Attika-Ansicht der Dachkonstruktion führt. Auf den Breitseiten mit dem großen Dachüberstand wirkt die optische Schwere des Dachs auch nicht elegant, durch die zweiteilige Randblende aber immerhin erträglich. Wo die Module aneinanderstoßen, liegen die Entwässerungsrinnen, die sichtbar vor der Fassade in Fallrohre münden.
Auch die Kinder können auf diese Weise wohl schon nachvollziehen, wie ihr Haus zusammengefügt ist und funktioniert. Zur großen, aber haptisch begreifbaren Konstruktion gesellen sich Einbauten in ihrem Maßstab, etwa die Bänke vor der Fensterwand der Gruppenräume. Höhlen und Spielhäuser passen locker in die Ecken, das ganze Haus zeugt nach zweieinhalb Jahren von intensiver Benutzung, was sowohl die Konstruktion als auch die maßgeschneiderten Einbauten gut ausgehalten haben.
Große und kleine Nutzer schätzen insbesondere den einprägsamen, vielseitig nutzbaren Zentralraum. Als zum Sommerfest in diesem Jahr schlechtes Wetter angekündigt war, blieben alle ganz entspannt: Dann würde man eben nicht im Freien, sondern hier drinnen feiern!
Der Erfolg ihrer Anlage lässt die Architekten dann auch über eine Weiterentwicklung nachdenken. Das Konzept wie die robuste Konstruktion würden sich durchaus auch für Schulbauten eignen. Um den in immer mehr Kommunen verlangten Passivhausstandard zu erfüllen, sind allerdings einige Änderungen notwendig. Im badischen Rheinstetten planen die Architekten derzeit im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung einen Kindergarten dieser Art.db, Mi., 2009.09.09
09. September 2009 Christoph Gunßer
Krabbelstube
(SUBTITLE) Kindergarten in Sighartstein/Neumarkt
Als riesige Grasnarbe taucht der Kindergarten inmitten von Wiesen, Feldern und lockerer Bebauung auf. Doch er ist nicht nur äußerlich grün. Die Farbe steht zudem für eine ökologische und pädagogisch-liberale Geisteshaltung. In enger Abstimmumg mit den Pädagogen entwarfen die Architekten ein offenes Haus, in dem sich die Kinder erfreulich frei bewegen und entfalten können.
Sighartstein, irgendwo im Flachgau, irgendwo im Norden der Mozartstadt Salzburg. Die Fahrt führt zwischen schmucken, bunt verputzten Häusern am Hauptplatz vorbei, dreimal um die Ecke, den Hügel hinauf bis zum Ende der Straße, und plötzlich steht sie da, die grau verputzte Kiste (Stahlbeton-Bauweise mit Wärmedämmverbundsystem) mit ihrem unverwechselbaren Fassadenkleid aus stilisierten, saftig grünen Grashalmen. Harmonisch und gut getarnt fügt sich der Baukörper in die Landschaft. Je nach Blickwinkel muss man das Haus aus dem sommerlichen Bild, das sich hier bietet, regelrecht »herauslocken«. Die kleinen Menschen, die mit Sandschaufel und Eimer gewappnet regelmäßig durch die Glasfassade hindurch diffundieren, helfen einem dabei: Wo ein Kind, da auch ein Kindergarten.
Wie selbstverständlich wird man an der Rückseite des Hauses entlang des vollflächig verglasten Turn- und Bewegungsraums, wo die Kinder sich ihre Nasen an der Fensterscheibe plattdrücken und Handabdrücke hinterlassen, zum Eingang geleitet. Es ist der erste Einblick in das, was die Architekten einen Bewegungskindergarten getauft haben.
An der Eingangstür angelangt ist das Geschrei der Kinder dem freundlichen Lächeln der Leiterin gewichen. Daniela Rogl sitzt an ihrem Schreibtisch und blickt den ankommenden Besuchern entgegen. »Das war von Anfang an mein Wunsch«, sagt sie, »im Grunde genommen habe ich ein Corner Office; ich sehe auf der einen Seite die Leute, die ins Gebäude eintreten, und auf der anderen die Kinder im Garten. Da hat man alles im Überblick.« Und was meint sie zu der kräftig grünen Farbigkeit? »Mit dem Grün hatten wir am Anfang schon unsere Probleme, aber mittlerweile haben wir uns alle an die Farbe gewöhnt. Ich finde sie, ehrlich gestanden, richtig gut!« Man glaubt es ihr aufs Wort: Grüne Bluse, grüne Weste, grüner Schlüsselanhänger auf dem Tisch.
Die Farbgebung des Kindergartens ist Programm. Und das, ohne jemals ins Kitschige oder Kindische abzudriften. Denn statt aus dem entbehrlichen Fundus an ohnehin schon tausendfach bedienten Klischees zu schöpfen, haben sich die Architekten einzig und allein von der Umgebung inspirieren lassen. »Kindergarten hin oder her, wir hätten wahrscheinlich auch bei einem anderen Funktionsspektrum zu dieser Farbe gegriffen«, erklärt Kerstin Tulke, Projektleiterin im Aachener Büro kadawittfeldarchitektur, das 2003 den international ausgeschriebenen Wettbewerb gewann. »Rund um Salzburg wächst das Gras einfach grüner. Wenn man sich auch nur ein bisschen auf die Umgebung einlässt, dann wird man unweigerlich die bestehenden Motive aufgreifen und ins architektonische Konzept einfließen lassen.«
Nach Betreten des Kindergartens geht es links zu den einzelnen Gruppenräumen mit angeschlossenem Garderoben- und Sanitärbereich; um die Ecke rechts pulsiert das monochrome, apfelgrüne Herz des Hauses, der zweigeschossige Bewegungsraum. Auf rund 70 m² können sich die Kinder hier austoben und ihrem ureigentlichen Drang nach Bewegung folgen. Die freundliche Farbe animiert dazu. An der Decke sind Metallösen angebracht, an denen sich mit einem Handgriff Seile, Strickleitern und Schaukeln befestigen lassen. Der Kautschukboden ist weich und lindert gegebenenfalls den Aufprall. ›
Aggressionspegel gesunken
»Der Bewegungsraum ist das absolute Highlight dieses Gebäudes«, sagt die Kindergartenleiterin. Einerseits werde das Angebot sehr gut genutzt, weil sich die Kinder hier gerne aufhalten. Andererseits diene die alltägliche Bewegung, die nun nicht mehr von Garten und Witterung abhängig ist, nicht zuletzt als psychologischer und sozialer Katalysator. »Seitdem wir diesen Kindergarten besiedelt haben, ist der Aggressionspegel unter den Kindern deutlich gefallen. Das können sowohl Eltern als auch Erzieherinnen bestätigen.« Einziger Nachteil: Es ist ziemlich laut. Daran können auch der weiche Boden und die Akustikdecke nichts ändern.
Aufgrund der knappen Platzverhältnisse (Gesamtnutzfläche 830 m²) war es nötig, den Bewegungsraum mehrfach zu nutzen und ihn mit anderen Funktionen zu überlagern. So gibt der rundum grün gefasste Saal beispielsweise auch für Geburtstage, Weihnachtsfeiern und ähnliches einen perfekten Rahmen ab. Die kreisrunden Oberlichter in der Decke und die kugelförmigen Beleuchtungskörper, die in unterschiedlicher Höhe in den Raum hinab baumeln, unterstreichen den festlichen und doch leicht verspielten Charakter.
Auf der anschließenden Tribüne, die für 100 bis maximal 150 Besucher angelegt ist, können Eltern und Verwandte Platz nehmen und den kleinen Schauspielern auf der Bühne zusehen. Außerdem dient die grüne Zone als Vertikalerschließung. Neben den aufsteigenden Sitzbänken führt eine einläufige Treppe nach oben. Während die etwas älteren Kinder aufgrund der Nähe zum Garten ebenerdig untergebracht sind, halten sich die Allerjüngsten, in ihrer Mobilität noch nicht ganz sattelfest, im Obergeschoss auf. Zwei Krabbelgruppen gibt es derzeit. Optional kann ein etwas kleinerer Ruheraum zu einem dritten Gruppenraum umfunktioniert werden.
Auffällig ist nicht nur die klare und überaus funktionale Anordnung der unterschiedlichen Bereiche, sondern auch die Offenheit im ganzen Haus. »Natürlich haben wir uns eine gewisse Trennung und Zonierung gewünscht, anders lässt sich ein Kindergartenbetrieb ja auch nicht in den Griff kriegen«, erklärt Rogl, »soweit es der tägliche Betrieb jedoch ermöglicht, verstehen wir uns als offenes und barriereloses Haus, in dem sich die Kinder frei bewegen können. Die Architektur unterstützt diese Qualität.«
Offenheit, Transparenz und Autonomie
Die einzelnen Gruppenräume, denen jeweils unterschiedliche Funktionen zugewiesen wurden, sind durch Glastüren miteinander verbunden. Hier ein Kreativraum, da ein Spiel- und Übungsraum, dort ein etwas stillerer Lern- und Leseraum. Eindeutige Zugehörigkeiten von Gruppen und Räumen gibt es nicht, denn jeder hält sich dort auf, wo es ihm gefällt. Das pädagogische Konzept, das in enger Zusammenarbeit zwischen Architekten und Nutzern entstanden ist, geht davon aus, dass vier- und fünfjährige Kinder durchaus in der Lage sind, selbstständig über die eigenen Bedürfnisse zu reflektieren und zu entscheiden. Und das ist löblich.
Je nach Lust und Laune können die Kinder also ungehindert von einem Bereich in den anderen hinüberwechseln. Damit im Augenblick der überschwänglichen Spielfreude nicht der eine oder andere kleine oder große Mensch gegen die Glastür knallt, ist in Augenhöhe (in allen Augenhöhen wohlgemerkt) eine Folierung aus stilisierten Grashalmen angebracht. Auf die Frage hin, ob das Grasmotiv nicht etwas überstrapaziert wird, antwortet die Projektleiterin: »Nein, das sehen wir nicht so. Wir haben uns ganz klar für ein einziges Motiv entschieden. Und dieses taucht von der Fassade bis zu den grün bedruckten Toilettentüren konsequent immer wieder auf. Nicht mehr und nicht weniger.«
Am auffälligsten ist die Fassadengestaltung im Obergeschoss. In einem Abstand von 20 cm vor der thermischen Außenhülle flimmert ein kreuz und quer zueinander gefügtes Stabwerk aus unterschiedlich dimensionierten Aluminiumhohlprofilen. Das ist die neu interpretierte, üppig grüne Flora Österreichs, wie Klaus Kada und Gerhard Wittfeld sich ausdrücken. Es ist aber auch ein Hinweis auf das in Anbetracht der Baukosten durchaus ambitionierte Haustechnikkonzept, das völlig unscheinbar im Hintergrund bleibt: Niedrigenergie-Bauweise, Brennwertkessel mit Fußbodenheizung und Sonnenkollektoren auf dem Dach. Wichtig zu erkennen, dass das eingesetzte Grün an diesem Haus nicht nur Farbe ist, sondern auch Ausdruck einer ökologischen und pädagogisch-liberalen Geisteshaltung.
Doch wie gefällt den Kindern der neue Kindergarten? »Gut.« Und was gefällt ihnen am besten? »Grün.«db, Mi., 2009.09.09
09. September 2009 Wojciech Czaja