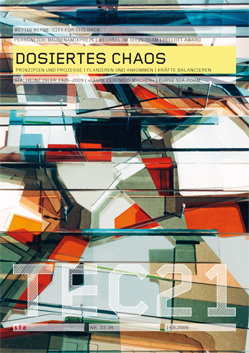Editorial
Chaos – das ist ein deutlich negativ besetzter Begriff. Aus dem Lebens- und Berufsalltag wollen wir es am liebsten verbannen, alles soll möglichst rational, plan- und vorhersehbar sein. Selten werden die Chancen erkannt, die im Chaos liegen können.
Diese TEC21-Ausgabe wird sich nicht mit den theoretischen und mathematischen Definitionen befassen. Ausgangspunkt ist das alltägliche Chaos – eine Art von Unordnung, die hauptsächlich im Auge des Betrachters liegt, wenn Abläufe und Erscheinungsbilder nicht mehr so sind wie gewohnt. Drei Beispiele aus unterschiedlichen Fachbereichen zeigen praktische und erfolgreiche Anwendungen für dosiert eingesetzte chaotische Elemente. Allen gemeinsam ist: Die Chancen liegen in der intelligenten Mischung.
Beim Beispiel der Wiener Siedlung Kabelwerk wagten die Verantwortlichen in der Planungsphase eine Abkehr von der üblichen Praxis (siehe «Prinzipien diskutieren, Prozesse herausfordern»). Statt einen strikten Bebauungsplan vorzugeben, blieben Planern, Stadt, Investoren und künftigen Nutzern Freiräume, um die Quartiersgestaltung gemeinsam auszuhandeln. Nach ein paar Jahren ist das Chaos nun fast aus der Siedlung verschwunden. Heute profitiert das Projekt von einem für ein Neubaugebiet ungewöhnlich aktiven sozialen Leben. Vielleicht weil es das natürlichste der Welt ist, dass Menschen, die zusammen wohnen und arbeiten, sich vorher gemeinsam überlegen, wie das am besten zu organisieren ist.
Im Strassenverkehr erzeugen Begegnungszonen durch die Aufhebung der gewohnten Trennung der Verkehrsarten und weniger Regelungen bei manchem Benutzer etwas Verwirrung. Dass bei intelligenter Anwendung sogar nach Fahrplan verkehrende Busse erfolgreich in das chaotische System eingebunden werden, erläutert der Artikel «Flanieren und Ankommen».
Auch in der Tragwerksplanung kann das Prinzip Chaos zu überzeugenden Lösungen führen. Die Architekten der Volière in Genf hatten einen Stützenwald ohne Wandscheiben oder regelmässige Auskreuzungen vorgesehen. In einer aussergewöhnlichen Zusammenarbeit konnten Ingenieure und Architekten das gewünschte chaotische Erscheinungsbild in ein funktionierendes Tragwerk übersetzen. Filigran wie ein Mikadospiel erscheint das Stahltragwerk aus schrägen Baumstützen. Genau daraus aber entsteht ein ausgeklügeltes Gleichgewicht, das alle Kräfte in der Konstruktion aufnehmen kann (vgl. «Kräfte balancieren»).
Dosiert eingesetzt kann Chaos bewirken, dass eingefahrene Gewohnheiten hinterfragt und Verantwortungen übertragen werden. Am Ende können interessante, neue Strukturen dabei herauskommen.
Alexander Felix
Inhalt
05 WETTBEWERBE
City for Children
12 PERSÖNLICH
Baudynamikpreis an Markus Baumann | Wechsel im Team von TEC21 | Auszeichnungen | Yellott Award für Aldo Steinfeld
16 MAGAZIN
Nationale Umsetzung von CEN-Normen | Bücher | Plattform für CKW-Altlasten
22 PRINZIPIEN DISKUTIEREN, PROZESSE HERAUSFORDERN
Christian Holl
Architektur: Der Entwurf für die Umnutzung der alten Kabelwerke in Wien vermied einen Vorschlag für die Neubebauung, definierte den Freiraum und gab den Bauherren und den Bewohnern viel Spielraum für die Ausgestaltung.
28 FLANIEREN UND ANKOMMEN
Hans-Georg Bächtold
Verkehrsplanung: Wo die Regelungsdichte im Verkehr abgebaut wird, begegnen sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt – bei intelligenter Platzierung mit Vorteil für alle.
31 KRÄFTE BALANCIEREN
Gabriele Guscetti
Tragwerksplanung: Hinter dem formal chaotischen Stützenwald, der die Volière in Genf trägt, steckt viel Planung, um die Freiheit in der Gestaltung zu erhalten
39 SIA
Heinz Isler 1926–2009 | «Leute lebendig machen» | Kurse SIA-Form
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Prinzipien diskutieren, Prozesse herausfordern
Der Siegerentwurf im städtebaulichen Wettbewerb für das Kabelwerkareal im Südwesten Wiens liess nicht erkennen, wie das bebaute Gebiet aussehen würde. Strukturgebend war die Planung der Freiräume, die gewisse formale Freiheiten bei der Bebauung ermöglichte. Der Plan war eine Herausforderung, sich einem Prozess mit nicht vorhersehbarem Ergebnis und der Auseinandersetzung zu stellen. Die Verantwortlichen sind das Risiko eingegangen, aus dem Chaos der Unübersichtlichkeit Strukturen entstehen zu lassen.
Im Dezember 1997 wurde die Produktion in der Kabel- und Drahtwerke AG in Meidling, dem 12. Wiener Gemeindebezirk, eingestellt. Kurz danach erwarb eine Eigentümergemeinschaft aus acht Bauträgern das Areal, und Ende November 1998 war bereits der städtebauliche Ideenwettbewerb für ein gemischt genutztes Quartier entschieden. Gewonnen hatte ihn die Arbeitsgemeinschaft dyn@mosphäre (Rainer Pirker Architexture Team und The Poor Boys Enterprise). Aus Bebauungsregeln, Haustypen, Wegeverbindungen und kontextuellen Bezügen hatten sie in einem strategischen Konzept eine Ordnungsstruktur entwickelt, ohne vorzuschlagen, wie die Bebauung tatsächlich auszusehen habe. Diese sollte sich in einem Prozess entwickeln dürfen, in dem durch Bürgerbeteiligung, Aushandlungen über Form und Nutzung erst das ganze Potenzial des Gebiets auf sozialer, räumlicher und kultureller Ebene entdeckt würde. Die Ausschreibung hatte dafür bereits den Weg gewiesen, hatte sie doch explizit den konzeptionellen Ansatz, instrumentelle Vorschläge und Prozesshaftigkeit gefordert.
Chaos als Strategie
Das Siegerprojekt entsprach den Hoffnungen, die man in diese Ausschreibung gesetzt hatte. Chaos wird zum einen im Bild und in der Darstellung erzeugt, um die Offenheit, deren es für einen echten Beteiligungs- und Verhandlungsprozess bedarf, herauszufordern: Keine Vorstellung davon, wie das Gebiet aussehen wird, sollte der Entwicklung der künftigen Form im Wege stehen und Diskussionen determinieren oder dominieren. Festgelegt wurden Freiräume, Attraktivitätszentren, Blickrichtungen, Ordnungslinien – die bebaubare Fläche bleibt dabei grösser als die, die insgesamt bebaut werden darf. Chaos ist aber auch als Konzept angelegt; denn nicht nur das Planbild weigert sich, eine Form preiszugeben, die erst gefunden werden muss. Auch übliche Planungsfestlegungen wurden infrage gestellt. Konkrete, flächendeckende Nutzungsfestlegungen fehlen, statt dessen wird über vier Stufen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit auf spezifische Bedürfnisse der Bevölkerung nach Gemeinschaftsräumen, erweitertem Wohnraum, flexibler Nutzung des Raums reagiert. Die Entwurfsverfasser führen die Variabilität im Umgang mit den damit verbundenen Festlegungen als neues Element planerischer Strategie ein. Flexibilität, Förderung und Ermutigung zu Aktivitäten, Aktivierung der Bevölkerung und kleinteilige Planungsfelder sollten helfen, ein Stück Stadt entstehen zu lassen, damit es nicht erst Jahre braucht, um nicht mehr als Fremdkörper in der Umgebung wahrgenommen zu werden.
Elf Jahre später ist das mehr als acht Hektar grosse Gelände fast vollständig neu bebaut. Mehr als 950 Wohnungen wurden hier seit 2004 errichtet, dazu sind etwa 30 % der Fläche gewerblich und kulturell genutzt. Breit variiert das Angebot an Wohnungsgrössen und -typen sowie an Rechtsformen, es reicht von Eigentumswohnungen bis zu studentischem Wohnen und temporär vermietbaren Appartements. Hinzu kommen Arztpraxen, Büros und Geschäfte sowie ein Kulturzentrum und ein Kindergarten in erhaltenen und umgebauten Fabrikbauten. Auf dem nach Süden hin abfallenden Gelände wurden Dichte und Gebäudehöhen gestaffelt, um jede Wohnung gut belichten zu können. Auf dem Dach eines Gebäudes im dichteren Norden steht den Kabelwerk-Bewohnern ein Schwimmbad zur Verfügung. Von hier aus hat man einen grandiosen Ausblick, unter anderem auf Alt-Erlaa, wo ebenfalls ein Schwimmbad auf dem Dach zum Erfolg der Anlage beiträgt. Die Ausnutzungsziffern steigen von 1.2 im Süden auf 3.9 im Norden des Areals an. Schade, dass von den alten Fabrikanlagen bis auf einen Rest am Westrand nur wenig erhalten blieb.
Arbeitsgruppen, Begleitung, Beteiligung
Mit dem Otto-Wagner-Städtebaupreis wurde das Kabelwerk-Projekt allerdings schon 2004 ausgezeichnet, als vom neuen Stadtteil vor Ort noch so gut wie nichts zu sehen war. Gewürdigt wurde ein aussergewöhnlicher, intensiver Planungsprozess, eingeleitet von einem bereits 1996 abgehaltenen Workshop und begleitet von einer regelmässigen Bevölkerungsbeteiligung. Für ein kooperatives Planungsverfahren hatte man eine Arbeitsgruppe aus Siegern des städtebaulichen Wettbewerbs, Vertretern des Magistrats und der Bauträger, Freiraumplanern sowie dem von den Bauträgern bestimmten Architekten gebildet, die in über zwanzig Sitzungen das Projekt konkretisierten und die einzelnen Bausteine aufeinander abstimmten. Unter anderem erarbeitete diese Gruppe Testentwürfe, um zu überprüfen, wie sich das Konzept des Wettbewerbssiegers umsetzen lässt. Eine städtebauliche Begleitgruppe diskutierte und korrigierte die von der Arbeitsgruppe erstellten Ergebnisse und gab Impulse für deren weitere Arbeit. Von Anfang an hatten Anwohner die Gelegenheit, den Planungsprozess zu verfolgen und zu beeinflussen.
Ein weiteres strategisches Instrument half, dem Kabelwerk schon während der Planungsphase ein positives Image in der Nachbarschaft, aber auch in der Stadt Wien zu verschaffen. Seit 1999 bis zum Baubeginn 2004 wurde das Areal sozial und kulturell zwischengenutzt. Die Kulturarbeit, in die insbesondere Kinder und Jugendliche einbezogen wurden, erleichterte der Bevölkerung den Zugang zum Areal, die nach und nach selbst Initiativen im Rahmen der Zwischennutzung entwickelte.
Freiräume statt architektonische Vorgaben
Dennoch würde man dem Kabelwerk-Modell nicht gerecht, wenn für die Bewertung nur der intensive und erfolgreiche kooperative Planungsprozess in den Mittelpunkt gestellt würde. Denn ein genauso wichtiger Beitrag ist der kreative Umgang mit dem planungsrechtlichen Instrumentarium und der städtebaulichen Konfiguration. Letztere wirkt auf dem Plan zunächst unübersichtlich, stellt sich vor Ort aber als selbstverständlich und angenehm in den Verhältnissen von Freiraum und Bebauung dar.
Der Planung liegt das Prinzip zugrunde, nicht das architektonische Objekt oder eine Bebauungsfigur, sondern den Freiraum zum strukturellen Gerüst der Siedlung zu machen und die Bebauung sich um diesen herum erst entwickeln zu lassen. Entsprechend waren die den Freiraum strukturierenden Sockelgeschosse festgelegt, die das formale wie das funktionale Grundgerüst bilden. In ihnen sind Wohnungen ausgeschlossen, dafür können Gewerbe-, Gemeinschaftsräume und Werkstätten errichtet werden.
Im Bebauungsplan wurden ausserdem Raumkanten definiert, um sicherzustellen, dass Platzräume wie gewünscht entstehen. Auch Bebauungshöhen und die maximale Kubatur wurden festgelegt; wie das Volumen aber auf dem Baufeld unterzubringen ist, war planungsrechtlich nicht ausgewiesen worden.
Ein «Schüttmodell» half im diskursiven Planungsprozess, die Bebauungsform zu finden. Die prinzipiell bebaubaren Flächen waren dabei mit offenen Plexiglaswaben in den jeweils zulässigen Höhen belegt. Entsprechend dem zulässigen Volumen für dieses Grundstück stand eine grünes Granulat zur Verfügung, mit dem man die Waben befüllen und unterschiedliche Verteilungen innerhalb des möglichen Volumens gegeneinander abwägen konnte. Auf diese Weise entstand eine Mischung aus öffentlichen, halböffentlichen und privaten Freiräumen, aus autofreien und geschützten Plätzen, aus übersichtlichen Verbindungen und intimen Gassen mit differenzierten Räumen und Stimmungen. Im Norden ist die Bebauung allerdings zu dicht geraten, private Freiräume sind hier unzureichend vor Einblicken geschützt. Der offene Prozess, die Bewältigung von anfänglicher Unübersichtlichkeit in intensiven Verfahren hat sich gelohnt. Zwar liess sich einiges, was die Wettbewerbssieger vorgeschlagen hatten, etwa die radikale Flexibilität der Nutzungsbausteine, nicht umsetzen. Doch vieles hat sich bemerkenswert gut bewährt, etwa die Regelung der Bonuskubatur: Etwa 20 % des Volumens durfte zusätzlich errichtet werden, wenn in ihm eine grössere Raumhöhe realisiert wurde und dadurch die Gemeinschaftsanlagen erweitert und die Erschliessungsflächen vergrössert wurden. Dadurch entstanden Räume mit einer Grosszügigkeit, die einem Quartier gut tun. Im Ganzen ist die Aneignung eines neuen Quartiers durch die Bewohnerinnen und Bewohner in einem verblüffenden Masse gelungen.TEC21, Fr., 2009.08.14
14. August 2009 Christian Holl
verknüpfte Bauwerke
Kabelwerk Wien
verknüpfte Ensembles
Kabelwerk
Flanieren und Ankommen
Verkehrsplaner propagieren eine geringe Regelungsdichte als Beitrag, um die Attraktivität von Siedlungen zu steigern. In Begegnungszonen haben FussgängerInnen Vortritt und dürfen den ganzen Strassenraum benutzen. Die Vertreter des öff entlichen Verkehrs reagieren jedoch ablehnend auf das «organisierte Chaos», da sie Zeitverlust und Kostenfolgen fürchten. Untersuchungen aus dem Kanton Basel-Stadt bilden die Grundlage für eine Diskussion – und zeigen, dass weitere Untersuchungen und Auswertungen nötig sind.
Lange dominierte der Verkehr das Ortsbild: Die negativen Auswirkungen der ausschliesslich nach technischen Überlegungen gebauten Verkehrsanlagen traten in Form von erschwerten Querungsmöglichkeiten, abnehmender Sicherheit, grösseren Zeitverlusten, zunehmender Lärm- und Luftbelastung und sinkender Umsätze in der Folge immer stärker zutage. Diesen «Verkehrsproblemen» wurde oft mit einem Ausbau der bestehenden Anlagen begegnet. Heute stehen als wirkungsvolle Lösungsansätze die Reduktion der Belastungen und die Gestaltung der Freiräume im Vordergrund. Neu sind diese Forderungen allerdings nicht – bereits 1982 lautete ein Leitsatz: Die Strasse ist für alle da. Strassenraum ist Lebensraum.[1]
Die Siedlungen sollen wieder ein attraktiver Lebensraum für die Bewohnerinnen und Bewohner werden. Die Raumplanung bemüht sich unter dem Motto «Innere Entwicklung» um wohnliche Siedlungen und Quartiere, der Umweltschutz versucht, mit technischen Mass nahmen an der Quelle die Umweltbelastungen zu senken, und die Verkehrsplanung hat mit gestalterischen Massnahmen den Verkehr gezähmt, verlangsamt oder aus den Ortskernen verdrängt.[2, 3] In der aktuellen Agglomerationspolitik wird der Gestaltung der Strassenräume eine wichtige Funktion beigemessen, und der Bund finanziert die Einrichtung von Begegnungs- und Tempo-30-Zonen mit. In den letzten Jahren haben daher viele Gemeinden Tempo-30-Zonen eingerichtet, die – richtig konzipiert – sehr wirkungsvoll sind. Ausserdem zeigt sich, dass es sinnvoll ist, solche Zonen in den Gemeinden möglichst flächendeckend umzusetzen.[4, 5]
Von der Flanierzone zur Begegnungszone
Zu Diskussionen Anlass geben heute die Begegnungszonen, von denen mittlerweile über 300 in der Schweiz realisiert wurden oder in Realisierung sind.[6] Diese schaffen anstelle einer funktionalen Trennung der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden einen Lebensraum von hoher Aufenthaltsqualität – mit geringem Flächenverbrauch und auf tiefem Geschwindigkeitsniveau. Den Anfang nahm dieses neue, fussgängerfreundliche Verkehrsregime 1996 als «Flanierzone» in Burgdorf. Wissenschaftliche Auswertungen des Pilotprojekts zeigten positive Ergebnisse: Befragungen ergaben, dass sich die anfängliche Skepsis der Bevöl kerung und des Gewerbes im Laufe der Zeit in Akzeptanz wandelte. Zugleich nahm der Umsatz der Geschäfte zu. Nach der Einführung sank das Geschwindigkeitsniveau um ca. 20 km/h, und der motorisierte Verkehr nahm um 16 % ab. Seit 2000 wurde die zunächst provisorische Gestaltung des Strassenraums definitiv umgebaut und als Fläche von Fassade zu Fassade gestaltet.
Begegnungszonen eignen sich dort, wo erheblicher Fussgängerverkehr herrscht, eine Fussgängerzone auf Grund der Grösse des Geschäftsgebietes aber nicht in Betracht kommt. Der querende Fussgängerverkehr hat einen wesentlichen Anteil am Gesamtverkehr, und die Durchmischung erfolgt flächig über die gesamte signalisierte Langsamfahrstrecke. Diese wird auch vom Linienbus frequentiert, ebenso ist die Zufahrt mit Autos und die Anlieferung mit Lastwagen zu gewährleisten.
Über den tatsächlichen Nutzen von Begegnungszonen scheiden sich die Geister. Zwei Kriterien, für die allerdings nur wenige Auswertungen vorliegen, bestimmen die Diskussion: die Unfalldaten und die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit in den Langsamfahrzonen. Ein vom Baudepartement des Kantons Basel-Stadt veröffentlichter Bericht zur Erfolgskontrolle der verschiedenen Projekte zeigt, dass die Geschwindigkeit unter 30 km/h gesenkt wurde. Gleichzeitig wird die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h nur in zwei Begegnungs zonen eingehalten. Das Verwaltungsgericht St. Gallen hat in einem Urteil festgehalten: Die gefahrenen Geschwindigkeiten im Bereich einer Begegnungszone lagen bei den vorgenommenen Messun gen bei 85 % aller Motorfahrzeuge im Bereich bis 38 km/h und bei 50 % aller Motorfahrzeuge im Bereich bis 28 km/h. Kein Fahrzeug überschritt die Limite von 50 km/h. Daraus wurde im Gutachten die Schlussfolgerung gezogen, es sei ein «recht tiefes Ge schwindigkeits niveau» erreicht worden, sodass aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeiten keine schwere Gefährdung bzw. keine Notwendigkeit zum Schutz besonderer Kategorien von Verkehrsteilnehmern bestehe.[7] Eine andere Auswertung von Unfalldaten in vier Begegnungszonen (Burgdorf, Biel, Lyss und Einsiedeln) zeigt eine Reduktion der Unfälle, der Verletzten und der Sachschäden zwischen 10 % und 30 %. Die Zahl der Verletzten – Fussgänger und Radfahrer – sank von 20 auf 16. Ein grosser Teil der Unfälle sind Bagatellunfälle, die unabhängig vom Verkehrsregime bei tiefen Geschwindigkeiten geschehen, etwa beim Parkieren, Manövrieren oder Abbiegen. Insgesamt kann den Begegnungszonen bezüglich Verkehrssicherheit also ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Die Befürchtung, dass sich durch die geringe Regelungsdichte und die damit verbundene Verunsicherung mehr Unfälle ereignen, hat sich nicht bewahrheitet. Andererseits ist die Reduktion der Unfallzahlen und -folgen nicht so markant, dass mit der Einrichtung einer Begegnungszone eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit einhergeht. Wünschenswert wären hier Untersuchungen mit einer breiteren Datenbasis in Abhängigkeit von den Gestaltungstypen.
Konflikte mit dem öffentlichen Verkehr
Die Kritik an den neuen Zonen kommt meist vonseiten des öffentlichen Verkehrs, dessen Interessen den Forderung nach «Langsamfahrzonen» entgegenstehen: Die Umläufe der Buslinien sind zum Teil sehr knapp bemessen und bei Verkehrsbehinderungen kaum pünktlich fahrbar. Zudem wird in den nächsten Jahren mit einem markanten Zuwachs an öV-Benützern gerechnet, die ihre Anschlüsse gesichert sehen wollen. Bei Entscheiden ist daher genau zwischen den verschiedenen Ansprüchen abzuwägen.
Die nachstehenden Überlegungen und Ansätze basieren vor allem auf den Diskussionen im Kanton Basel-Landschaft im Zusammenhang mit der Einführung und der Ausdehnung der Langsamfahrzonen und auf Reaktionen von Verkehrsfachleuten.[8] Grundlage für die Erteilung einer Bewilligung für eine Tempo-30-Zone ist die «Verordnung über Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen» vom September 2001. Darin wurde die Flächenbegrenzung auf 0.7 km2 aufgehoben, sodass ganze Ort- oder Talschaften zu einer einzigen Tempo-30-Zone werden können. Nicht geregelt wurde jedoch der Umgang mit dort verlaufenden öV-Linien. Dadurch erhöht sich die Konfliktwahrscheinlichkeit, die zu unplanbaren zeitlichen Verzögerungen im Busverkehr führen können – mit negativen Auswirkungen auf den Fahrplan:
1. Temporeduktion: Durch die Verlangsamung der Busfahrt aufgrund der Reduktion der Höchstgeschwindigkeit wird die Benützung des öffentlichen Verkehrs unattraktiver und stellt keine interessante Alternative zum Individualverkehr dar.
2. Wegfall der Vortrittsberechtigung: Mit einer Langsamverkehrszone geht die Einführung eines generellen Rechtsvortritts einher. Auch Busse müssen bei jeder Rechtseinmündung den Vortritt gewähren, was für die Fahrgäste unangenehme und sicherheitsrelevante abrupte Brems- und Anfahrvorgänge zur Folge hat.
3. Hindernisse: In Langsamverkehrszonen wird die Fahrbahnbreite meist durch Anordnung von versetzten Parkfeldern oder künstlichen Hindernissen reduziert. Dies bewirkt eine für die Fahrgäste unangenehme und für den Wagenführer anspruchsvolle Schlangenfahrt. Zudem ergeben sich umständliche Kreuzungsvorgänge mit Personenwagen.
Obwohl die gefahrene Höchstgeschwindigkeit auf für Langsamverkehr vorgesehenen Strassen wenig über 40 km/h hinausgeht und dadurch der Fahrzeitverlust meist klein ausfällt, kann Punkt 1 insbesondere bei gespannter Fahrplanlage und knappen Anschlusszeiten betriebliche Probleme bereiten und gegebenenfalls sogar Folgekosten verursachen, wenn mehr Busse eingesetzen werden müssen, um die Umlaufzeiten sicherzustellen. Stärker fallen die Punkte 2 und 3 ins Gewicht, da sie gleichzeitig fahrplan- und sicherheitsrelevant sind. Eine Vollbremsung stellt das höchste Gefährdungspotenzial für Fahrgäste dar, vor allem bei einem hohen Anteil stehender Fahrgäste.
Ein weiteres Spannungsfeld zeigt sich im Bereich von Schulen. Um den Konflikt zwischen Kindern und anderen Verkehrsteilnehmenden zu minimieren, wünschen sich Gemeinden in diesen Strassenabschnitten eine Verkehrsberuhigung. Gleichzeitig ist der Linienbus vielerorts das Haupttransportmittel für die Schüler, der notwendig in Schulhausnähe verkehrt und hält. Vor diesem Hintergrund werden folgende Handlungsgrundsätze abgeleitet:
1. Auf Hauptsammelstrassen mit öV-Linien sind grundsätzlich keine Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen zulässig.
2. Auf Quartiersammelstrassen mit öV-Linien sind Tempo-30-Zonen (nach Abwägung der Nachteile für den Busbetrieb) denkbar.
3. Auf Haupt- und Quartiersammelstrassen ohne öV-Linien sind Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen möglich (Beurteilung: evtl. zukünftige Bedienung mit öV-Linie).
Zusätzlich sind in der Nähe von Schulhäusern, bei publikumsintensiven Einrichtungen oder auf zentralen Plätzen kurze Tempo-30-Abschnitte oder Begegnungszonen zur Vernetzung verkehrsberuhigter Zonen nach vorgängiger Prüfung durch die öV-Verantwortlichen denkbar. Dass sich Busse und Begegnungszone durchaus vertragen, zeigt wiederum das Beispiel Burgdorf. Verkehrsplaner schätzen die Fahrzeitverluste gering ein, da Begegnungszonen dort eingerichtet wurden, wo bisher schon langsam gefahren wurde. Viel stärker auf die Gesamtfahrzeit wirken sich Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen und unterschiedlich lange Haltezeiten aus – wenn zum Beispiel viele Menschen ein- oder aussteigen wollen.
Anmerkungen:
[01] Manfred Sack: Lebensraum: Strasse. Schriftenreihe des deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Band 14, Bonn 1982, 84 Seiten
[02] Hanspeter Lindenmann, Stefan Frey, Markus Schwob: Gestaltung von Kantonsstrassen in Ortskernen. Institut für Verkehrsplanung, Transporttechnik, Strassen- und Eisenbahnbau ETHZürich, Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft, Zürich und Liestal 1987, 69 Seiten
[03] Tiefbauamt des Kantons Bern, Gemeinde Köniz, Tiefbauamt der Stadt Bern (Hrsg.): Der Wabernblock. Bern 1998, 56 Seiten
[04] Mobilservice – Plattform für eine zukunft sorientierte Mobilität: Praxisbeispiel, Zonen mit Tempobeschränkung, 24 Seiten, www.mobilservice.ch
[05] Mit dem «Berner Modell» hat der Kanton Bern zusammen mit Fachleuten auf teils pragmatischem und teils wissenschaft lichem Weg eine Vorgehens und Planungsphilosophie entwickelt, welche die Reparatur und das Schaff en von Entwicklungsspielräumen im Auge hat, aber auch das Umgehen mit dem Konfliktpotenzial. www.tba.bve.be.ch, Berner Modell (Projektbeschriebe, Wirksamkeitsanalysen, Film «Berner Modell»)
[06] www.begegnungszonen.ch
[07] Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 23. Januar 2007
[08] Im Kanton Basel-Landschaft ist die Abteilung öffentlicher Verkehr dem Amt für Raumplanung angegliedert – wie auch die Fachstelle Lärmschutz und die Kantonale Denkmal- und Ortsbildpflege. Innerhalb des Kantons beschäftigen sich insbesondere drei kantonale Amtsstellen mit der Genehmigung von Langsamfahrzonen: die Polizei, das Tiefbauamt und das Amt für RaumplanungTEC21, Fr., 2009.08.14
14. August 2009 Hans-Georg Bächtold