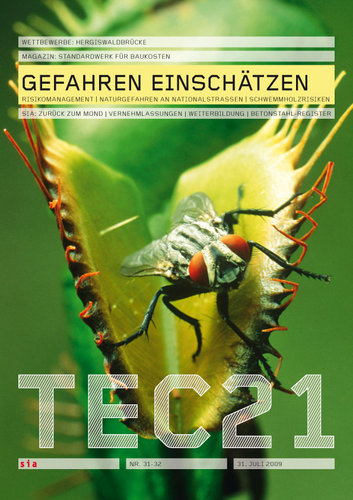Editorial
Als Gebirgsland ist die Schweiz den Naturgefahren in besonderem Masse ausgesetzt. Die Überschwemmungen im Urner Reusstal 1987, die über die Ufer tretende Saltina in Brig 1993 und der Erdrutsch in Gondo 2000 zeigten die Verletzlichkeit von Siedlungen und Infrastrukturen eindrücklich auf. Das Hochwasser vom August 2005 hat mit Schäden von knapp drei Milliarden Franken alle bisherigen Naturereignisse in der Schweiz übertroffen. Und angesichts der Klimaerwärmung dürfte nach Einschätzung von Fachleuten die Bedrohung durch Naturgefahren weiter zunehmen.
Doch die finanziellen Ressourcen für den Schutz vor Naturgefahren sind begrenzt. Deshalb sind die verfügbaren Mittel optimal einzusetzen. Oft ist man jedoch damit konfrontiert, dass in einer Region nicht genügend Informationen zentral vorliegen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Das im Artikel auf Seite 16 ff. beschriebene Analyseinstrument RiskPlan schliesst diese Lücke. Es erlaubt den Verantwortlichen, schnell und effizient eine Übersicht über die Risikolage in einem bestimmten Gebiet zu erhalten. Im Kanton Nidwalden wurde das Instrument bereits erfolgreich getestet.
Bei den Nationalstrassen will der Bund wissen, wo diese am stärksten durch Naturgefahren bedroht sind. Der Felssturz von Gurtnellen 2006 hat Sicherheitsverantwortliche und Politiker aufgeschreckt. Zum einen waren zwei Todesopfer zu beklagen, zum anderen musste die A2 in der Folge mehrere Wochen lang gesperrt werden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) beurteilt nun auf dem gesamten Nationalstrassennetz die Naturgefahren nach einheitlichen und nachvollziehbaren Kriterien (vgl. S.19 ff.). Die Ergebnisse bilden künftig die Grundlage für weitere Schutzmassnahmen.
Der Artikel auf Seite 22 ff. schliesslich ist einem Thema gewidmet, das erst vor wenigen Jahren ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt ist – dem Schwemmholz. 2006 hat der Kanton Luzern ein wegweisendes Projekt zum Gewässerunterhalt und zur Pflege von Wäldern entlang von Fliessgewässern gestartet, um die vom Schwemmholz ausgehenden Risiken zu reduzieren. Das Dilemma: Bäume schützen vor Erosion, bei Unwettern können sie aber als Schwemmholz mitgerissen und zum Risiko werden. Somit gilt es einerseits die gefährlichen Stellen an Bächen und Flüssen zu erkennen. Andererseits ist für jeden einzelnen Baum jeweils zu entscheiden, ob er stehen bleiben soll oder aber aus Sicherheitsgründen entfernt werden muss. Nach der allgemeinen Einschätzung der Risiken ist deshalb eine fachkundige Beurteilung der notwendigen Massnahmen sehr kleinräumig vor Ort vorzunehmen – eine aufwendige und anspruchsvolle Angelegenheit.
Dabei sind auch die für die Holzerei schwierigen Verhältnisse mit oft sehr steilen Hängen zu berücksichtigen.
Lukas Denzler
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Hergiswaldbrücke
13 MAGAZIN
Standardwerk für Baukosten
16 PRAGMATISCHES RISIKOMANAGEMENT MIT RISKPLAN
P. Greminger, J. Balmer, Ch. Willi, H. A. Merz, P. Gutwein
Das Analyseinstrument RiskPlan ermöglicht eine Übersicht über die Risiken in einer bestimmten Region. Mit der Software können die Kosten für Massnahmen den zu erwartenden Schäden gegenübergestellt werden.
19 NATURGEFAHREN ENTLANG VON NATIONALSTRASSEN
Luuk Dorren, Philippe Arnold
In einem mehrjährigen Projekt erfasst der Bund gegenwärtig die Naturgefahren auf dem Nationalstrassennetz nach einheitlichen und nachvollziehbaren Kriterien.
22 SCHWEMMHOLZRISIKEN REDUZIEREN
Silvio Covi
Mit der gezielten Schutzwaldpflege entlang von Fliessgewässern reduziert der Kanton Luzern Risiken, die vom Schwemmholz ausgehen.
28 SIA
Zurück zum Mond | Vernehmlassungen | Weiterbildungskurse | Betonstahl-Register
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Pragmatisches Risikomanagement mit Riskplan
Risikoanalyse, Risikobewertung und integrale Massnahmenplanung bilden die wesentlichen Elemente eines risikobasierten Umgangs mit Natur gefahren. Oft existieren aber nicht genügend Informationen, um in der Praxis einen sachgerechten Dialog über Risikien und somit fundierte Entscheide treff en zu können. Das pragmatische Risikomanagement und das in den letzten Jahren entwickelte Analyseinstrument RiskPlan tragen diesem Umstand Rechnung. Mit RiskPlan ist es möglich, schnell und effi zient eine Übersicht über die Risikolage in einer bestimmten Region zu erhalten.
Die Sicherheit der Bevölkerung und das Wohlergehen einzelner Personen hängen von vielen Faktoren ab. Der Schutz vor technischen und ökologischen Risiken sowie die Absicherung vor sozialen Risiken spielen eine wichtige Rolle. In einem Gebirgsland wie der Schweiz kommt aber auch der Bedrohung durch Naturgefahren ein hoher Stellenwert zu. So erreichten beispielsweise die Unwetter im Jahr 2005 ein noch nie dagewesenes Schadensausmass von rund 3 Mrd. Fr.[1] Weil die fi nanziellen Ressourcen und die technischen Möglichkeiten, die Menschen vor diesen Gefahren zu schützen, begrenzt sind, kann es keine absolute Sicherheit geben. Ein den Verhältnissen angepasster Einsatz der Mittel ist deshalb unabdingbar. Insbesondere gilt dies für die langfristigen Investitionen in den Schutz vor Naturgefahren. Der präventive Schutz vor Naturgefahren muss sich an einem kostenbewussten und wirkungsvollen Handeln orientieren, wobei eine möglichst ausgewogene Sicherheit für die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen anzustreben ist. Nach dem Willen des Bundesrates sollen bezüglich der Naturgefahren in der ganzen Schweiz grundsätzlich vergleichbare Sicherheitsstandards gelten.[2] Welches (Rest-)Risiko zu akzeptieren ist, ist eine gesellschaftspolitische Frage, die eine differenzierte Antwort erfordert.
Ziel jedes Risikomanagements muss es sein, folgende Schlüsselfragen zu beantworten: Was kann passieren? Was darf passieren? Was kann man tun? Was kostet es? Mit welcher Art von Restrisiko müssen wir uns auseinandersetzen?
Risikoreduktion hat ihren Preis
Massnahmen zur Reduktion der Risiken kosten die öffentliche Hand immer Geld, sofern diese für die Sicherheit zuständig ist. Zur Verringerung eines durch Naturgefahren bedingten Risikos gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählen etwa technische Einrichtungen zum Schutz vor Naturereignissen (z. B. Lawinenverbauungen), aber auch Frühwarnsysteme und Objektschutz bei Gebäuden. Bei einer Strasse stellt sich zum Beispiel die Frage, ob ein Tunnel gebaut werden soll, der das Steinschlagrisiko auf null reduziert, oder ob eventuell eine Warnanlage genügt. Letzteres ist wesentlich günstiger, kann aber temporäre Strassensperrungen nicht verhindern. Industriebetriebe oder Hauseigentümer können durch geeignete Objektschutzmassnahmen das Schadensausmass im Falle eines Hochwassers reduzieren. Einen wichtigen Beitrag zur Risiko- bzw. Schadenreduktion leisten auch die Notfall organisationen.
Dieses ganzheitliche Vorgehen wird als integrales Risikomanagement bezeichnet. Es beinhaltet eine Kombination von möglichen Massnahmen von der Prävention, Vorsorge, Bewältigung von Naturereignissen über die Instandsetzung bis hin zum Wiederaufbau. Die Qualität der Massnahmenpalette hängt davon ab, in welchem Masse diese die Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung zu erfüllen vermag.
Beim Risikomanagement ist man immer wieder mit dem Problem konfrontiert, zu wenig Informationen über die relevanten Naturgefahren und die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch eintreten, zu haben. Dasselbe gilt für die zu erwartenden Schäden. Das pragmatische Risikomanagement (siehe Kasten) und das in den letzten Jahren entwickelte Analyseinstrument RiskPlan tragen dieser Tatsache Rechnung.
Übersicht über die Risiken in einer Region
Weil die 1999 vom Bundesamt für Umwelt herausgegebene Publikation zur Risikoanalyse für gravitative Naturgefahren[3] von der Praxis als zu komplex beurteilt wurde, bemühte sich der Bund mit dem neuen Projekt RiskPlan um eine pragmatische Vorgehensweise. Dabei sollten das Expertenwissen und die lokalen Erfahrungen in besonderem Masse berücksichtigt werden. Getragen wird das Projekt gemeinsam von den Bundesämtern für Umwelt und Be völkerungs schutz. Nach ersten Pilotversuchen zeigte sich, dass eine EDV-gestützte Anwendungshilfe für die Durchführung der Risikoanalyse und die grafi sche Darstellung der Resultate hilfreich wäre. Eine solche Software wurde inzwischen von den Firmen Ernst Basler Partner AG und der GRSoft GmbH entwickelt (vgl. www.riskplan.admin.ch). Mit RiskPlan ist es einerseits möglich, schnell und effi zient eine grobe Übersicht über die Risikolage in einer Region zu erarbeiten und mögliche Massnahmen zur Verminderung des Risikos hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit zu schätzen. Andererseits können die Risikosituationen in verschiedenen Gemeinden miteinander verglichen werden. Bei der Risikobeurteilung geht es darum, die in der Software festgelegte Risikomatrix mit den entsprechenden Angaben zu füllen. Sämtliche vorhandenen Informationen aus Gefahren- und Intensitätskarten sowie dokumentierten Ereignissen wie auch das Wissen und die Erfahrungen von Fachleuten und direkt Betroffenen fliessen dabei in die Matrix ein. Jeder Gefahrenprozess ist mit verschiedenen Eintretenswahrscheinlichkeiten[4] zu erfassen. Die Wirkung möglicher Klimaszenarien kann beispielsweise durch Änderung der Eintretenswahrscheinlichkeiten simuliert werden. Auf der Basis der simulierten Ergebnisse lassen sich unterschiedliche Auswirkungen extremer Klimaszenarien auf Personen und Sachwerte grafi sch darstellen. Die rechnerische Bestimmung der Risiken erfolgt nach den anerkannten Regeln des Risikokonzepts.[5] Um zu berücksichtigen, dass ein einzelnes Ereignis mit 20 Todesopfern von Politik und Gesellschaft als schlimmer empfunden wird als 20 einzelne Ereignisse mit je einem Todesfall, kann ein Faktor für die Risikoaversion gegenüber katastrophalen Ereignissen eingesetzt werden. Um eine monetäre Bewertung vornehmen zu können, ist zudem die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft zur Rettung eines Menschenlebens zu defi nieren. In der Schweiz wird im Bereich der Naturgefahren die Zahlungsbereitschaft mit 5 Mio. Fr. veranschlagt. Diese Zahl sagt aber nichts über den eigentlichen Wert eines Menschenlebens aus.
Risikodialog und partizipative Entscheidungsprozesse
Mithilfe der Software RiskPlan können die Kosten für Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren den zu erwartenden Schadenskosten grob gegenübergestellt werden. Besonders hilfreich ist, dass unterschiedliche Sicherheitsmassnahmen zur Risikoreduktion anhand von Vergleichsgrafi ken diskutiert werden können. Analoges gilt für den Vergleich der Risikosituationen vor und nach ausgeführten Schutzmassnahmen. Wie sich gezeigt hat, bilden diese Darstellungen eine hervorragende Grundlage für einen partizipativen Risikodialog. Zudem bietet sich mit den Risikoübersichten die Möglichkeit, die Entscheidungsträger in den Entscheidungsprozess einzubinden.
Ein solcher pragmatischer Ansatz hat zudem den Vorteil, dass Wasserbautechniker, Naturgefahrenspezialisten, Versicherer, Polizei, Feuerwehr und Vertreter des Bevölkerungsschutzes ihre Erfahrungen austauschen können. Gemeinsam tragen sie die Daten zusammen, um diese in die Risikobeurteilung von RiskPlan einzubringen. Unmittelbar danach können sie die Resultate diskutieren. Dies fördert das disziplinenübergreifende Gespräch und führt zu einer neuen Kultur der Zusammenarbeit. Die Methodik von RiskPlan ist prinzipiell für alle Arten von Risiken anwendbar. Deshalb kann dieses Instrument auch in anderen Sicherheitsbereichen wie etwa technischen Störfällen oder Umweltrisiken eingesetzt werden. RiskPlan verfügt auch bei der Ausbildung von Naturgefahren- und Risikofachleuten über ein noch nicht ausgeschöpftes Anwendungspotenzial.
Testfall Nidwalden
Interessante Resultate ergab eine Fallstudie in Nidwalden, bei der das neue Analyseinstrument getestet wurde. Nidwalden eignete sich als Testregion, weil in den vergangenen 10 Jahren an der Engelberger Aa ein vorbildliches Projekt zum präventiven Hochwasserschutz realisiert worden war (vgl. TEC21 36/2006). Bisher wurden Investitionen von 30 Mio. Fr. getätigt. Dadurch konnten beim Hochwasser vom August 2005 geschätzte Kosten von über 160 Mio. Fr. verhindert werden.
Das Team, das die Analysen durchführte, setzte sich aus Vertretern des Tiefbauamtes (Experten Hochwasserschutz), der Nidwaldner Sachversicherung (Experten Schadenpotenzial und Vulnerabilität) und den beiden Ingenieurbüros Oeko-B (lokale Naturgefahren experten) und Ernst Basler Partner (RiskPlan) zusammen. Betrachtet wurden primär Hochwasser der Engelberger Aa, Seeüberflutungen und Wildbäche am Stanserhorn. Dabei zeigte sich die Effi zienz der in den letzten Jahren getroffenen Massnahmen deutlich. Der jährliche Schadenerwartungswert wurde von 10.42 Mio. Fr. auf 0.44 Mio. Fr. respektive auf 4 % reduziert (Abb. 3). Die Ergebnisse der Fallstudie in Nidwalden wurden von allen Beteiligten als plausibel und sehr informativ beurteilt.
Versuchsweise wurde auch ein Flugzeugabsturz durchgespielt. Mit dem Flugplatz und dem Pilatus Flugzeugwerk bei Stans kann dies nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es zeigte sich, dass die Risiken eines Flugzeugabsturzes sehr viel kleiner sind als diejenigen, die von einem Hochwasser ausgehen. Der jährliche Schadenerwartungswert für einen Flugzeugabsturz liegt bei rund 1900 Fr., derjenige für Hochwasserrisiken bei rund 460 000 Fr. pro Jahr.
Internationale Einbettung
Das Projekt beinhaltet auch eine internationale Komponente. Im März 2009 trafen sich 17 Experten aus den Alpenländern in Stans, um RiskPlan als Arbeitsinstrument am Beispiel der Fallstudie Nidwalden kennen zu lernen. Diese haben nun die Möglichkeit, die Software in den nächsten zwei Jahren an eigenen Fallbeispielen in ihrer Region zu testen. Die Nutzung und Weiterentwicklung von RiskPlan ist der Hauptbeitrag der Schweiz zum Interreg-III-B-Alpine-Space-Projekt «AdaptAlp – Adaptation to Climate Change in the Alpine Space»[6]. In diesem EU-Projekt werden die Veränderungen, die der Klimawandel im Alpenraum verursacht, in Form von Szenarien studiert und Strategien entwickelt, um angemessen darauf reagieren zu können. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit China (vgl. Kasten) ist zudem vorgesehen, einen internationalen Workshop zu den Themen integrales Risikomanagement und RiskPlan durchzuführen.
Anmerkungen:
[01] Hochwasser 2005 in der Schweiz, Synthesebericht zur Ereignisanalyse. Uvek, 2008
[02] Strategie Naturgefahren, Synthesebericht. Planat, 2004
[03] Risikoanalyse bei gravitativen Naturgefahren. Umweltmaterialien Nr. 107. Buwal, 1999
[04] In der Regel wird für die Eintretenswahrscheinlichkeiten eines Ereignisses eine Wiederkehrdauer von 30, 100 oder 300 Jahren verwendet
[05] Risikokonzept für Naturgefahren – Leitfaden. Planat, 2009
[06] Weitere Informationen: www.adaptalp.orgTEC21, Fr., 2009.07.31
31. Juli 2009 Peter Greminger, Jürg Balmer, Christian Willi, Hans A. Merz, Peter Gutwein
Naturgefahren entlang von Nationalstrassen
Zurzeit klärt der Bund in einem mehrjährigen Projekt ab, wo die Nationalstrassen in der Schweiz am stärksten durch Naturgefahren bedroht sind. Ziel ist es, die Risiken vergleichbar zu erfassen und darzustellen. Dies bildet eine wichtige Grundlage, um die Investitionen in Schutzmassnahmen künft ig möglichst optimal einzusetzen. Der Vergleich mit anderen Risiken auf der Strasse bleibt aber weiterhin schwierig.
Was ist eigentlich gefährlicher: durch den Gotthardtunnel zu fahren oder auf der A2 bei Gurtnellen oder einfach irgendwo auf einer Autobahn in der Schweiz? Seit 2008 ist das Bundesamt für Strassen (Astra) durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und die damit verbundene neue Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) für Planung, Bau und Betrieb des ganzen Nationalstrassennetzes verantwortlich. Deshalb könnte man meinen, das Bundesamt könne diese Frage problemlos beantworten. Dass dies aber nicht so einfach ist, wird nachfolgend anhand des vom Astra verwendeten Risikokonzepts «Naturgefahren auf Nationalstrassen» erläutert. Zudem werden erste Erfahrungen eines Pilotprojektes im Urner Reusstal vorgestellt.
Risikobasiertes Naturgefahrenmanagement beim Astra
Im Astra wird gegenwärtig ein Naturgefahren-Risikomanagement eingeführt, das Klarheit darüber schaffen soll, welche Ereignisse bei Nationalstrassen ein Risiko darstellen und wo Chancen für Verbesserungen liegen. Das Astra wird dabei durch Fachleute des Bundesamtes für Umwelt unterstützt. Das Risikomanagement stellt Methoden und Instru mente bereit, um Risiken wie auch Chancen zu erfassen, zu beurteilen und um Massnahmen zu ergreifen. Um entscheiden zu können, welche Massnahmen Priorität haben, müssen Risiken miteinander verglichen werden. Das führt zurück zur am Anfang gestellten Frage. In einem ersten Schritt ist «gefährlich» zu defi nieren. Aus der Sicht eines Autofahrers ist es in erster Linie das Risiko, auf einer Nationalstrasse getötet zu werden (Todesfallrisiko). Dieses Risiko kann für die drei erwähnten Situationen berechnet werden – entweder auf Basis von dokumentierten Todesfällen oder aber mit Hilfe von theoretischen Risikomodellen. Im ersten Fall würden folgende Zahlen zu Verfügung stehen: – Gemäss Bundesamt für Statistik gab es 2007 41 Unfälle mit Todesopfern auf Autobahnen. – Im Gotthardtunnel kamen zwischen 1981 und 2007 32 Personen ums Leben (11 davon beim Tunnelbrand 2001; seit 2001 gibt es 60 % weniger Unfälle im Tunnel als vorher). – Beim Felssturzereignis 2006 in Gurtnellen kamen 2 Personen ums Leben. Ausser diesem Ereignis hat es auf der Autobahn bei Gurtnellen seit deren Inbetriebnahme Anfang der 1980er-Jahre keine durch Naturgefahren bedingten Todesfälle gegeben. Das Todesfallrisiko könnte hiermit als die mittlere Anzahl Todesfälle pro gefahrenen Meter pro Jahr berechnet werden. Obwohl sich so ungefähre Todesfallrisiken bestimmen liessen, ist es fraglich, ob diese Zahlen wirklich auch vergleichbar sind, denn es handelt sich um verschiedene Risikotypen. Ausserdem sind solche Todesfallzahlen nicht für das ganze Nationalstrassennetz vorhanden. Somit lassen sich auf dieser Basis schweizweit keine Massnahmen zur Prävention von möglichen Schäden planen.
Eine Alternative bieten theoretische Risikomodelle, die Schadenshäufi gkeit und Schadensausmass für defi nierte Szenarien berechnen. Die Entwicklung eines solchen Modells für Naturgefahren auf Nationalstrassen hat das Astra im Juli 2009 publiziert.[1]
Dabei stützte mansich auf das Risikokonzept der Plattform Naturgefahren (Planat)[2].Somit können künftig Naturgefahren, welche die Nationalstrassen bedrohen, nach einheitlichen und nachvollziehbaren Kriterien beurteilt und Schutzmassnahmen geplant werden. Dieses sogenannte «Risikokonzept Naturgefahren Nationalstrassen» wurde in den vergangenen Monaten im Rahmen eines Pilotprojekts im Urner Reusstal getestet und verbessert. Die beauftragten Büros haben in zwei Abschnitten – im unteren Reusstal vom Seelisbergtunnel Süd bis Erstfeld und im oberen Reusstal von Gurtnellen bis Göschenen – eine Naturgefahren- und Risikoanalyse durchgeführt. Die Wahl fi el auf das Urner Reusstal, weil in dieser Region nahezu alle relevanten Naturgefahrenprozesse vorkommen (vgl. Kasten).
Naturgefahrenanalyse
Für alle zu analysierenden Naturgefahrenprozesse wurden für einen Perimeter von in der Regel 50 m auf beiden Seiten der Fahrbahn – dem sogenannten Perimeter «Schadenpotenzial » – Intensitätskarten erstellt. Diese Karten weisen pro Prozess und Eintretenswahrscheinlichkeit[3] die Intensitäten «schwach», «mittel» und «stark» aus. Die für die Gefahren analyse benötigten Arbeitsschritte sind in der Dokumentation defi niert; sie halten sich an den heutigen Stand der Technik und die entsprechenden Publikationen des Bundes. Wichtig ist unter anderem, dass bestehende Schutzmassnahmen (Schutzbauten und Schutzwald) in der Gefahrenanalyse berücksichtigt und auch dokumentiert werden. Diese Transparenz ist sehr wichtig, um alle Beurteilungen schweizweit vergleichen zu können. Um die Eintretenswahrscheinlichkeiten besser festlegen und die Ergebnisse der Gefahrenanalyse teilweise auf ihre Plausibilität zu überprüfen, wurde ein Ereigniskataster erstellt. Dieser basiert auf kantonalen Daten sowie auf Hinweisen von lokalen Fachleuten.
Risikoanalyse
Folgende durch Naturgefahren bedingte Schäden werden in der Risikoanalyse berücksichtigt: – Personen können durch Naturereignisse getötet werden. – Ablagerungen auf der Strasse müssen geräumt und beschädigte oder zerstörte Infrastrukturen wiederhergestellt werden. – Ein Streckenabschnitt muss vorsorglich oder nach einem Naturereignis gesperrt werden. Dadurch entstehen Kosten infolge nicht verfügbarer Strecken. Diese Schäden werden durch die Verletzlichkeit der Objekte sowie die Intensität und Art der Gefahrenprozesse bestimmt. Um die Schäden untereinander vergleichbar zu machen, werden sie in der Risikoberechnung in Fr./Jahr umgerechnet. Das Risiko wird pro Prozessquelle, Gefahrenszenario und Expositionsszenario für die Fahrbahnachsen berechnet. Als Basis für die Exposition dient der – nach Fahrtrichtung und Saison aufgeschlüsselte – durchschnittliche tägliche Verkehr.
Erste Resultate
Im unteren Reusstal wurden insgesamt 72 historische Ereignisse erfasst: 3 Rutschungs-, 44 Lawinen-, 19 Steinschlag- und 6 Wasserereignisse. Für die Gefahrenanalyse wurden 12 Sturzprozessquellen, 4 Lawinenzüge, 24 Wildbäche, 11 Rutschgebiete sowie die Reuss, der Schächen und die Stille Reuss beurteilt. Es zeigt sich, dass die A2 im unteren Reusstal durch Hochwasser-, Sturz-, Rutsch- und Lawinenprozesse bedroht ist. Das Gesamtrisiko infolge aller dieser Prozesse liegt bei mehreren 100 000 Fr. pro Jahr. Die Hochwasserprozesse tragen zu fast 80 % zum Gesamtrisiko bei; der Rest geht fast ausschliesslich auf das Konto der Sturzprozesse. Das durch Wasserprozesse bedingte Risiko besteht nur aus Sachrisiken. Bei Steinschlag machen Personenrisiken hingegen fast ein Fünftel des Gesamtrisikos aus. Die Gefahrenanalyse hat auch gezeigt, dass die bestehenden Schutzwälder und Schutzbauten das Risiko deutlich reduzieren. Ein Sonderfall ist der Entlastungskorridor für Hochwasser in Erstfeld und Altdorf. Hier dient die A2 im Hochwasserfall nämlich als Schutz für die angrenzenden Siedlungen. Dies erhöht aber das Risiko für Sachschäden an der A2 bei Hochwasserereignissen.Im oberen Reusstal wurde die Gefährdung durch 20 Lawinenzüge, 13 Sturzquellen, 25 Wildbäche sowie die Reuss und alle potenziellen Hangmuren beurteilt. Das Gesamtrisiko auf der A2 im oberen Reusstal ist infolge all dieser Prozesse ca. 25 Mal höher als im unteren Reusstal. Der Grund dafür sind die hohen Kosten, die durch eine eingeschränkte Verfügbarkeit der Strasse infolge drohender Lawinengefahr oder Lawinenabgänge verursacht werden. Lawinen bestimmen einen grossen Teil des Gesamtrisikos, wobei Personenschäden einen Fünftel davon ausmachen. Wasser- und Sturzprozesse bestimmen 17 % respektive 2 % des Gesamtrisikos. Wasserprozesse verursachen nur Sachschäden, bei Sturzprozessen machen Personenrisiken jedoch die Hälfte des Risikos aus.
Ausblick
Das Pilotprojekt ist erfolgreich verlaufen. Der gewählte Ansatz für den gesamtschweizerischen Umgang mit Naturgefahren bei den Nationalstrassen kann somit weitergeführt werden. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass der Perimeter, der für das Schadenpotenzial betrachtet wird, reduziert werden kann. In der Regel genügen 10 m auf beiden Seiten der Fahrbahn. Die Lose für die Naturgefahrenbeurteilung, die Anfang Juli 2009 ausgeschrieben worden sind, betreffen die noch nicht bearbeiteten Strecken der A2 im Kanton Uri, den Gotthardpass, die Leventina, die Strecke Bellinzona–Chiasso und das Misox. Die Resultate der Gefahrenanalysen werden auch der Eisenbahn zur Verfügung stehen. Der Perimeter «Schadenpotenzial» wird in Rücksprache mit den SBB bestimmt, um mögliche Synergien nutzen zu können.
Die Resultate der Naturgefahrenbeurteilungen sollen bis 2012 für das gesamte Nationalstrassennetz vorliegen. Dann lassen sich die Risiken schweizweit vergleichen. Leider wird es aber nicht möglich sein, die Gefährlichkeit einer Autobahnstrecke infolge Naturgefahren direkt mit derjenigen eines Tunnels zu vergleichen. Das Astra-Forschungsprojekt «Sicherheit des Verkehrssystems Strasse und dessen Kunstbauten» (AGB1)[4] hat nämlich klar gezeigt, dass dafür gleiche Systemabgrenzungen und gleiche Annahmen in der Risikoanalyse nötig wären. Risiken, ausgedrückt in Franken pro Jahr, sind und bleiben statistische Zahlen, die innerhalb ihres Bereiches auf eigene Art und Weise entstanden sind. In diesem Rahmen müssen sie auch interpretiert werden. Theoretische Methoden, die den Vergleich von verschieden Risikotypen ermöglichen, stehen allerdings schon jetzt zur Verfügung. Ihre praktische und netzweite Umsetzung lassen aber noch auf sich warten.
Anmerkungen:
[01] Risikokonzept Naturgefahren Nationalstrassen,2009. Download: www.astra.admin.ch > Dienstleistungen > Fachdokumente für National- und Hauptstrassen > 9 Risiko- und Sicherheitsmanagement
[02] Strategie Naturgefahren, Synthesebericht, Planat, 2004
[03] Die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird mit der Wiederkehrdauer von 0 bis und mit 10 Jahren, > 10 bis und mit 30 Jahren, > 30 bis und mit 100 Jahren, > 100 bis und mit 300 Jahren angegeben
[04] Das Forschungsprojekt AGB1 fand im Rahmen der nationalen Strassenforschung 2005–2009 statt. Initiiert wurde es durch die Arbeitsgruppe Brückenforschung (AGB). Ziel war es, Entscheidungsgrundlagen und Methoden bereitzustellen, um mit den vorhandenen finanziellen Mitteln die erforderlichen Sicherheitsstandards über das gesamte Verkehrssystem Strasse inkl. Kunstbauten sicherzustellen.TEC21, Fr., 2009.07.31
31. Juli 2009 Luuk Dorren, Philippe Arnold