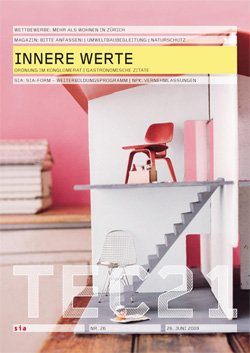Editorial
Bei einem Puppenhaus liegt der Fokus auf den Innenräumen: Um es bespielbar zu machen, werden die Aussenwände entfernt, die Räume ausgestaltet und en miniature möbliert – manchmal auch mit Designermöbeln. Das Spiel bildet die Realität ab und weist darauf hin, dass unser Leben primär innerhalb von Gebäuden stattfindet. Gleichzeitig wird dabei deutlich, dass sich Innenräume leichter neuen Inhalten anpassen lassen als die eigentliche, konstruktive Hülle eines Baus. Kurz: Während ein Gebäude hierzulande von aussen teilweise über Jahrhunderte nicht wesentlich verändert wird, findet im Inneren oft ein reger Wechsel an Nutzungen und dementsprechenden Neugestaltungen statt. Dass die gebaute Substanz eine längere Haltbarkeit besitzt als die sich immer schneller wandelnden Inhalte, spricht für die Qualität der Gebäude, bedeutet aber auch, dass Aus- und Umbauten einen immer grösseren Anteil des Bauvolumens der Schweiz ausmachen. Deren Anteil an den Gesamtausgaben hat sich seit Mitte der 1980er-Jahre von knapp einem Viertel auf gut 40 % erhöht, Tendenz weiterhin steigend. Wie bei energetischen Sanierungen, die meist an Fassade und Dach durchgeführt werden, ist bei Eingriffen im Innenbereich ästhetisches, aber auch kulturelles und historisches Verantwortungsbewusstsein gefordert.
Dieses Heft ist zwei Um- und Ausbauten im Gastronomie- und Hotelleriebereich gewidmet. Diese Art des Gebrauchs scheint prädestiniert zu sein für die Umnutzung von bestehender Bausubstanz: Einerseits ist deren Halbwertszeit deutlich niedriger als bei anderen Nutzungen. Anderseits scheinen wir gerade an Orten, an denen wir uns als Gäste aufhalten, die Geborgenheit des Gewachsenen zu schätzen. Das zeigt auch der Umbau eines Dienstgebäudes an der Gessnerbrücke in Zürich. Das ehemals massige Betonvolumen wurde mittels eines grosszügigen Fassadeneingriffs an drei Seiten geöffnet und dient seither als Bistro-Café – italienische Atmosphäre inklusive. Trotz dem deutlichen Eingriff wurde auf Kontinuität gesetzt und mit bestehenden und neuen Elementen ein stimmiges Ganzes geschaffen. Ein ähnliches Vorgehen kam auch bei Umbauten in der Kartause Ittingen zum Tragen. Die Klosteranlage ist ein Konglomerat aus Bauteilen verschiedenster Epochen. Während bei der Erneuerung der Gästezimmer im Oberen Gästehaus der Fokus primär auf einer Modernisierung der Räume bei minimaler Eingriffstiefe lag, war beim Restaurant aufgrund betrieblicher Anforderungen ein Anbau und damit ein sichtbarer Eingriff an der Aussenseite unvermeidbar. Bei beiden Beispielen wurden die inneren Werte des Bestands nicht nur erhalten, sondern durch die Interventionen noch gesteigert.
Tina Cieslik
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Mehr als Wohnen in Zürich
13 MAGAZIN
Bitte anfassen! | Forum Umweltbaubegleitung | Grenzüberschreitender Naturschutz | «Promenade ferroviaire» zur Neat
20 ORDNUNG IM KONGLOMERAT
Christian Mueller Inderbitzin
Die Kartause Ittingen hat eine fast 900-jährige Baugeschichte. Die jüngsten Umbauten betreffen im Wesentlichen das Restaurant und das Obere Gästehaus.
27 GASTRONOMISCHE ZITATE
Tina Cieslik
Revitalisierung am Brückenkopf: Ein ehemaliges Werkgebäude wurde in Zürich zur Bar umgebaut und verneint mittels innenarchitektonischer Zitate eine Verortung im Zeitgeist.
32 SIA
SIA-Form: Weiterbildungsprogramm | Krankenkassen-Sparmodelle | NPK: Vernehmlassungen | 10. Contractworld Award
36 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Ordnung im Konglomerat
Nach sechsmonatiger Bauzeit ist die Kartause Ittingen an Ostern wiedereröffnet worden. Erneuert wurden im Wesentlichen ein Seminar- und Gästehaus sowie die Restauration im Zentrum der Klosteranlage. Die baulichen Eingriff e der Zürcher Architekten Harder Spreyermann umfassen nicht nur notwendig gewordene Modernisierungen, sondern verleihen der Gesamtanlage ein neues Gepräge. Das Projekt zeigt eindrücklich, wie sich zeitgenössische Architektur in historischer Bausubstanz diskret behaupten kann.
Die Kartause Ittingen, auf einer Geländeterrasse am Südhang des Thurgauer Seerückens gelegen, ist seit ihrer Umnutzung durch eine private Stiftung Ende der 1970er-Jahre zu einer der wichtigsten öffentlichen Institutionen des Kantons Thurgau geworden. Das um 1150 vom Augustinerorden gegründete Kloster ist in seiner über 800 Jahre dauernden Geschichte mehrfach zerstört, wieder auf-, um- und weitergebaut worden. In der wechselhaften Baugeschichte spiegeln sich die jeweiligen Nutzungsansprüche der Zeit: so in den baulichen Ergänzungen für das Eremitenleben der Kartäusermönche nach dem Verkauf der Anlage an deren Orden oder in den Anpassungen an die säkulare Nutzung als Gutsbetrieb nach 1867. Nach dessen Aufgabe wurde 1977 eine Stiftung zur Rettung des Klosters gegründet. Aus dem neuen Betriebskonzept resultierten zwischen 1977 und 1983 weitere Neubauteile, ausgeführt durch das Zürcher Architektenpaar Esther und Rudolf Guyer. Heute beherbergt die Kartause ein Bildungs- und Seminarzentrum mit zwei Hoteltrakten und rund 70 Zimmern, das kantonale Kunstmuseum, das historische Ittinger Museum, ein Wohnheim für rund 30 psychisch oder geistig Beeinträchtigte, einen Gutsbetrieb mit Klosterladen sowie das Restaurant «Zur Mühle» im Zentrum der Anlage.
Nach einem Studienauftrag unter drei Büros lösten Harder Spreyermann das Ehepaar Guyer 2004 als neue Hausarchitekten ab. Die ehemalige Herberge wurde daraufhin zum Unteren Gästehaus umgebaut und der Gastrobereich modernisiert. Im Herbst 2008 wurden die grössten Umbau- und Erweiterungsarbeiten seit der Stiftungsgründung in Angriff genommen. Sie umfassten die Restauration, das Obere Gästehaus und Seminar, das Wohnheim sowie den Eingangsbereich der beiden Museen. Die Architekten haben in enger Zusammenarbeit mit Bauherrschaft und Denkmalpflege für jeden Eingriff eine angemessene entwerferische Strategie entwickelt. Nach nur sechsmonatiger Bauzeit konnte die Kartause am 9. April diesen Jahres wiedereröffnet werden. Für eine sorgfältige Umsetzung in der kurzen Bauzeit war entscheidend, dass das Büro die Bauleitung selbst führte.
Justierungen im oberen Gäste- und Seminargebäude
Beim Oberen Gästehaus und Seminar – dem architektonisch wohl bedeutendsten «Neubau» in der Kartause, erstellt 1978 vom Architektenpaar Guyer – haben sich die Eingriffe im Wesentlichen auf den Innenausbau der drei Bereiche Eingangshalle, Erschliessungszonen und Gästezimmer beschränkt. Absicht der Architekten war es, die zeittypische Qualität der Bauten zu respektieren und sie ungeachtet ihres geringen Alters als Denkmäler ihrer Entstehungszeit zu verstehen. Die egalitäre Auffassung der bestehenden Bausubstanz erscheint zeitgemäss und im Kontext der Kartause folgerichtig.
Dieser Auffassung folgend sind die Eingriffe beim Gäste- und Seminargebäude zunächst kaum wahrnehmbar. Im Seminargebäude wurden denn auch lediglich Textilien und Mobiliar erneuert sowie Malerarbeiten ausgeführt. Der Betrieb des Gästehauses verlangte nach zusätzlichen Arbeiten. Doch auch hier sind sie zurückhaltend und integrativ entwickelt worden. Mehr noch: Sie versuchen dem intendierten Charakter nachzuspüren und diesen in einer reineren Form herauszuschälen. Das wird bereits im Foyer ersichtlich, wo die Architekten durch den Rückbau des Postbüros der zweigeschossigen Halle ihre angemessene Grösse zurückgegeben und die darüberliegende Galerie räumlich befreit haben. Die vom Künstler Christoph Rütimann entworfene, über die gesamte Räumhöhe laufende Worttapete (Passeport- par-tout) stärkt die Vertikalität der Halle (Abb. 5). Sie steht in ihrer räumlichen Wirkung zudem in Verbindung zur Farbgestaltung im Unteren Gästehaus aus dem Jahr 2004 von Harald F. Müller.
Die von der Halle abgehenden Erschliessungskorridore genügten den heutigen Brandschutzanforderungen nicht mehr. Die Architekten haben deshalb die bestehenden Erker zur Klostermauer hin erhöht und mit zusätzlichen Fluchttreppen ergänzt (Abb. 06). Die Materialisierung mit weiss vergipsten Wänden und naturbelassenem Fichtenholz sowie einer zum Bestand analogen Befensterung lassen auch diese Bauteile erst auf den zweiten Blick als Ergänzungen erkennen. Im Dachgeschoss machte eine Verbesserung der Entrauchung eine galerieartige Verbindung mit dem 1. und 2. Obergeschoss möglich, die vorher räumlich getrennt waren. Es wurde damit nicht nur ein technisches Problem gelöst, sondern vielmehr die angelegte spezifische Schnittfigur des Korridorbereichs freigelegt.
Klösterliche Zellen
Der dritte Schwerpunkt der Sanierung betrifft die Gästezimmer. Obschon diese umfassend erneuert werden mussten, wurde auf Eingriffe an Fassade und Rohbau verzichtet, wie sie für eine ausreichende akustische Trennung nötig gewesen wären. Für die Doppelzimmer im 1. und 2. Obergeschoss und die Einzelzimmer im Dachgeschoss sind jeweils eigene Themen entwickelt worden: In den Doppelzimmern folgt der Entwurf einer konsequenten Ausrichtung auf den Aussenraum, die durch eine vollflächige Verglasung der Zimmer angelegt ist. Dazu wurde das Bett frei gestellt und zum Fenster hin ausgerichtet (Abb. 10). Die Kombination von Bett und Tisch in einem Möbel führt zu einer dem «klösterlichen Leben» entsprechenden, fast spartanischen räumlichen Leere. Badzugang, Schränke und Fernseher sind hinter massiven, von Zapfenbändern gehaltenen Holzpaneelen mit eingefräster Griffnut versteckt. Die mit Glattputz überzogenen Wände und Decken sind weiss gestrichen, auf dem Boden wurden Lärchenholzriemen verlegt, die mit den bestehenden Naturholzfenstern korrespondieren. Die dunkelbraunen, fugenlosen Zementbeläge auf den Böden und Wänden der Bäder kontrastieren mit den hellen Zimmern. Die Sanitärapparate wurden sorgfältig ausgewählt und entsprechen dem erwarteten Standard. Ihre Anordnung ist beibehalten worden. Die Einzelzimmer im Dachgeschoss sind analog den Doppelzimmern materialisiert. Aufgrund der räumlichen Enge unter der Dachschräge musste aber ein alternatives Thema entwickelt werden. Die Architekten entwarfen eine Wand- und Deckenabwicklung, die mehrere Nischen bildet und so den Raum gliedert: Jedes Zimmer verfügt über eine seitliche Bettnische, eine Arbeitsnische unter der Schleppgaube sowie eine Schranknische. Einzig hier wurden neue, sprossenfreie Fenster eingesetzt, die bildhafte Ausblicke in den Klostergarten rahmen.
Verschränkungen zwischen Alt- und Neubauteilen
Der Umbau und die Erweiterung der Restauration waren aufgrund des Umfangs des Eingriffs und ihrer Bedeutung im Zentrum der Gesamtanlage anspruchsvoller. Die vorhandene Fläche reichte nicht mehr aus, und es war eine räumliche Differenzierung gemäss dem Gästeprofil der Kartause gewünscht: Neben Seminar- sollten auch Einzelgäste und Gesellschaften bewirtet werden können. Im Zentrum des Entwurfsprozesses stand zunächst die Frage nach dem Umgang mit dem denkmalgeschützten Mühlgebäude. Da dieser Bau insbesondere im nördlichen Teil schon mehrfach umgebaut wurde und der offene Durchgang mit seinen massiven Holzpfeilern (Abb. 14) im Bereich der Kornschütte als das spezifischste, weil Gestalt gebende Gebäudeelement betrachtet wurde (eine Verglasung der Halle stand einige Zeit zur Diskussion), entschied man sich, die Gebäudeteile um das Mühlrad und die Pfisterei vollständig abzubrechen und den Neubauteil an derselben Stelle zu erstellen, was als eigentliche Revision bisheriger denkmalpflegerischer Absichten gesehen werden muss. Die Architekten suchten für die verlangte Erweiterung des Restaurants nach einem Volumen, das sich aus dem bestehenden Mühlgebäude heraus entwickelt und ein Weiterbauen am Bestand vorsieht. Zur Ausführung kam eine Lösung, deren Volumen als winkelförmiges Bauteil sozusagen aus dem Mühlgebäude «herauswächst». Bei der beabsichtigten Verschmelzung mit dem bestehenden Gebäude kommt dem Dach eine katalytische Funktion zu, indem es sich mit der Dachfläche des Mühlgebäudes direkt verbindet: Die Architekten sprechen von einer «Entfaltung». Die durchgehende Eindeckung mit alten Biberschwanzziegeln unterstützt diese Lesart, wenn auch ein Oberlicht und teilweise sperrige Spenglerarbeiten die Kontinuität der Dachflächen in Frage stellt. Die mehrfach geknickte Dachfläche lagert auf einer wiederum gefalteten Fassade. Diese besteht aus Pfosten mit dazwischengesetzten Fenstern, deren schräg laufende, ochsenblutfarben gestrichene Rahmen in Analogie zum Riegelwerk des Mühlgebäudes treten. Trotz der strukturellen Verwandtschaft von polygonaler Dachfläche, gefalteter Fassade und schräg laufenden Fensterrahmen behält jedes Element seine berechtigte Eigenständigkeit.
Im nördlichen Bereich verzahnt sich die Fensterfront mit einer eindrücklichen Sockelmauer, die sich mit der Topografie und im Innenraum mit dem Bestand verbindet. Die Verzahnung von Neu- und Altbauteilen funktioniert denn auch am überzeugendsten im Innenraum: Bestehende Sockelteile des Mühlgebäudes und ein neuer Körper mit den Toilettenanlagen formen zusammen mit der Sockelmauer und der Fensterfront eine vielgliedrige Grundrissfigur, die eine selbstverständliche, im Betrieb gut funktionierende räumliche Organisation ergeben. Im ausgreifenden Westflügel gegenüber der ehemaligen Pferdeschwemme befindet sich die neue Pfisterei, ein Saal zur Verpflegung von Seminargästen, der bei Bedarf auch abgetrennt werden kann. Die Wirtschaft, ein parallel zum Mühlgebäude laufender Raum, ist für Individualgäste reserviert und wird räumlich durch das alte Mühlrad dominiert, das durch ein Oberlicht zusätzlich inszeniert wird. Beide Räume orientieren sich über die verglasten Fassaden zur Gartenwirtschaft. Eine Gaststube für private Anlässe sowie ein Carnotzet verankern die Raumfigur rückwärtig im Altbau und verklammern sie mit dem zentralen Office mit Abwäscherei im Sockel des Mühlgebäudes. Die Gaststube gibt einen Blick in die aussen liegende «Säulenhalle» unter der Kornschütte frei, der durch die durchgehende Schrägstellung der Fensterrahmen allerdings etwas beeinträchtigt wird. Die bestehende Küche liegt im 1. Obergeschoss, und die neuen Infrastrukturräume für Technik, Kühlung, Lagerung und Entsorgung wurden unter den rückwärtigen Barockgarten gebaut. Ähnlich wie beim Gästehaus gelingt es hier, durch die Neuordnung eine beruhigende Klärung zu schaffen.
Polygonale Faltungen
Für den innenräumlichen Zusammenhalt der vier Bereiche sorgen eine durchgehende Gestaltung und Materialisierung der raumbildenden Oberflächen. Bestimmend ist eine zur äusseren Dachlandschaft «gegengleich» gefaltete Deckenuntersicht; der Zwischenraum nimmt die Haustechnik auf. Die Untersicht wurde mit einem Täfer verkleidet, das die traditionellen Holztäferungen wie diejenige im Refektorium des Klosters referenziert. Die Geometrie des Täfers aus einem polygonalen Netz aus Rahmen mit Füllungen, die als fein gelochte Akustikplatten fungieren, stammt von Geometrieingenieur Urs Beat Roth (vgl. TEC21, 16/2008) und beruht auf dem vorgegebenen Leuchtenraster. Das strukturelle Prinzip der Rahmen und Füllungen interferiert mit der nichtstrukturellen, weil plastisch modellierten Deckenfaltung. Diese Interferenz wird in der Diskrepanz zwischen der Hochpräzision in Planung und den bei der Ausführung in Kauf zu nehmenden Ungenauigkeiten augenfällig: Durch die Schrägschnitte bestehen an den Knicken zwischen an sich fortlaufenden Rahmenteilen teilweise mehrere Zentimeter Differenz. Auch das optische Zusammenwirken mit den diagonal laufenden Fensterrahmen und der tektonische Übergang von Dach und Fassade scheinen unklar, da sich beispielsweise die Deckenverkleidung über die tragenden Pfosten der Fassade schiebt. Analog der Decke und in der Logik einer freien Grundrissentwicklung zieht sich auch der Boden, ein fugenloser, geschliffener Hartbetonbelag, durch alle Raumbereiche. Die Sockelmauern wurden mit einem grauen, ausgesiebten Kalkgrundputz überzogen. Zusammen mit dem schlichten, dunkelrot gebeizten Mobiliar schafft die Materialität des Innenraums eine kühle, elegante Stimmung.
Der Aussenraum ist klarer artikuliert als zuvor und erhält seine neue Prägung fast ausschliesslich durch die Architektur. Der vordere Kiesplatz der Gartenwirtschaft wird durch die winkelförmige Volumetrie gefasst und durch die Neuplatzierung des Laurentiusbrunnens zentriert. Sämtliche Fenster des Restaurants können nach aussen hin geöffnet werden und schaffen in der warmen Jahreszeit eine adäquate Durchlässigkeit zwischen Aussen- und Innenraum. Der rückwärtige Barockgarten erhielt mit dem Unterbau der Infrastrukturräume eine Klärung, indem er durch den Bau eine Sockelmauer mit Treppenaufgang als Parterre stärker gefasst wurde.
Gleichgewichtszustände
Bei allen besprochenen Projektteilen ist es den Architekten gelungen, eine jeweils spezifische, dem Vorhaben angemessene Lösung zu entwickeln. Während die Eingriffe im oberen Gästehaus ihr Gleichgewicht in einer Stärkung des ursprünglich intendierten Charakters respektive der räumlich angelegten Disposition finden, geht das Projekt der Restauration – seiner Bedeutung in der Gesamtanlage entsprechend – einen Schritt weiter und schafft es, der Kartause als Ganzer ein neues Gepräge zu geben. Die besondere Leistung besteht dabei in der Selbstbehauptung der Architektur im Spannungsfeld von Betrieb und Denkmalpflege, wobei die Neuordnungen und Klärungen niemals die gewachsene, konglomerate Ordnung der Kartause in Frage stellen.TEC21, Fr., 2009.06.26
26. Juni 2009 Christian Inderbitzin
verknüpfte Bauwerke
Unteres Gästehaus Kartause Ittingen