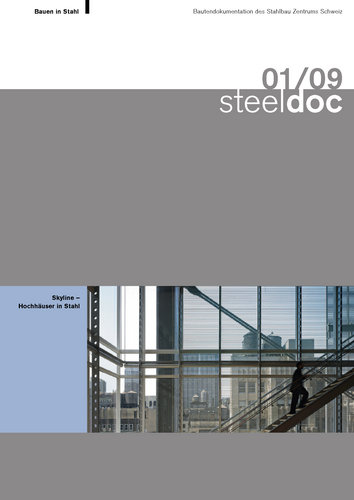Editorial
In der Schweiz werden derzeit gegen zwanzig Hochhäuser geplant. Obwohl Stahl für den Bau in die Höhe geradezu prädestiniert wäre, erfolgt die Realisierung meist mit anderen Baustoffen. Während in den Vereinigten Staaten, in England sowie in den Metropolen der «Neuen Welt» wie Kuala Lumpur, Shanghai oder Dubai Hochhäuser traditionell in Stahl gebaut werden, gibt es hierzulande bisher kaum Beispiele in Stahl – mit Ausnahme des Messeturmes in Basel oder des Swisscom-Hochhauses am Bahnhof Winterthur. Warum das so ist, beantwortet in diesem Heft der Architekt Rolf Läuppi, den Steeldoc zu einem Interview getroffen hat.
Die Stahlbauweise bietet nämlich insbesondere für den Hochhausbau ebenso wirtschaftliche wie nachhaltige Lösungen an. Nebst den effizienten Spannweiten und der Flexibilität der Nutzung ist die zugängliche Leitungsführung im Stahlbau ein Vorteil, der sich auch längerfristig für den Bauherrn auszahlt. Ein Stahlbau ist durch die Vorfertigung der Bauteile und die trockene Bauweise wesentlich schneller gebaut. Er ist zudem leichter als ein Massivbau und braucht deshalb weniger Fundamente. Die Trennbarkeit und Rückbaubarkeit der Bauteile ist punkto Nachhaltigkeit ein wesentliches Plus, das mittlerweile auch in Ökobilanzen zu Buche schlägt. Günstiger wird auch der Fassadenbau, denn Fassadenelemente können im Stahlbau einfach in die Stahlstruktur eingehängt werden, ohne zusätzliche Unterkonstruktion. Ein Gerüst entfällt, weil ja das Stahlskelett selbst schon ein Gerüst ist. All diese Vorteile lassen sich an einem Hochhaus exemplarisch darstellen.
Die Planung von Hochhäusern bedingt die Mitwirkung von spezialisierten Bauingenieuren für die Berechnung der Lasten und Verformungen des Tragwerks. Vor allem in den USA wurde der Skelettbau zur sogenannten Rohrbauweise weiterentwickelt. Insbesondere seit 9/11 werden diese Tragsysteme redundant ausgelegt, um die Sicherheit im Falle eines Brandes oder Erdbebens zu erhöhen. Innovative Entwicklungen gibt es im Bereich Energie-Effizienz und Komfort der Fassadensysteme. Doppelhautfassaden entflechten die äussere Gebäudehülle vom Raumabschluss, so dass die Pufferzone zur Klimatisierung dient. So können Hochhäuser zu grünen, vertikalen Städten heranwachsen, die sich energetisch selbst versorgen. Dies ist vor allem für asiatische Megastädte eine realistische Perspektive.
All diese Aspekte sind in den hier dokumentierten Projekten wiederzufinden. New York verkörpert auch heute noch die Superlative im Hochhausbau. Im vorliegenden Heft richtet sich der Blick deshalb nach Amerika, aber auch ins benachbarte Europa. Steeldoc zeigt im Detail, wie Hochhäuser in Stahl gebaut werden.
Evelyn C. Frisch
Inhalt
03 Editorial
04 Interview
Ohne Stahl kein Hochhaus
08 New York Times Building, New York
Modern Times
14 Nicolas G. Hayek Center, Tokio
Luxuriöser Hochstapler
18 Hearst Tower, New York
Facettenreicher Imageträger
22 Net Center, Padua
Raffinierte Schichtung
26 FiftyTwoDegrees, Nijmegen
Blickfang mit Knick
31 Impressum
Ohne Stahl kein Hochhaus
Der Schweizer Architekt Rolf Läuppi gilt als Pionier in der Entwicklung von Hochhäusern in Stahl. Was ihn besonders interessiert ist die Nachhaltigkeit von Bausystemen. In einem Gespräch mit dem Stahlbau Zentrum Schweiz antwortet er auf die Frage, weshalb in der Schweiz nicht häufiger in Stahl gebaut wird.
Stahlbau Zentrum Schweiz: Die aktuelle Hochhausdiskussion in der Schweiz widerspiegelt ein gesellschaftliches Bedürfnis. Sind Sie ein Verfechter von Hochhäusern für die Schweiz?
Rolf Läuppi: Hochhäuser sind in erster Linie Imageträger. Man baut Hochhäuser in eine Stadtlandschaft, um Akzente zu setzen und um Investoren eine Möglichkeit für ihre Corporate Identity zu bieten. Im Sinne einer Verdichtung mit Zentrumsfunktion sind hohe Häuser zwar sinnvoll, wie zum Beispiel in der City von Frankfurt, aber in Schweizer Städten verträgt es meiner Meinung nach keine wirklichen Wolkenkratzer. Ein Hochhaus muss in einer vernünftigen Relation zu der Umgebung stehen. Dies wiederum heisst, dass Hochhäuser in der Schweiz meist zu klein geraten.
Sie meinen, die Hochhäuser in der Schweiz müssten aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus eigentlich höher sein? Gibt es denn einen Break Even Point der Höhe?
Der Messeturm in Basel ist mit 120 Meter beispielsweise zu niedrig, um wirtschaftlich gut zu sein. Er sollte eigentlich 150 bis 200 Meter hoch sein. Es geht ja um die Gewinnung von Nutzfläche und da sind Faktoren wie die Anzahl der Kerne, die Ausbildung der Liftanlagen sowie die Erschliessung entscheidend. Bei einer Gebäudehöhe von 15 Geschossen müssen bereits alle Vorschriften für Hochhäuser erfüllt werden. Dies führt bei dieser Gebäudehöhe zu einem suboptimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bei etwa 50 Geschossen kann ein Optimum erreicht werden. Irgendwo bei 80 Geschossen hört die Wirtschaftlichkeit sowieso auf. Bei Rekord-Hochhäusern wie in Dubai spielt das aber alles keine Rolle. Dort steigt der Quadratmeterpreis mit zunehmender Höhe bis auf das Achtfache – und Investoren sind bereit, das zu bezahlen. Dort geht es eben um das Prestige, ganz oben zu sitzen.
Sie haben in Zürich mehrere grosse Überbauungen und Hochhäuser in Stahlbauweise vorgeschlagen. Wie erklären Sie sich, dass keines der geplanten Bauwerke in Stahl ausgeführt wurde?
Lassen Sie mich zuerst etwas Allgemeines zum Stahlbau sagen. Mit Stahl bauen fängt im Kopf an: die Fragestellungen sind klar zu formulieren, die Anforderungen an das Raumprogramm und die Abläufe im Gebäude zu strukturieren und alles ist in eine entsprechende Planung umzusetzen. Bauen mit Stahl verlangt Disziplin – dies betrifft auch den Bauherrn. Er muss die Vorteile des Stahlbaus und seine Gesetzmässigkeiten kennen. Es gibt Gebäude, die sich speziell für den Stahlbau eignen, z.B. jene, die den Gesetzmässigkeiten des Materials entsprechen und die sich einfach über ein Raster strukturieren lassen.
Was sind denn diese Gesetzmässigkeiten beim Stahlbau?
Die klare Trennung von Tragstruktur und Ins tallation zum Beispiel. Man sollte nie mit Lüftungen, Installationen etc. ins Tragsystem eingreifen, wie das meistens bei Betondecken gemacht wird. Auch das bedeutet Nachhaltigkeit! Was mache ich mit einem Be tonbau, bei welchem neben der Armierung auch noch die Leerrohre etc. eingelegt werden? Was geschieht damit beim Rückbau? Es muss mühsam und aufwendig getrennt werden, kostet Zeit und Energie und verursacht Emissionen durch Staub. Hinzu kommt der rasante Wandel bei der IT-Technik und der Elektroinstallation. Es ist nicht sinnvoll, die Leitungen fest zu verlegen, respektive in den Beton einzugiessen. Beim Stahlbau ist alles von vornherein bereits getrennt. Dies zeigt einmal mehr, wie effizient sich ein Gebäude über die Jahre nutzen lässt, wenn die dem Material immanenten Gesetzmässigkeiten eingehalten werden.
Hochhäuser würden sich also für die Stahlbauweise besonders eignen?
Ja klar. Für Stahl spricht zum Beispiel, dass zu jeder Jahreszeit gebaut werden kann, weil die Nachlaufzeiten für das Austrocknen wie bei der Betonbauweise weitgehend entfallen. Während oben das nächste Geschoss errichtet wird, kann im Erdgeschoss bereits mit der Montage von Fassaden begonnen werden. Zudem werden keine Gerüste benötigt, da die Fassadenelemente in die Stahlkonstruktion eingehängt werden. Diese Elemente können aufgrund der geringen Toleranzen im Stahlbau vorgefertigt und zum Termin der Montage angeliefert werden. So wies beispielsweise der Messeturm in Basel bei einer Höhe von 120 Meter lediglich eine Gesamtabweichung von 1 Millimeter pro Geschoss auf. Für die Fassade waren keine Justierschrauben notwendig.
Ihre eigenen Hochhausplanungen in Stahl konnten Sie nur im Mobimo-Tower in Zürich verwirklichen. Der Bau ist heute 8 Jahre alt. Wie beurteilen Sie das angewendete Bausystem aus heutiger Sicht?
Das Mobimo-Hochhaus ist immer noch beispielhaft. Es zeigt, dass man Minergie-Standards auch mit Stahl erreichen kann. Das ursprüngliche Hochhaus aus den 70er-Jahren war ja schon ein Stahlbau, weshalb sich die Aufstockung von 3 Geschossen in Stahl leicht umsetzen liess. Dem Gebäude wurde eine Doppelfassade als Energiegewinnungsanlage vorgehängt. Im Sommer dient diese Schicht als Klimaanlage. Vorbildlich war die Trennung von Tragwerk und Gebäudeinstallationen. Beim Mobimo-Tower haben wir einen klassischen Stahlbau mit Holorib-Decken. Alle Installationen wurden unten abgehängt. So konnte der gesamte technische Ausbau innert kürzester Frist ersetzt und aufgerüstet werden. Die Technikzentrale kam in den Keller und oben konnte man Nutzfläche gewinnen. Mit Stahl lassen sich Struktur und Installation klar trennen, was sich mittelfristig für den Bauherrn auszahlt.
Sie haben das Business Center Andreaspark in Zürich komplett in Stahl geplant. Ausgeführt wird es in Beton. Wieso?
Die Stahlvariante war etwas teurer. Diese Kosten wären durch die Vorteile der Stahlbauweise auf anderen Gebieten wieder wettgemacht worden. Nach dem Aufrichten der Stahlstruktur und der Montage der Slim-Floor-Decken hätten die Fassadenelemente lediglich eingehängt und der Doppelboden montiert werden können. Somit wäre das Gebäude innert kürzester Frist bezugsfertig gewesen! Das zeigt, wie kurzfristig man auch heute noch kalkuliert: es zählt einfach der Preis bei der Auftragsvergabe. Ich bin sicher, dass die Ausführung in Beton am Ende teurer zu stehen kam. Interessant wäre hier die Gegenüberstellung des Vorprojektes in Stahl mit der Ausführung in Beton. Vor allem auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit!
Stichwort Nachhaltigkeit. Sie gelten als Pionier des nachhaltigen Bauens. Wie weit sind wir heute damit?
Ich habe schon vor 20 Jahren nachhaltige Gebäude in Stahl entwickelt. Am Ende wurden alle Projekte in Beton ausgeführt, weil die Betondecke pro Quadratmeter etwas billiger war. Die Vorteile der Stahlbauweise sind ja nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch ökologisch von Bedeutung. Stahl ist ein Recyclingprodukt, die Bauweise ist leicht, flexibel, einfach demontierbar und äusserst materialoptimiert – beim Stahlbau kommen nur so viele Elemente auf die Baustelle, wie unmittelbar benötigt werden: keine Materialverschwendung! Weil beim Stahlbau vorausgedacht wird und man damit Planungs- und Fabrikations fehler, die teuer und ineffizient sind, vermeidet. Das zeigt sich auch im Unterhalt: die Konstruktion ist immer zugänglich und kontrollierbar.
Was braucht es, damit Investoren auch die ökologischen Vorteile des Stahlbaus nutzen?
Der Stahlbau war bis jetzt immer im Nachteil wegen der hohen Präzision, die er erfordert. Das bedeutet quasi eine Planungs-Investition, die keiner übernehmen will. Aber was uns in nächster Zeit beschäftigen wird, ist die Definition von standardisierten Bauteilen. Im Flugzeugbau ist es schon lange üblich, die Eigenschaften der Bauteile zu beschreiben, so dass jedes Element überall auf der Welt beschafft werden kann. Diese Situation werden wir auch im Bauwesen bekommen. In den skandinavischen Ländern und Amerika baut man bereits die ersten Gebäude nach diesem System. Das könnte der Durchbruch für den Stahlbau sein, weil man dann alles vorab definieren muss. Dabei wird auch eine ökologische Bewertung von Bauteilen verlangt, verbunden mit einer Deklaration woher die Produkte kommen, wie sie produziert werden, welches die Umweltauflagen sind.
Inwiefern ist das Zukunftsmusik für die Schweiz?
Ansätze dafür gibt es heute in der Schweiz mit dem Bauteilkatalog. Aber es fehlt eine Kontrollinstanz, die das fertige Objekt untersucht und bewertet. Das Ziel müsste ein Gebäudepass sein, z.B. müsste bei der Bauabnahme eine Thermographie geliefert und Bauschäden an der Aussenhaut bekannt gemacht werden. Ganz dringend muss der Energieverbrauch aufgeführt werden – auch bei einer Sanierung sollte der Passivhausstandard gefordert werden.
Energieeffizienz ist auch beim Hochhausbau ausschlaggebend. Gibt es den grünen Wolkenkratzer?
Das Business Center Andreas Park ist das erste als Passivhaus zertifizierte Hochhaus mit dezentraler Haustechnik und aktiver Kühlung. Bei der Simulation zeigte sich ganz klar, dass ein energieeffizientes Gebäude mit Erdsonden nicht schwer, sondern leicht gebaut sein sollte.
Ich würde mir heute zutrauen, einen grünen Wolkenkratzer in Stahl zu bauen.Steeldoc, Mo., 2009.03.09
09. März 2009 Evelyn C. Frisch, Johannes Herold
Raffinierte Schichtung
(SUBTITLE) Net Center, Padua
Als Bauwerk von «europäischem Format» gestaltete der Schweizer Architekt Aurelio Galfetti das North East Tower (Net) Center in Padua. Herzstück des multifunktionalen Gebäudekomplexes ist ein expressives Hochhaus, das mit seiner dynamischen Form und der signalroten Farbe ein weithin sichtbares Zeichen setzt.
Das Net Center liegt an der Via San Marco, einer der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt, die das Messezentrum mit der Innenstadt verbindet. Eine gegenüber dem Strassenniveau um eineinhalb Meter erhöhte Plattform mit einer Fläche von 15 000 m² wird zur Bühne für das städtebauliche Konzept von Aurelio Galfetti: Ein weiter urbaner Platz, der die gebauten Strukturen gut sichtbar in Szene setzt und Raum für Begegnung sowie Austausch bietet. Der dunkle Schieferbelag der Plattform reicht bis in die Erdgeschosse aller Gebäude hinein und verbindet so Innen- und Aussenraum.
Der «Torre rossa» genannte Turm dominiert das Ensemble in der Vertikalen und wird flankiert von zwei langestreckten Baukörpern, dem «Palazzo Tendenza» und dem «Palazzo Economia». Ein gläsener Pavillon, in dem Ausstellungen und andere Veranstaltungen stattfinden, schliesst den Platz, der ausschliesslich Fussgängern vorbehalten ist, im Norden ab.
Signalwirkung
Mit seinen verwundenen Fassaden schraubt sich der «Rote Turm» über 20 Stockwerke auf eine Höhe von 80 Meter. Die untere Hälfte des Turmes beherbergt ein Hotel mit über 140 Zimmern, der obere Teil ist Büroräumen für Finanz- und Beratungsunternehmen vorbehalten. Die dynamische Form des Gebäudes resultiert aus der schrittweisen Abwandlung der Trapezform des Grundrisses in jedem Stockwerk, welche durch die Anordnung horizontaler, rot beschichteter Sonnenschutzelemente noch präzisiert wird. Obwohl der vollständig verglaste Turm die übrigen, in silber und schwarz gehaltenen Gebäude weit überragt, ist die gestalterische Einheit des Ensembles durch die horizontale Gliederung der Fassaden gegeben.
Geneigte Stützen
Die Tragstruktur des Towers besteht aus einem Stahlbetonkern und einem äusseren Ring aus geschweissten Doppel-T-Trägern, der von insgesamt acht runden Stahlstützen getragen wird. Die Deckenelemente aus Leichtbeton liegen auf diesem Stahlring auf. Damit die vertikalen Lasten gleichmässig abgetragen werden können, folgen die vier Randstützen in den diagonalen Achsen der veränderlichen Form der Gebäudehülle und sind um etwa 6 Grad gegenläufig geneigt. In den Mittelachsen dagegen stehen die Stützen senkrecht. Die Aussteifung erfolgt über Fachwerkverstrebungen im obersten Geschoss des Towers. Die diagonal gegenläufigen Stützenachsen in den Gebäudeecken sowie der als steifer Rahmen wirkende Stahlring in jedem Geschoss tragen ebenfalls zur Stabilisierung bei. Geschützt wurde die Stahlstruktur durch eine Brandschutzbeschichtung, die je nach Materialstärke variiert. Tiefgründungen mit Scheidewänden und zwei Meter dicken Verbindungsplatten aus Stahlbeton gewährleisten die gleichmässige Verteilung der Lasten, die aus dem zentralen Kern und den acht Rundstützen in die Fundamente eingeleitet werden.
Gefächerte Fassadenstruktur
Der Turm ist vollständig verglast. Die weit auskragenden, horizontalen Sonnenschutzelemente unterteilen die Gebäudehülle in drei gleich hohe Fensterbänder pro Stockwerk. Die Sonnenschutzelemente liegen auf Fassadenstützen im Abstand von 1,30 Meter auf und gehören gleichzeitig zur tragenden Fassadenstruktur. Während die Fassadenelemente an den Schmalseiten der Fassade übereinander angeordnet sind, ergibt sich an den Längsseiten eine durch die Verdrehung und Neigung der Gebäudehülle bedingte Abstufung der Fassadenelemente. Diese Abstufung konnte durch die Tiefe der Sonnenschutzelemente so ausgeglichen werden, dass in der Gebäudeform eine fliessende Bewegung bleibt.Steeldoc, Mo., 2009.03.09
09. März 2009 Martina Helzel, Anne-Marie Ring
Blickfang mit Knick
(SUBTITLE) FiftyTwoDegrees, Nijmegen
Der Knick ist gewollt – einmal in Anspielung auf die ungewöhnlichen Ideen, die hier umgesetzt werden, zum anderen in Anspielung auf den 52sten Breitengrad, an welchem Nijmegen liegt. Das Forum für den weltweiten Austausch und die Zusammenarbeit von Technologie und Wissenschaft setzt auf den anderen Blickwinkel.
Das mit 86 Meter zurzeit höchste Gebäude von Nijmegen wurde in direkter Nachbarschaft der hermetisch abgeriegelten Produktionsanlagen für Halbleiter errichtet. Der Büroturm mit der gepixelten Fassade und dem charakteristischen «Knick» markiert den ersten Bauabschnitt des Business Innovation Centers. Mit dem ehrgeizigen Projekt setzt das Unternehmen einen starken Impuls für die lokale Wirtschaft und wertet gleichzeitig die Region um die benachbarten Städte Nijmegen und Arnheim auf.
Aus dem Lot
Eine zum Büroturm hin ansteigende, begrünte Dachfläche verbindet FiftyTwoDegrees optisch mit dem benachbarten Goffertpark. Die dreigeschossige Stahlkonstruktion am Fusse des Hochhauses bietet auf ihren beiden unteren Ebenen Parkplätze für knapp 600 Autos und beherbergt die Versandräume. Die obere Ebene, eine eingeschnittene «Plaza» mit Restaurant und Laden, ist als Erschliessungs- und Verbindungsebene aller Gebäudeteile konzipiert. Über diesen Sockelbau erhebt sich, abgesetzt durch ein Fensterband hinter sichtbaren Aussenstützen, das Hochhaus mit einer Neigung von zehn Grad. Im 8. Obergeschoss geht die Konstruktion mit einem «Knick» in die Senkrechte über.
Der hohe Termindruck und die Notwendigkeit, aufgrund der Gebäudegeometrie Gewicht zu sparen, führten zu der gewählten Mischkonstruktion aus Beton und Stahl. Zwei von unten nach oben senkrecht durchlaufende Betonkerne, die vier Aufzüge, zwei Treppenhäuser und Installationsschächte aufnehmen, wurden mittels einer Gleitschalung erstellt.
Schlanke Konstruktion
Die Stützenabstände der knapp 1300 Quadratmeter grossen Geschossflächen betragen in Querrichtung 3 x 7,20 Meter und in Längsrichtung 1 x 7,20 Meter, 4 x 10,80 Meter und 1 x 7,20 Meter. Weil der «Knick» im 8. Obergeschoss zu grossen horizontalen Kräften auf die Betonkerne führt, wurde der Stützabstand so bestimmt, dass die Lasten symmetrisch abgetragen werden können: zusätzliche schräggestellte Stahlstützen verlaufen von der Decke des 8. Geschosses zum Fusspunkt der innenliegenden Stützenreihe und somit spiegelbildlich zu den gegenüberliegenden Fassadenstützen. Durch die grossen Stützenabstände und die Lage der Betonkerne können die 17 Stockwerke maximal ausgenutzt sowie Büroräume und Laboratorien flexibel aufgeteilt werden. Während die Lage der Grundrisse in den oberen zehn Etagen identisch ist, sind die darunter liegenden Ebenen jeweils versetzt zu den Betonkernen angeordnet.
Die flache Deckenkonstruktion besteht aus Doppel-T-Profilen und THQ-Trägern (Hut-Profilen). Der Anschluss der Träger an die Betonkerne erfolgte über Stahlschuhe, die flächenbündig in die Wand einbetoniert sind. Die auf dem verbreiterten Untergurt der Stahlprofile aufgelagerten Spannbeton-Fertigdeckenelemente wurden vor Ort lediglich mit einem Estrich versehen.
Megapixel
Um den Baufortschritt weiter zu beschleunigen, kam ein vorgefertigtes Fassadensystem zum Einsatz. Die geschosshohen, vorgehängten Elemente sind an der Deckenkonstruktion befestigt. Das abstrakte graphische Fassadenbild setzt sich aus 1,80 x 0,80 Meter grossen «Pixeln» zusammen. Feststehende Isolierglasscheiben, mattschwarz eloxierte Aluminium-Sandwichpaneele und Kippflügel, deren Aussenseite mit matt schwarz beschichtetem Streckmetall verkleidet ist, damit die Öffnungen in der Fassade nicht sichtbar sind, bilden auf den ersten Blick ein willkürliches Muster. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man die durchlaufenden Bänder der geschlossenen Paneele entlang der Geschossdecken. Die Aussen wände der Büroräume und Laboratorien bestehen zu gleichen Teilen aus verglasten und geschlossenen Elementen.
Noch endet der grüne Hügel des Wissenschaftszentrums an einer vielbefahrenen Strasse. Der Brückenschlag soll mit dem zweiten Bauabschnitt erfolgen. Ein Kongresszentrum, ein Hotel- und Apartmentgebäude sowie Sportanlagen stehen zur Realisierung an und schaffen beste Voraussetzungen für ein lebendiges Miteinander von Arbeiten und Wohnen.Steeldoc, Mo., 2009.03.09
09. März 2009 Martina Helzel, Anne-Marie Ring