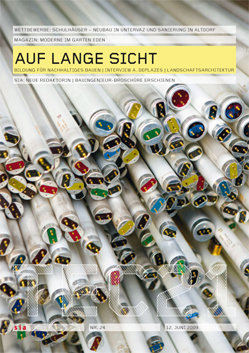Editorial
Der Begriff «Nachhaltigkeit» ist als Modewort, Kampfparole, Verkaufsargument und Propagandafloskel allgegenwärtig. Trotzdem oder gerade deshalb ist immer noch unklar, was unter nachhaltigem Bauen zu verstehen ist. Wer sich nicht auf eine mechanische Erfüllung von Normen, Standards und Vorschriften beschränkt, sondern versucht, alle Implikationen des Bauens ins Auge zu fassen, sieht sich schnell mit Widersprüchen konfrontiert. Die Isolation von Kaltdächern beispielsweise, ein positiver Beitrag sowohl zur urbanen Verdichtung als auch zur Energieeffizienz einzelner Gebäude, zerstört den Lebensraum diverser Lebewesen und gefährdet somit die Biodiversität (TEC21 11/2009); immer noch wird bei vielen Altbauten die ästhetische Qualität - und somit die kulturelle Nachhaltigkeit zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs vorschnell geopfert (TEC21 45/2008). Nachhaltiges Bauen setzt das Verständnis eines komplexen Systems unterschiedlichster Bedürfnisse, Sachzwänge und Zielsetzungen voraus. Diese gilt es projektspezifisch so in Einklang zu bringen, dass das Ergebnis auf lange Sicht bestehen kann: Denn was auch immer unter dem Schlagwort «Nachhaltigkeit» verstanden wird, Langfristigkeit ist immer impliziert.
Inwiefern ist die heutige Architekten- beziehungsweise Ingenieurausbildung in der Lage, die für eine nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraumes erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln? Wo besteht Handlungsbedarf? Wie gehen die Fachleute mit den gestiegenen Anforderungen um, und wie werden sich die entsprechenden Berufsbilder in Zukunft entwickeln? Diesen Fragen widmet sich der Tag der Berufsgruppe Architektur des SIA, der am 12. Juni 2009 mit der Tagung «Bildung für nachhaltiges Bauen - Disziplinen auf dem Prüfstand» an der ETH Zürich begangen wird. Dieses Heft präsentiert neben vier ausgewählten Referaten ein Gespräch mit Andrea Deplazes, das im Vorfeld der Tagung im Zusammenhang mit dem kürzlich publizierten SIA-Positionspapier «Bildung für eine nachhaltige Gestaltung des Lebensraums» stattgefunden hat.1 Der ETH-Professor und Präsident der SIA-Bildungskommission plädiert für eine Stärkung des dualen Bildungssystems der Schweiz und erläutert, warum es besonders gut geeignet ist, kompetente Baufachleute hervorzubringen - die wiederum dafür sorgen können, dass die Entstehung einer nachhaltigen Baukultur auf lange Sicht gesichert und nicht auf die lange Bank geschoben wird.
Judit Solt
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Schulhausneubau in Untervaz | Schulhaussanierung in Altdorf
13 MAGAZIN
Moderne im Garten Eden
18 KULTUR DER KOOPERATION
Thomas Lehmann, Claudia Schwalfenberg
Trotz allen Vorbehalten: Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist eine interdisziplinäre Teamarbeit für Baufachleute unerlässlich.
20 «NACHHALTIGKEIT IST KEINE GESONDERTE DISZIPLIN»
Judit Solt
Andrea Deplazes verteidigt das duale Bildungssystem und spricht über die unterschiedlichen Rollen von Forschung und Standards im nachhaltigen Bauen.
26 VON DER KARTOFFEL ZUR SOLARSIEDLUNG
Günther Vogt
Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur bedingt eine ortsbezogene Planung - Beispiele aus der Praxis und Rückschlüsse für die Lehre.
30 FLIESSENDE SCHNITTSTELLEN
Christian W. Blaser
Die Trennung von Innenarchitektur und Architektur in zwei Disziplinen ist nicht nachhaltig - weder für die Bauten noch für die Zukunft dieser Berufe.
33 SIA
Neue Redaktorin | Bauingenieur-Broschüre erschienen
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Kultur der Kooperation
Bauen ist immer Teamarbeit – für nachhaltiges Bauen, das sich durch hochkomplexe Anforderungen auszeichnet, gilt das ganz besonders. Architektinnen und Architekten, aber auch andere Planungsfachleute müssen deshalb frühzeitig lernen, was sie alleine können und wo sie besser Dritte einbeziehen. Gerade in wirtschaft lich schwierigen Zeiten führt kein Weg an einer interdisziplinären Teamarbeit vorbei. Einer entsprechend ausgerichteten Ausbildung kommt eine entscheidende Bedeutung zu.
Kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren eine ähnliche Karriere gemacht wie «Nachhaltigkeit». Das fängt an mit der politischen Agenda: Ob die jährliche Klimakonferenz der Uno oder Programme zur energetischen Gebäudesanierung in der Schweiz, an Nachhaltigkeit kommt keine Politikebene mehr vorbei. Auch die Auguren des Lebensstils haben die Nachhaltigkeit längst für sich entdeckt. Gaben sich die Ökos von gestern noch alternativ, konsumkritisch und bisweilen formlos, gelten die Lohas von heute als etabliert, kauffreudig und stilbewusst. Ihr «Lifestyle of Health and Sustainability» will beides: «Go green. Stay stylish.» Nachhaltig produzierte Textilien und schicke Mode sind für sie kein Widerspruch mehr. Dass Ansprüche an die Nachhaltigkeit von Produkten und an eine gute Form jetzt auch in der breiten Öffentlichkeit zusammengehen, kommt nicht zuletzt auch der Architektur zugute. So setzen viele Bauherrschaften eine weitgehende Reduktion des Energieverbrauchs und umweltschonende Wärmeerzeugung heute als selbstverständlich voraus, wünschen aber gleichzeitig ästhetisch überzeugende Raum- und Gestaltungskonzepte.
Neue alte Aufgabe
An sich ist diese Aufgabe für Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten, Raumplaner und Ingenieure nicht neu: «Schon immer stehen sie vor der Herausforderung, gestalterische, technische und wirtschaftliche Ansprüche in Einklang zu bringen», so das Anfang April 2009 vom SIA veröffentlichte Positionspapier «Bildung für eine nachhaltige Gestaltung des Lebensraums» (vgl. Kasten S. 19). In Zeiten des Klimawandels erhalte diese Kernkompetenz zusätzliches Gewicht: «Die anstehenden gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen erfordern ein Denken in hochkomplexen Systemen. Nachhaltigkeit erzielen heisst, den bestmöglichen Kompromiss zwischen den Forderungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zu finden und umzusetzen.» Neu an der alten Aufgabe nachhaltigen Bauens ist aber nicht nur der Grad der Komplexität. Neu sind auch immer anspruchsvollere Rahmenbedingungen wie zunehmende Geschwindigkeit, wachsender Kostendruck, verstärkte Konkurrenz durch Generalunternehmer und steigende Kundenbedürfnisse.
Drei goldene regeln der Teamarbeit
Mit dem Druck auf die Planungsfachleute wächst auch ihre Verantwortung – und mit ihrer Verantwortung wiederum die Notwendigkeit, Verantwortung zu teilen. Ein probates Mittel, dies zu tun, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Damit sie gelingt, müssen angehende Planungsfachleute frühzeitig drei goldene Regeln der Teamarbeit lernen.
Regel Nummer eins:
Ein Generalist kann nicht alles alleine leisten. Es ist kein Zeichen von Inkompetenz, andere Fachleute hinzuzuziehen. Im Gegenteil: Eine zweite Meinung fördert Qualität. Interdisziplinäre Zusammenarbeit richtig verstanden ist also keine Gefahr für das eigene Projekt, sondern eine Bereicherung. Die eigentliche Stärke des Generalisten ist das vernetzte Denken, «der Blick für die übergeordneten Zusammenhänge und die relevanten Beziehungen zwischen den Dingen», wie es im Positionspapier Bildung heisst.
Regel Nummer zwei:
Ein interdisziplinäres Team sollte sich frühzeitig in einem Prozess zusammenfinden. Wenn technische Rahmenbedingungen von Anfang an bekannt sind, können sie gut in den gestalterischen Prozess einfliessen. Wenn der Architekt aber ohne Kenntnis der bauphysikalischen Rahmenbedingungen einen Entwurf für ein Passivhaus macht und der Bauphysiker erst anschliessend hinzukommt, um zu sagen, wo in welcher Grösse welche Fenster vorzusehen sind, dann ist die Chance auf gegenseitige Befruchtung definitiv vertan.
Regel Nummer drei:
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit darf keine Einbahnstrasse sein, sie ist ein ständiges Geben und Nehmen. Wenn ein Architekt Aufträge akquiriert und von sich aus frühzeitig einen Landschaftsarchitekten einbezieht, wird er sich zum Beispiel wenig freuen, wenn der Landschaftsarchitekt im umgekehrten Fall nicht auf ihn zukommt.
Ängste, Sorgen, Vorbehalte
Die drei goldenen Regeln der Teamarbeit mögen banal klingen. In der Praxis löst interdisziplinäre Zusammenarbeit aber immer wieder Ängste, Sorgen und Vorbehalte aus. Teilweise gibt es dafür auch objektive Gründe. So müssen Teams oft gegen ihren Willen zusammenarbeiten und werden von der Bauherrschaft erst zeitversetzt in ein Projekt einbezogen. Und auch die Schnittstellen zwischen den beteiligten Disziplinen sind häufig schwer zu definieren. Das gilt insbesondere für das Verhältnis von Architekten und Innenarchitekten. Die Frage zum Beispiel, ob das Schaffen von Räumen mit Einbauten, Licht und Möbeln eher eine architektonische oder eine innenarchitektonische Angelegenheit ist, ist nicht immer einfach zu beantworten.
Natürlich hängt die Einstellung zur Teamarbeit auch von der Marktsituation ab. Eine grosse Nachfrage nach Planerleistungen dürfte die Bereitschaft zur Kooperation eher fördern, weil niemand befürchten muss, zu kurz zu kommen. Ein enger Markt mit hoher Konkurrenz unter den Planungsfachleuten löst dagegen vielfach Abwehrreaktionen aus, zumal wenn bei einer Disziplin der Eindruck entsteht, eine andere Disziplin trete unter anderen Bedingungen zum Wettbewerb an, biete etwa eine Leistung an, ohne dafür die erforderliche Ausbildung zu haben. Schliesslich steht auch die Frage im Raum, wer den Lead in einem Projekt hat. Wer ist Generalist, wer Spezialist? Wer ist kreativ, wer ausführend tätig?
Bildung für nachhaltiges Bauen
Gerade der Druck auf die Planungsfachleute in einer schwierigen Marktsituation lässt aber keine Alternative zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Gegenüber einer gut aufgestellten Bauwirtschaft und anspruchsvollen Bauherrschaften sind Planungsfachleute nur im Team stark. Die Einstellung zur interdisziplinären Zusammenarbeit ist deshalb ganz wesentlich eine Frage der Haltung. Pflegen Planungsfachleute von Anfang an eine Kultur der Kooperation, oder sind sie die geborenen Einzelkämpfer, im Zweifelsfall gar unverstandene Künstler im Kampf gegen die Mühlen des schlechten Geschmacks?
Es ist eine Stärke des Architekturstudiums insbesondere an der ETH, dass angehende Architektinnen und Architekten sehr früh lernen, dass es noch andere Fachleute gibt. Nur eine ganzheitliche, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete und qualitativ hochwertige Ausbildung befähigt angehende Planungsfachleute dazu, gestalterische, technische und wirtschaftliche Ansprüche in Einklang zu bringen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Wenn Nachhaltigkeit nicht auf Energieeffizienz verkürzt werden soll, sondern auch gute Form impliziert, braucht es teamfähige Generalisten.
[ Thomas Lehmann, dipl. Arch. ETH SIA, K&L Architekten AG, St. Gallen, und Ausschussmitglied der Berufsgruppe Architektur SIA, Claudia Schwalfenberg, Dr. phil., Geschäftsführerin der Berufsgruppe Architektur SIA ]TEC21, Fr., 2009.06.12
12. Juni 2009 Thomas Lehmann, Claudia Schwalfenberg