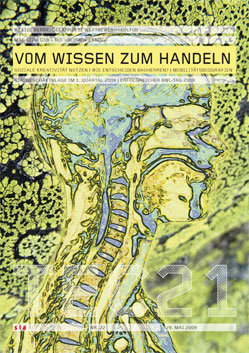Editorial
Wenn sich TEC21 mit dem Thema Umwelt befasst, geschieht dies in der Regel aus ingenieur- oder naturwissenschaftlicher Perspektive. Wir vermitteln Wissen über die Umweltsituation heute und in Zukunft sowie über die technischen Möglichkeiten zur Lösung von Umweltproblemen. Wir als Redaktion fragen uns natürlich, ob wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit diesen Informationen zum Handeln motivieren. Um mehr über den Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln zu erfahren, wagen wir mit dieser Ausgabe einen Ausflug ins Gebiet der Umweltpsychologie. Dieses Fachgebiet beschreibt und erklärt das umweltbezogene Verhalten des Menschen und untersucht, wie dieses verändert werden kann.
Damit Wissen zum Handeln führt, müsse es Emotionen auslösen, erläutert Heinz Gutscher, Professor am Psychologischen Institut der Universität Zürich, im Interview. Speziell die aus dem Klimawandel resultierenden Bedrohungen blieben jedoch für die meisten Menschen bisher relativ abstrakt. Was bedrohliche Zukunftsszenarien nicht schaffen, kann aber das Vorbild anderer Menschen erreichen. Das Handeln von Pionieren im Umweltbereich stärker sichtbar zu machen, ist für Heinz Gutscher daher ein zentraler Punkt für die Beschleunigung von Verhaltensänderungen.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt, das sich mit der «Diffusionsdynamik energieeffizienter Bauten» befasste. Die Gelegenheit, energieeffiziente Gebäude besichtigen zu können, spielt eine wichtige Rolle beim Entscheid privater Bauherrschaften, selbst energieffizient zu bauen. Eine mindestens ebenso bedeutende Rolle kommt den Architektinnen und Architekten zu, die für die meisten privaten Bauherrschaften die wichtigste Informationsquelle sind. Es liegt also auch an ihnen, Energieeffizienz besser zu vermarkten.
Im Gegensatz zu einem oft einmaligen Hausbau sind die Menschen täglich mit dem Gebrauch von Verkehrsmitteln konfrontiert. Will man hier etwas verändern, muss man Gewohnheiten durchbrechen, die oft sogar für ganze Generationen typisch sind, wie Gunter Heinickel vom Zentrum Technik und Gesellschaft in Berlin betont. Um Gewohnheiten bei Einzelpersonen zu verändern, bieten sich Brüche bei den Lebensumständen an. So kann zum Beispiel der Wechsel des Verkehrsmittels nach einem Umzug mit entsprechenden Angeboten gefördert werden.
Umweltprobleme sind also mit Sicherheit nicht allein von Naturwissenschaftern und Ingenieuren zu lösen, sondern es braucht das Wissen und die Kreativität der gesamten Gesellschaft.
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Gefährdete Wettbewerbskultur
13 MAGAZIN
G59 – die «Blumen-Landi»
16 «WIR MÜSSEN DIE SOZIALE KREATIVITÄT BESSER NUTZEN»
Claudia Carle, Daniela Dietsche
Im Interview erläutert der Sozialpsychologe Heinz Gutscher, wie sich Verhaltensänderungen im Umweltbereich beschleunigen lassen.
19 WIE ENTSCHEIDEN PRIVATE BAUHERRSCHAFTEN?
Susanne Bruppacher
Welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass sich private Bauherrschaften für ein energieeffizientes Haus entscheiden, und wie liesse sich deren Anteil erhöhen?
23 MOBILITÄTSBIOGRAFIEN
Gunter Heinickel
Wie wirken sich persönliche Erfahrungen auf unser Mobilitätsverhalten aus? Kann daraus auf das Verhalten einer ganzen Generation geschlossen werden?
28 SIA
Geschäftslage im 1. Quartal 2009 | Erfolgreicher BWL-Tag 2009
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
«Wir müssen die soziale Kreativität mehr nutzen»
Von der drohenden Klimaveränderung wissen wir alle. Trotzdem ergreifen wir nur sehr zögerlich Gegenmassnahmen. Von Heinz Gutscher, Sozialpsychologe und Professor am Psychologischen Institut der Universität Zürich, wollten wir wissen, warum das so ist und wie sich Verhaltensänderungen beschleunigen lassen.
TEC21: Obwohl wir wissen, wie sich unser Verhalten auf das Klima und die gesamte Umwelt auswirkt, handeln wir in vielen Bereichen noch nicht umweltverträglich. Wie ist das zu erklären?
Heinz Gutscher: Man staunt oft, wie wenig die Leute tatsächlich wissen. Aber selbst wenn sie das Wissen haben, heisst das nicht automatisch, dass sie es auch anwenden. Es kommt darauf an, wie sie die von der Wissenschaft vorausgesagten Konsequenzen bewerten. Erst wenn diese positive oder negative Emotionen auslösen, ergibt sich daraus die Motivation, etwas ändern zu wollen. Es ist beispielsweise zu befürchten, dass bis 2050 viele Inselstaaten im Meer versinken, aber diese Inseln sind einfach zu weit weg. Auch die schmelzenden Gletscher in der Schweiz bewegen uns nicht wirklich alle. Wir leben in einer privilegierten Ecke der Erde und werden die Auswirkungen der Klimaveränderung anders, später und auch indirekter zu spüren bekommen.
TEC21: Sie meinen, dass die Klimaveränderung die Menschen emotional zu wenig bewegt, um sie zum Handeln zu motivieren?
Heinz Gutscher: Ja. Ausserdem gehört der Klimaschutz nicht zu den menschlichen Grundmotiven. Die Evolution drängte uns primär, zu überleben und einen gewissen Grad an Sicherheit und Komfort zu erreichen. Beim Abschätzen der Bedrohlichkeit des Klimawandels versagt unsere Intuition, kurz: Die Klimaveränderungen verbinden wir noch zu wenig mit realen Bedrohungsszenarien.
TEC21: Das Auftauen der Permafrostzonen in den Alpen ist aber eine Bedrohung, die sich direkt vor unserer Haustür abzeichnet.
Heinz Gutscher: Die Bedrohung ist in diesem Fall konkret, zumindest für die Menschen in den betroffenen Regionen. Aber ich habe grosse Zweifel, ob das uns alle in unserem Alltag wirklich bewegt. Viele Risiken sind immer noch relativ abstrakt, da sie uns nur von der Wissenschaft vermittelt werden, das heisst von Leuten, die sich ab und zu auch widersprechen, die extreme und weniger extreme Szenarien vorhersagen. Hier gibt es die Tendenz zu sagen: ‹Da warten wir mal, bis die sich geeinigt haben.›
TEC21: Distanziert man sich vielleicht auch von diesen Fakten, weil es fast immer Negativmeldungen über Bedrohungen und Risiken sind, die man irgendwann nicht mehr hören möchte? Wären Positivbotschaften nicht die bessere Wahl?
Heinz Gutscher: Ich denke, es braucht beides. Auf glaubwürdige Art Angst zu machen, ist ein sehr wirksames ‹Instrument›, wenn eine zumutbare und realisierbare Gegenmassnahme verfügbar ist. Wir sind von unseren Anlagen her höchst effiziente ‹Gefahrenvermeidungswesen›. Daher achten wir mehr auf Negativ- als auf Positivmeldungen. Wir haben eine klare Asymmetrie in der Verarbeitung. Aber natürlich sind auch Erfolgsmeldungen wichtig, um den Leuten Hoffnung zu machen, dass Verhaltensänderung etwas bringt. Beim Klimaschutz halte ich das allerdings für problematisch. Gewisse negative Auswirkungen wird es trotz allen Bemühungen geben – wenn auch wohl in einem geringeren Ausmass als ohne Gegenmassnahmen.
TEC21: Steht uns bei Veränderungen nicht oft auch die Gewohnheit im Weg?
Heinz Gutscher: Ja, Menschen sind Status-quo-Geschöpfe. Routine entlastet vom Nachdenken. Wenn man etwas ändert, muss man auf neue Gefahren achten. Damit man Lust hat, etwas Neues auszuprobieren, braucht es finanzielle und zeitliche Ressourcen. Auch Ereignisse wie die Eröffnung der Zürcher Westumfahrung oder die Sperrung eines Tunnels können Anlass sein, Gewohnheiten zu ändern.
TEC21: Kann man nicht auch unabhängig von so einem Ereignis die Menschen davon überzeugen, in ihrem Alltag etwas zu verändern?
Heinz Gutscher: Die Psychologie, die Soziologie, die Politologie und auch die Ökonomie kennen verschiedene Techniken zur Verhaltensänderung. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang z.B. das Sichtbarmachen von ‹Pionieren›, die bereits angefangen haben zu handeln. Ich sehe eine grosse Chance darin, deren Handeln stärker ins Licht zu rücken, denn Menschen orientieren sich daran, was andere machen. Dafür müssen sie gar nicht alles verstehen. Ich könnte mir auch vorstellen, das aktiv zu nutzen – der Nachbar als sozialer Multiplikator. Über Zeitungsinserate könnte man z.B. Leute suchen, die bereit sind, von Haus zu Haus zu gehen und über die Erfahrungen mit ihrer Solaranlage zu sprechen. Direkte menschliche Kommunikation hat grosse Vorteile: Sie ist bis zu einem gewissen Grad selbstheilend. Wenn die Leute geschickt genug sind oder gut ausgebildet, merken sie, wenn sie eine Person anders behandeln oder Dinge nochmals erklären müssen. Das kann ein gedruckter Flyer nicht.
TEC21: Nehmen wir an, jemand ist zu der Überzeugung gelangt, dass er sich umweltfreundlicher verhalten möchte. Das heisst ja noch nicht, dass er dann auch wirklich so handelt.
Heinz Gutscher: Oft sind es äussere Faktoren, die dem umweltfreundlichen Verhalten entgegenwirken. Diese Schwierigkeiten des Verhaltens muss man unbedingt berücksichtigen. Das ‹Wollen› ist das eine, es geht aber auch um das ‹Können› – kann ich mich überhaupt nachhaltig verhalten? Wenn eine Person zum Beispiel auf das Auto verzichten möchte, aber keinen ÖV-Anschluss in der Nähe hat, ist die Verhaltensschwierigkeit extrem. Es braucht entsprechende strukturelle Grundbedingungen – die Infrastruktur oder die Dienstleistungen, die es mir ermöglichen, mich entsprechend zu verhalten, oder die umgekehrt umweltschädigendes Verhalten verhindern. Fehlen beispielsweise Parkplätze in der Innenstadt, wird eher auf das Auto verzichtet. Ich muss auch die ökonomischen Mittel und die zeitlichen Ressourcen dafür haben. Aber selbst wenn man sich umweltfreundlich verhalten will und auch die Möglichkeit dazu hat, muss man es im entscheidenden Moment auch tatsächlich tun. Dafür gibt es heute schon verschiedene technische Hilfsmittel, die uns in der entsprechenden Situation darauf aufmerksam machen, dass wir etwas tun könnten.
TEC21: Können Sie ein Beispiel nennen?
Heinz Gutscher: Ja, es gibt Versuche mit Feedbackanzeigen, die – in der Wohnung angebracht – ihre Farbe ändern, je nachdem, ob momentan viel oder wenig elektrische Energie gebraucht wird.[1] Es hat sich gezeigt, dass diese Form von Feedback Vorteile gegenüber einem digitalen Display mit Zahlen hat, weil es schneller und intuitiver zu verarbeiten ist. Es gibt auch Untersuchungen mit Robotern, die zum Benutzer sprechen. Auch ein solches ‹soziales› Feedback ist wirksamer als die Kommunikation reiner Fakten in Zahlenform. Es ist quasi eine Missbilligung aus der sozialen Umgebung.
TEC21: Wenn ich umgekehrt aber das Gefühl habe, ich sei der Einzige, der sich umweltgerecht verhält, erzeugt das unter Umständen Frustration, weil der einzelne Beitrag eigentlich nichts bringt. Wie kann man dem entgegenwirken?
Heinz Gutscher: Wir müssen versuchen, für die Einzelnen die kleinen Beiträge aller anderen zu addieren und (mindestens virtuell) sichtbar zu machen. Um den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind, gibt es heute tolle IT-Möglichkeiten. Denkbar wäre eine Art Nachhaltigkeits-Facebook, wodurch ich merke, dass es noch viele andere Leute gibt, die sich nachhaltig verhalten, und wo ich auch Tipps bekomme. Es gibt auch die Möglichkeit, sogenannte ‹Alle-oder-niemand-Verträge› zu schliessen. Man sagt beispielsweise, unser Ziel ist, die Schadstoffbelastung in der Stadt um so und so viel Prozent zu senken. Um das zu erreichen, braucht es 20 000 Beiträge, das heisst 20 000 Leute, die mit ihrer Unterschrift bezeugen, das versprochene Verhalten, etwa im Verkehrsbereich, auszuführen, wenn alle diese Beiträge zusammenkommen. Der Vorteil davon ist: Wenn es gelingt, wird ein messbarer Effekt erreicht. Wichtig ist der Grundbefund: Menschen sind bedingt kooperativ. Es ist nicht so, dass wir nur über das Geld gesteuert werden, wir investieren auch etwas für eine Idee. Wenn andere mitmachen, machen wir tendenziell auch mit. Das sind wichtige Befunde, die über die klassische Ökonomie hinausgehen und ein Stück weit optimistisch stimmen. Fairness oder Gerechtigkeit sind bei vielen ebenfalls soziale Grundmotivationen.
TEC21: Welche Bedeutung haben Vorschriften als ein Instrument, Umweltverhalten zu steuern?
Heinz Gutscher: Vorschriften haben eine wichtige Funktion. Wir finden für jede neue soziale Idee Leute, die sie schon umsetzen oder die bereit sind, das unter günstigen Umständen zu tun. Diese Pioniere machen meist zwischen 10 und 20 Prozent aus. Die Mehrzahl der Menschen kann zum Nachfolgen animiert werden. Aber die letzten ca. 15 Prozent, die es nicht kümmert, was jemand anderes macht, und die sich nichts überlegen, können wir nur über Vorschriften und Gesetze mitnehmen.
TEC21: Konzentriert man sich heute zu sehr darauf, Wissen zu generieren oder sich Effizienztechniken zu überlegen, und vernachlässigt darüber die Forschung zu den Bestimmungsfaktoren menschlichen Verhaltens – also wie bringt man die Leute dazu, nachhaltiger zu werden?
Heinz Gutscher: Da gibt es tatsächlich ein Missverhältnis. In den USA fl iessen 97 Prozent der Mittel für die Klimaforschung in die Naturwissenschaften und nur 3 Prozent in die Sozialwissenschaften. Die genauen Zahlen für die Schweiz kenne ich nicht. Die Natur- und die Sozialwissenschaften sind aber nicht die Einzigen, die wichtige Beiträge liefern müssen. Eine witzige Art, auf das Gemeingutdilemma aufmerksam zu machen, war zum Beispiel ein Plakat während unserer Anti-Stau-Kampagne beim Ausbau des Baregg-Tunnels: ‹Ich stehe im Stau, weil die anderen nicht Zug fahren.› Das zeigt, dass es auch die Kreativen braucht. Es braucht alle – die ganz junge Generation, die Künstler, die Freaks. Und ich hoffe, dass auch die Politik gewisse Fantasien entwickeln wird. Wir müssen unsere soziale Kreativität stärker nutzen, um Veränderungen zu beschleunigen.
Anmerkungen:
[1] Die Ergebnisse dieser Studie von Cees Midden, TU Eindhoven, werden im Rahmen der 8th Biennial Conference on Environmental Psychology vom 6. bis 9. September 2009 in Zürich vorgestellt. www.sozpsy.uzh.ch/conference.html
[2] Quelle: Volker Linneweber: Umweltpsychologie – Ansatz und Anliegen, www.umweltpsychologie.deTEC21, Fr., 2009.05.29
29. Mai 2009 Claudia Carle, Daniela Dietsche
Wie entscheiden private Bauherrschaften?
Rund 15 % der Neubauten werden heute nach Minergiestandard gebaut. Welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass sich private Bauherrschaft en für ein energieeffizientes Gebäude entscheiden, und wie liesse sich deren Anteil erhöhen? Dieser Frage ging ein umweltpsychologisches Forschungsprojekt nach und fand heraus, dass die Einstellung privater Bauherrschaft en gegenüber energieeffizientem Bauen sehr positiv ist, dass es aber für sie aufwendig ist, sich darüber zu informieren und kompetente Projektpartner zu finden.
Das Projekt war Teil eines Forschungsvorhabens zum Thema «Diffusionsdynamik energieeffi zienter Bauten», wurde an der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie der Universität Bern durchgeführt und im Februar dieses Jahres abgeschlossen.[1] Es hatte zum Ziel, Entscheidungsprozesse bei den verschiedenen Akteuren im Bauprozess zu analysieren und Lernprozesse zu fördern, um die Verbreitung energieeffizienter Bauten zu beschleunigen. Im Projekt wurden zwei Modelle entwickelt: zum einen das in diesem Beitrag vorgestellte Modell, das die Schlüsselfaktoren abbildet, die für die Entscheidung privater Bauherrschaften für oder gegen ein energieeffizientes Gebäude ausschlaggebend sind; zum andern ein sogenanntes systemdynamisches Modell, das die Verbreitung von energieeffizienten Gebäuden im Vergleich zu Standardlösungen in einer Gemeinde simuliert. Resultate des Entscheidungsmodells flossen dabei auch in das systemdynamische Modell ein.
In den Forschungsprozess wurden alle relevanten Akteure aus der Praxis – im Folgenden «Systemexperten» genannt – einbezogen (Nutzer, Ausführende, Planer, Auftraggeber, Verbände, staatliche Stellen, Energieversorger). Um deren Wissen zu nutzen, wurden einzelne Untersuchungen bereits in der Konzeptionsphase mit ihnen abgesprochen. Nach jedem Forschungsschritt gaben sie ausserdem wiederum Rückmeldung. Auch die Systemexperten selbst sollten in diesem Prozess, der u.a. vier gemeinsame Workshops beinhaltete, im Austausch untereinander mehr über das Bausystem lernen und ihre eigenen Strategien refl ektieren.Um das Modell energierelevanter Entscheidungen privater Bauherrschaften zu erstellen, wurde zunächst mit den Systemexperten diskutiert, welche Faktoren beim Entscheid von Bauherrschaften für oder gegen ein energieeffizientes Gebäude überhaupt eine Rolle spielen könnten. Diese Hypothesen zum Entscheidungsverhalten von Bauherrschaften wurden dann mit einer telefonischen Befragung von privaten Bauherrschaften, die in den Jahren 2002 bis 2007 ein eigenes Einfamilienhaus gebaut hatten, empirisch überprüft.[2] 12 % der Befragten leben in einem Minergiehaus.
Das Ziel der Befragung war, herauszufi nden, welche Zusammenhänge zwischen psychologischen Variablen und dem Entscheid, ein energieeffizientes Haus zu bauen, bestehen. Wie energieeffizient die Häuser der befragten Bauherrschaften sind, wurde aufgrund deren Selbsteinschätzung[3] anhand von zwei Fragen bestimmt: «Ich habe ein Haus gebaut, das einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch hat als gesetzlich vorgeschrieben»[4] und «Ich habe beim Hausbau in energiesparende Technologien investiert, z.B. in eine besonders gute Isolation, ein energiesparendes Heizsystem usw.». Die Energieeffizienz des eigenen Hauses im Vergleich zu anderen Neubauten dürfte damit allerdings überschätzt werden, weil Bauherrschaften offenbar ihren Neubau mit dem gesamten Gebäudepark vergleichen. Von den untersuchten psychologischen Variablen hatte die «wahrgenommene Verhaltenskontrolle » den weitaus grössten Einfl uss auf das Verhalten, gefolgt von der «Einstellung», die ebenfalls einen signifikanten Einfluss ausübt (Abb. 2).
Wo informieren sich Bauherrschaften?
Die «wahrgenommene Verhaltenskontrolle» erfasste, ob die Befragten grundsätzlich die Möglichkeit, die Zeit und das Geld hatten, um ein energieeffizientes Haus zu bauen. Die Antworten auf diese Fragen waren wiederum in höchstem Masse vom «wahrgenommenen Handlungsspielraum» abhängig, der mit den fünf in Abb. 3 aufgeführten Fragen gemessen wurde. Die Antworten zeigen, dass die Befragten zwar ihr eigenes Wissen über Energieeffizienz beim Bauen bei Planungsbeginn als mittelmässig einstufen, aber grundsätzlich die Gelegenheit hatten, aktiv Informationen einzuholen. Das Gefühl der eigenen Kompetenz und Kontrolle wird auch dadurch beeinfl usst, ob der Bauherrschaft Förderprogramme und kompetente Baupartner bekannt sind und ob die Gelegenheit besteht, energieeffiziente Häuser zu besichtigen. Erfasst wurde auch, ob die Befragten eine Energieberatung in Anspruch genommen haben und welche Informationsquelle sie am meisten beeinfl usst hat. Die meisten Befragten nannten den Architekten als wichtigste Informationsquelle (Abb. 4). Kantonale Energieberatungen wurden erstaunlicherweise kaum als Informationsquelle genannt. Das Potenzial einer professionellen Energieberatung scheint in der Stichprobe der befragten Gemeinden offenbar noch nicht ausgeschöpft zu sein. Zwar gaben 25 % der Befragten an, eine solche in Anspruch genommen zu haben, meist aber durch den Architekten selbst. Hausbesichtigungen wurden ebenfalls relativ selten als genutzte Informationsquelle genannt, obwohl die Besichtigungsgelegenheit wie oben erwähnt als Teil des wahrgenommenen Handlungsspielraumes das Verhalten stark zu beeinfl ussen scheint. Die der Befragung vorausgehenden offenen Interviews und die Diskussion der Resultate mit privaten Bauherrschaften und anderen Akteuren in den Workshops zeigen, dass es für private Bauherrschaften immer noch viel Zeitaufwand bedeutet, an die relevanten Informationen und Projektpartner (z.B. geeignete Architektinnen und Architekten) zu gelangen.
Wer energieeffizient bauen will, muss dafür genügend Willen und Ausdauer mitbringen. Das sei ein grosses Hindernis. Dies bestätigt sich auch in der Bauherrenbefragung, weil die verfügbare Zeit als Teil der Verhaltenskontrolle einen grossen Einfluss auf das Verhalten hat.
Positive Einstellung zum energieeffizienten Bauen
Die Einstellung gegenüber energieeffizienten Gebäuden als zweitwichtigster Schlüsselfaktor bei der Entscheidung privater Bauherrschaften ist bei allen Befragten positiv. Erklären lässt sich die Einstellung wiederum in erster Linie durch die Vereinbarkeit des Ziels Energieeffizienz mit anderen wichtigen Zielen beim Bauen (Abb. 2), beispielsweise der Ästhetik, dem Komfort oder der Wirtschaftlichkeit (Abb. 5). Die Befragten meinen, dass energieeffiziente Häuser ihre Wohnbedürfnisse eher besser erfüllen als herkömmliche Häuser. Das Vorurteil, dass energieeffiziente Häuser nicht ästhetisch seien, wurde nicht bestätigt. Im Gegenteil, von allen erfragten Punkten werden dort am wenigsten Zielkonfl ikte mit energieeffizientem Bauen gesehen. Die Vorteile beim energieeffizienten Bauen werden insbesondere in der Erhöhung des Komforts, in der Wertsteigerung der Liegenschaft und in der langfristigen Wirtschaftlichkeit gesehen, wobei eingeräumt wird, dass die Investitionskosten höher sind. Beeinfl usst wird die Einstellung der Bauherrschaften auch durch persönliche und soziale Normen. Die Befragten erwähnen ein gewisses Gefühl der Verpfl ichtung zum energieeffizienten Bauen, das durch die Erwartungen von Familie, Freunden, Bekannten und vom Architekten entsteht.
Empfehlungen zur Förderung energieeffizienten Bauens
An einem der Workshops im Rahmen des Forschungsprojektes diskutierten die Systemexperten die Implikationen für die Praxis, die sich aus diesen Befragungsresultaten ergeben, und mögliche Massnahmen von Akteuren, um die entscheidendsten strukturellen Bedingun gen zu verbessern: Da die bereits sehr positive Einstellung der befragten Bauherrschaften gegenüber energieeffizientem Bauen kaum noch verbessert werden kann, fokussierte man auf jene Punkte, die sich im Projekt als Hemmnis erwiesen haben: – Vorbilder vorhanden – Kenntnis Förderprogramme – Gelegenheit Besichtigung – kompetente Baupartner vor Ort haben und kennen Die Rolle von Vorbildern beschränkt sich nicht auf den Freundes- und Bekanntenkreis, sondern sollte auch von öffentlichen Institutionen wie Gemeinden und Ämtern wahrgenommen werden. Vorgeschlagen wurde, den Status und das Prestige energieeffizienter Gebäude durch ein sichtbares Label für Energieeffizienz bei der Tür zu erhöhen, Publikationen über solche Gebäude zu fördern und öffentliche Werbeaktionen durchzuführen. Alle Akteure wünschen dringend mehr Kontinuität bei den Förderprogrammen. Sie halten eine nationale Koordination der Kommunikation und Bekanntmachung für sinnvoll und allgemein mehr nationale und weniger kantonale Förderung. Sich über Förderprogramme zu informieren soll einfacher und übersichtlicher werden. Kostenvergleiche und Berechnungsbeispiele könnten aufzeigen, was der Nutzen der Förderprogramme ist.
Die Gelegenheit für eine Besichtigung wird von den Akteuren vor allem in Form von Tagen der offenen Tür gesehen, zu denen Architektinnen und Architekten die Bauherrschaften aktiv motivieren sollten. Bei öffentlichen Gebäuden mit einem Energieeffizienzstandard fordern sie die Verpflichtung zu geführten Besichtigungen. Auch das Projekt «Probewohnen im Passivhaus»[5] sollte weiter ausgebaut werden. Kompetente Baupartner vor Ort müssen erst einmal als solche erkannt werden. Beide Gruppen betonten die Notwendigkeit von Rankings und Qualitätslabeln für Baupartner mit entsprechender Erfahrung. Zudem wird dringend gefordert, dass Architektinnen und Architekten Energieeffizienz besser vermarkten und die Bauherrschaften mit einer langfristigen Perspektive beraten.
Von Behörden, Energiefachstellen und Verbänden wird der Ausbau bzw. eine Verbesserung des Weiterbildungsangebotes und bestehender Informationsplattformen für alle Akteure erwartet.
[Susanne Bruppacher, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie, Universität Bern]
Anmerkungen:
[01] Das Forschungsprojekt «Diffusionsdynamik energieeffizienter Bauten» wurde im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 54, «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung», durchgeführt. Eine Kurzfassung der Projektresultate ist unter www.deeb.ch abrufbar
[02] Befragt wurden 201 private Bauherrschaften (60 % weiblich, 40 % männlich), die aus 36 Deutschschweizer Gemeinden (> 10 000 Einwohner) stammten
[03] Die Erfassung von Energiekennzahlen gemäss Baugesuch war nicht möglich
[04] Die Zustimmung bei dieser Frage war ziemlichhoch (Mittelwert von 3.27 auf einer Skala von 1 «stimme gar nicht zu» bis 4 «stimme ganz zu»). Dies lässt darauf schliessen, dass die Befragten die Energieeffizienz ihres Hauses tendenziell überschätzten
[05] www.probewohnen.chTEC21, Fr., 2009.05.29
29. Mai 2009 Susanne Bruppacher