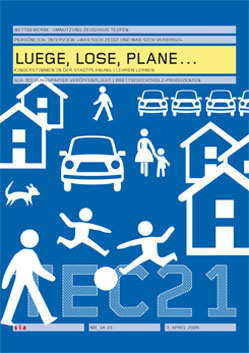Editorial
Wenn Städte die Abwanderung von Familien stoppen wollen, müssen sie kindertauglicher werden. Doch wer weiss, was kindertauglich ist? Vielleicht am besten die Kinder selber. In Basel sucht die Fachstelle Stadtteilentwicklung zusammen mit dem privaten Verein Kinderbüro nach Methoden, wie die Sicht der Kinder auf den öffentlichen Raum und den Verkehr erfasst werden kann, wie ihre Erfahrungen, Kritiken und Anregungen gesammelt und in brauchbare Vorgaben für die Stadt- und Verkehrsplanung transformiert werden können. Ein Pilotprojekt im Stadtteil St. Johann hat zu ermutigenden und teilweise überraschenden Resultaten geführt – und auch zu konkreten Verbesserungen. Eine departementsübergreifende Sensibilisierung der Behörden und der stadtweite Einbezug von Kinderstimmen in die Stadtplanung sind geplant.
Skeptische Stimmen zur Mitwirkung von Kindern bei der Gestaltung unserer Realität weisen – wohl mit Recht – auf die Gefahr einer Banalisierung von fachlich anspruchsvollen Fragen hin. Mit dieser Kritik sah sich an einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung auch das vom Bund Schweizer Architekten geförderte Projekt «Architektur und Schule» konfrontiert. Es hat sich vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, architektonische Gestaltung als Thema in der Volksschule zu etablieren. Mit zahlreichen Pilotprojekten gingen die Mitarbeiter seither in die Schule – im doppelten Wortsinn: Sie lernten, dass es nicht darum gehen kann, mit Kindern architektonisches Gestalten zu üben, sondern vielmehr darum, ihnen die Augen für die gestaltete Umwelt zu öffnen und sie auf ein möglichst breites Spektrum von kulturellen, technischen, wirtschaftichen, sozialen und ökologischen Zusammenhängen aufmerksam zu machen.
Kinder, die einmal an einer Stadtteilplanung mitgewirkt oder sich im Unterricht mit den Faktoren beschäftigt haben, die unsere Siedlungen und unsere Umwelt prägen, werden später nicht alle Architekten und Ingenieurinnen werden wollen. Aber sie werden als Stimmbürger, Steuerzahlerinnen, Hausbesitzer oder Baukommissionsmitglieder über eine grössere Bestellerkompetenz verfügen, mehr Interesse für die Umwelt und Fragen der Gestaltung aufbringen und die Kompetenz von Fachleuten umso höher schätzen.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Umnutzung Zeughaus Teufen
12 PERSÖNLICH
«Was sich zeigt und was sich verbirgt» – Interview mit der Architektin und Autorin Elisabeth Blum
16 MAGAZIN
Instrumente der Kostenplanung | Ferienresorts nachhaltig planen | Produkte zur Lärmminderung im Netz | «Baugedächtnis» erweitert
22 KINDERSTIMMEN IN DER STADTPLANUNG
Ruedi Weidmann
In Basel nimmt die Stadtplanungsbehörde die Anliegen von Kindern ernst, denn die Stadt soll familienfreundlicher werden. Doch wie werden aus Kinderwünschen Vorlagen für die Planung?
29 LEHREN LERNEN
Hansjörg Gadient
Das BSA-Projekt Architektur und Schule hat fruchtbare Lehrjahre hinter sich: Seine Lehrmittel für die Volksschule werden das Thema Gestaltung viel breiter behandeln als ursprünglich angestrebt.
38 SIA
Der SIA veröffentlicht Bildungspapier | Vernehmlassung Normen SIA 424 und 425 | Brettschichtholz-Produzenten | Kurs: operatives Projektmanagement
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Kinderstimmen in der Stadtplanung
Viele Städte wollen die Abwanderung junger Familien in die Agglomeration stoppen. Dazu müssen sie kinderfreundlicher werden. In Basel versucht die Fachstelle Stadtteilentwicklung die Erfahrungen und Vorschläge von Kindern in die Quartierplanung und -entwicklung aufzunehmen. Das Kinderbüro Basel hilft dabei, Kinderwünsche zu erfassen und so aufzubereiten, dass sie in die Planung einfliessen können. Zwei Beispiele – ein neuer Gestaltungsvorschlag für Begegnungszonen in Riehen und die Kartierung des Basler St.-Johann- Quartiers aus Kindersicht – illustrieren, wie das funktionieren kann.
Ein ehemaliger Laden in der Innenstadt dient dem vierköpfigen Team des Kinderbüros Basel als Basis für seine vielfältigen Aktivitäten. Die Anlaufstelle steht Kindern jeden Nachmittag für Fragen, Wünsche und Ideen zur Verfügung, ebenso Erwachsenen, Behörden und Institutionen, die Anliegen zu Kinderthemen haben.1 Seit 2000 sensibilisiert der von der Christoph-Merian-Stiftung und der Bürgergemeinde Basel getragene Verein die Öffentlichkeit für Bedürfnisse und Rechte der Kinder und setzt sich für die Mitwirkung von Kindern in den Lebensbereichen Schule, Wohnumfeld, Verkehr und Stadtentwicklung ein. Die wichtigsten Ziele sind die Beachtung der Kinderrechte und die Schaffung und Erhaltung von kindergerechten Lebensräumen.
Kinder als Experten
In der Kinderversammlung bestimmen Kinder im Alter von 7 bis etwa 13 Jahren mit, welchen Themen sich das Kinderbüro widmen soll. Sie ist ein Element des Programms «KinderMit- Wirkung», in dem die Kinder mit Unterstützung des Kinderbüros eigene Projekte entwickeln und durchführen können. Die Themen sind Verkehr, Umwelt, Schule oder Kinderrechte. Diese Projekte sollen das städtische Lebensumfeld für Kinder in Basel ganz konkret verbessern. So kümmert sich eine Gruppe um das Einrichten von persönlichen Spinden in den Schulhäusern, andere verfolgen eher kulturelle Ziele, wie beispielsweise Kochkurse oder die Einrichtung eines Kindermuseums. Das Kinderbüro organisiert dabei die Zusammenarbeit mit Fachleuten und mit den zuständigen Verwaltungsstellen und Regierungsmitgliedern. Dieser Ansatz geht davon aus, dass Kinder da, wo es ihre Lebenswelt betrifft, interessiert und engagiert sind und als Experten in eigener Sache ernst genommen werden sollen. Durch ihr Mitwirken lernen sie die Gesetze des Zusammenlebens kennen und entwickeln eine positive Beziehung zu ihrem Wohn- und Lebensumfeld. Sie erleben, dass ihre Erfahrung gefragt ist, dass ihre Stimme zählt und dass mit Analysieren, Denken, Diskutieren und gemeinsamem Handeln die Welt verändert werden kann – sie erleben also Demokratie. Damit Kinder als Experten zu Wort kommen und gehört werden, entwickelt und propagiert das Kinderbüro Planungsverfahren, bei denen Kinder mitwirken können.
Verkehr aus Kindersicht
Einen Schwerpunkt bildet das Thema Sicherheit im Strassenverkehr. Immer wieder bringen Kinder die Einschränkungen in ihrem Alltag durch die Gefahren und den Platzbedarf des Autoverkehrs aufs Tapet und lancieren entsprechende Projekte. So sind etwa zwei Filme über Kinder im Verkehr entstanden. Die konsequent auf der Augenhöhe von Kindern geführte Kamera ermöglicht Erwachsenen, Verkehrssituationen aus der Perspektive von Kindern wahrzunehmen und Gefahren so zu erkennen. Bei solchen Projekten gesammelte Anregungen werden an «Kindergipfelitreffen» den zuständigen Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung vermittelt und ans Herz gelegt.
Lebensraum Quartierstrasse
Für kleine Kinder ist vor allem das unmittelbare Wohnumfeld wichtig: der Innenhof und die Strasse, an der sie aufwachsen. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr vor dem Haus spielen. Im Nationalen Forschungsprogramm «Stadt und Verkehr» (NFP 25) wurde die Bedeutung des Wohnumfeldes für die kindliche Entwicklung in einer Langzeitstudie untersucht und ein direkter Zusammenhang nachgewiesen2: Das Kind wird in seiner Entwicklung behindert, wenn es in einem Wohnumfeld lebt, in dem dichtes Verkehrsaufkommen und hohe Fahrgeschwindigkeit auf der Quartierstrasse keine anderen Aktivitäten neben dem Verkehr zulassen. Kinder, die ihre Wohnung nicht unbegleitet verlassen dürfen, können ihren Bewegungsdrang nicht genügend ausleben. Sie haben seltener Kontakte zu Gleichaltrigen, werden später selbstständig und brauchen mehr Betreuung.
Kinder haben das starke Bedürfnis, unmittelbar vor ihrer Haustür zu spielen. Kann die Strasse vielfältig genutzt werden, bewegen sich Kinder früher ohne Begleitung, knüpfen Kontakte, erwerben im Spiel mit anderen motorische und soziale Kompetenzen, entwickeln Fantasie und Kreativität und sind allgemein innovativer, selbstständiger und zufriedener. Die Ausdehnung des Bewegungsradius ausserhalb der Wohnung entlastet den Familienalltag. Die Kontakte unter den Eltern nehmen ebenfalls zu. Bei Kindern und Erwachsenen verstärkt die Zufriedenheit mit der Wohnsituation die Identifikation mit dem Wohnort und das Verantwortungsbewusstsein für das Wohnumfeld. Das wirkt sich auch auf kinderlose Nachbarn aus, sie fühlen sich sicherer im Verkehr wie im sozialen Umfeld.
Je dichter die Städte werden, umso wichtiger wird deshalb, dass Quartierstrassen wieder Lebensräume werden. Das Strassenverkehrsrecht sieht dafür die Begegnungszone vor (vgl. Kasten nächste Seite). Diese macht wieder möglich, was einst selbstverständlich war: Die Strasse wird von den Menschen, die daran wohnen, für Gespräche, Spiele, Hausarbeiten oder Spaziergänge genutzt. Der Wunsch nach mehr Begegnungsflächen wurde auch in der Werkstadt Basel laut, welche die Regierung ins Leben rief, um unter Mitwirkung von Bevölkerung, Verbänden und Gewerbe die Attraktivität der Stadt zu erhöhen. Bei der Umsetzung im Aktionsprogramm Stadtentwicklung wurde dieser Wunsch aufgenommen: Das Bau- und Verkehrsdepartement hat in jedem Quartier zwei bis drei Begegnungszonen eingerichtet, nachdem die Anwohnenden zugestimmt hatten. Während der entsprechenden Umfragen organisierte das Kinderbüro Beispieltage, um die Vorteile der Begegnungszone zu demonstrieren.
Möbeltipss für Begegnungszonen
Drei weisse Streifen über die Fahrbahn und eine Stele mit Signaltafel und Guckloch markieren in Basel die Einfahrt in eine Begegnungszone (vgl. TEC21 41/2007, S. 16). Dazu gibt es eine Standardmöblierung aus Sitzgelegenheiten und Pflanztrögen, welche die Anwohnenden selber bepflanzen und unterhalten müssen. Offenbar macht dieses Möbelsortiment aber weder Kinder noch Gemeinden glücklich.
Am Kindermitwirkungstag vom 20. November 2007 trafen sich im Basler Rathaus 130 Kinder, um aus eigenen Ideen und Wünschen zehn auszuwählen, die sie zu konkreten Projekten weiterentwickeln wollten. Eines der ausgewählten Projekte hiess «Mehr und bessere Spielstrassen». Da fast nur Kinder aus Riehen mitwirkten, nahm das Kinderbüro Kontakt mit der Nachbargemeinde auf. Riehen war mit seinen bestehenden Begegnungszonen nicht zufrieden und wollte sein Begegnungszonenkonzept überarbeiten. Der Zuständige für Verkehrsfragen war gern bereit, Ideen der Kinder entgegenzunehmen. Das Kinderbüro organisierte zusammen mit groenland.basel, einem Büro für visuelle Gestaltung, eine Planungswerkstatt: Im Juni 2008 entwickelten 21 Kinder an Modellen ideale Begegnungszonen. Laut Matthias Schnegg von groenland.basel muss man Kindern möglichst wenige Vorgaben machen, damit sie nicht die Ideen von Erwachsenen nachbauen. Dafür sollten sie aber möglichst vielfältiges Baumaterial zur Verfügung haben. Die Arbeitsgruppen müssen klein und intensiv betreut sein, damit alle Kinder zum Zug kommen und möglichst viele Ideen Gestalt annehmenRund hundert Ideen steckten in den zehn Modellen, welche die Kinder schliesslich der Gemeindebehörde und den Medien präsentierten: Klettergerüste aller Art, Gewässer vom Schwimmbad bis zum Wasserfall, Tore über die Strasse, aufgemalte Spielfelder, Rutschen, eine Stabhochsprunganlage, ein Trampolin, weiche Beläge und Kissen, Schaukeln, Sitzecken und viele Bäume.
Ein Gestaltungsvorschlag für Riehen
Die Gestalter von groenland.basel analysierten die Modelle, listeten die Ideen auf, unterschieden Machbares von Unmöglichem und identifizierten Themen, die sich – vielleicht etwas anders als vorgeschlagen – umsetzen liessen. Daraus entwickelten sie einfache Elemente in organischen Dreieckformen, die ans Trottoir angedockt werden und die Fahrbahn in eine mäandrierende Flussform verwandeln. Harte Elemente aus Beton wechseln mit weichen Kissen mit Tartanbezug und weichem Futter ab. Die Gestaltung ist nirgends höher als 40 cm. An bestehende Hauswände und Mauern montierte Haken laden aber zum temporären Aufspannen von Seilen, Girlanden, Zeltblachen oder Hängematten ein. An Anfang und Ende der Begegnungszone wird ein Flachrelief aus Markierungsfarbe auf den Belag aufgebracht, das an gefallenes Laub erinnert. Im Inneren wechselt die Oberfläche zwischen hart und weich; Beläge von Anrainerliegenschaften dürfen in die Strasse hinaus verlängert werden, um die Fahrbahngrenzen weiter aufzulösen.
Trotz ihrer Zurückhaltung kann diese Gestaltung etliche Wünsche der Kinder erfüllen. Die harten Elemente können als Sitzgelegenheiten oder Raumteiler genutzt und mit Kies gefüllt werden, die weichen Elemente dienen allen möglichen Spielzwecken, unter anderem – abseits von Trottoir und Fahrbahn – als Becken für Regenwasserpfützen, die im Winter zu Eisflächen gefrieren dürfen. Das Konzept wurde den Kindern noch einmal präsentiert, um ihnen zu zeigen, dass ihr Engagement etwas bewirkt. Nach einer ersten Enttäuschung über das Fehlen grosser Installationen zeigten sie sich erfreut darüber, wie viele ihrer Ideen aufgenommen worden waren. Auf einer Kritik jedoch beharrten sie: Dass statt der knalligen Farbigkeit ihrer Modelle eine einzige Farbe alle Elemente prägen soll, fanden sie klar ungenügend.Das neue Konzept ist für Begegnungszonen vorgesehen, die vornehmlich zum Spielen genutzt werden, nicht für solche im Zentrum mit Läden und intensivem Mischverkehr. Es kommt in diesen Tagen vor den Gemeinderat. Stimmt dieser zu, sollen vorerst eine bestehende Begegnungszone angepasst und eine neue eingerichtet und dann evaluiert werden.
Kinder evaluieren St.Johann-Quartier
Komplexer ist das Projekt «Jo! St. Johann», das seit 2006 vom Kinderbüro und der Fachstelle Stadtteilentwicklung im Präsidialdepartement geleitet wird: Kinder sollen im laufenden Stadtentwicklungsprozess im St.-Johann-Quartier mithelfen, die Lebensqualität für Kinder und Familien zu steigern. Im zwischen 1870 und 1930 entstandenen, von Industrie und Verkehr geprägten Arbeiterquartier auf der linken Rheinseite nördlich der Altstadt wohnen rund 18 000 Menschen, über 40 Prozent davon Ausländer.
Von den Kindern waren hier weniger konkrete Gestaltungsideen erwünscht als vielmehr eine Analyse von Stärken und Schwächen des Quartiers aus ihrer Sicht: eine Kartierung von beliebten und ungeliebten Orten und Wegen, die Art ihrer Nutzung durch Kinder und deren Gründe, sie aufzusuchen oder zu meiden. Ein zweites Ziel des Projekts «Jo! St. Johann» ist es, Planungsfachleute und Verwaltungsstellen, die über eine Begleitgruppe eingebunden wurden, für die Anliegen und die spezielle Perspektive von Kindern zu sensibilisieren.
Mit Kinderaugen sehen: Hilfsmittel und Methoden
Damit die Erfahrung der Kinder erfasst und in brauchbare Vorgaben für die Verwaltungsarbeit und die Quartierentwicklung umgemünzt werden kann, ist ein mehrstufiges Verfahren nötig. In einem ersten Schritt wurden Kinder mit altersgerechten Methoden befragt: Gruppen von drei bis fünf Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren unternahmen 27 Streifzüge durch das Quartier. Eine erwachsene Person protokollierte ihre Aussagen zu den Orten, die sie aufsuchten. Die Kinder fotografierten. Diese qualitative Erfassung wurde durch eine zweite, quantitative ergänzt: 503 Schulkinder füllten einen Fragebogen aus und erstellten Mental Maps, indem sie auf einer Stadtplanvorlage ihre persönlichen Wege und Nutzungsarten einzeichneten. Die Daten wurden mehrfach ausgewertet, unter anderem vom Institut Kinder- und Jugendhilfe der Fachhochschule Nordwestschweiz.2 Es wurden Risiko-Orte, positive Referenz-Orte und Orte mit Potenzial unterschieden und besonders relevante Themen kartiert, etwa Spiel und Sport, Naturerlebnis, Sozialkontakte, Nutzungskonflikte, verkehrssichere und vernetzte Aufenthaltsorte, Orientierungs- und Identifikationspunkte, Sauberkeit und Sicherheit.
Toll, da ist ein Loch im Zaun!
Diese Beleuchtung «von unten» ermöglichte eine integrale Betrachtung des Lebensraums der Kinder. Sie machte einerseits bewusst, wie stark bereits bekannte Gefahrenstellen und verkehrsreiche Strassen die Bewegungen der Kinder einschränken. Zwar stehen ihnen vielseitige Freizeitinstitutionen und Grünräume mit Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Oft verhindern aber stark befahrene Strassen und unübersichtliche Kreuzungen, dass sie sie allein aufsuchen können. Kinder zu ihren Freizeitaktivitäten begleiten zu müssen, bedeutet aber für Familien eine starke Einschränkung der Lebensqualität. Damit Parks, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen von möglichst vielen Kindern genutzt werden können, sollten sie mit einem Netz von verkehrsarmen Wegen erschlossen sein. Die Aktion förderte aber auch Überraschendes zutage: etwa, wie intensiv sich die Kinder im ganzen Quartier bewegen, wie gern sie es haben und wie gross die Bedeutung ist, die sie geschätzten Orten zuschreiben. Sichtbar wurde auch, dass gewisse private Innenhöfe von Kindern aus dem ganzen Quartier frequentiert werden und wie wichtig informelle Spielorte sind: eine gedeckte Anlieferungsrampe, die Mäuerchen um die Vorgärten oder Niveau- Unterschiede aller Art (Treppen, Mauern, Rampen, Böschungen). Beliebt sind auch kräftige Farben (Blumen und Graffiti), Verstecke, Brunnen und Wasserstellen, Sand, eine Bäckerei, Kleintiere, Schnecken und Spinnen.
Die Kinder wiesen auch auf Stellen, wo sie sich unwohl fühlen oder vom Verkehr überfordert sind, und formulierten präzise Anliegen. So fordern sie die in Tempo-30-Zonen aufgehobenen Fussgängerstreifen zurück und wünschen sich eine häufigere Strassenreinigung.
Leitsätze für eine kinderfreundliche Stadt
Sebastian Olloz von der Fachstelle Stadtteilentwicklung würde künftig noch mehr auf qualitative Erhebungsmethoden setzen: Die Streifzüge seien kindergerechter und ergiebiger als Fragebogen, ihre Resultate überraschender, konkreter und brauchbarer. Einige von den Kindern bezeichnete Gefahrenstellen konnten zusammen mit den zuständigen Stellen sofort verbessert werden, etwa mit längeren Grünphasen für Fussgänger oder besserer Beleuchtung. Andere Anliegen sollen mittel- und langfristig in Bauprojekte einfliessen. Daneben verarbeitet die Fachstelle Stadtteilentwicklung die Erkenntnisse aus dem Projekt unter dem Arbeitstitel «Auf Augenhöhe 1.20 m» zu einem Arbeitsinstrument. Dieses soll Leitsätze, einen Fragenkatalog, Good-Practice-Beispiele und Stolpersteine für eine kinderfreundliche Stadtentwicklung beinhalten. Es soll noch in diesem Jahr fertig werden und danach im ganzen Stadtgebiet ämterübergreifend zum Einsatz kommen. Denn Kinderfreundlichkeit – das zeigte auch das Projekt «Jo! St. Johann» – ist nicht eine Frage der Stadtplanung allein, sondern eine departementsübergreifende Aufgabe von der Stadtanalyse über Planung, Gestaltung und Bau bis zum Betrieb von Bauten und Anlagen. Das Arbeitsinstrument der Fachstelle Stadtteilentwicklung soll deshalb Fachpersonen aus Verwaltung und Privatwirtschaft einen Perspektivenwechsel auf die Augenhöhe von Kindern ermöglichen. So können Bedürfnisse und Anliegen der Kinder besser erkannt werden und in die Gestaltung ihres Lebensraums einfliessen. Denn vernetzte, anregungsreiche und natürliche, veränderbare und abwechslungsreiche Aufenthaltsbereiche sind wichtig für eine gesunde Entwicklung der Kinder.
Ob nun das Riehener Begegnungszonenkonzept restlos überzeugt oder nicht, und unabhängig davon, wie viele Kinderwünsche im St.-Johann-Quartier wirklich umgesetzt werden – dass Amtsstellen und Planungsfachleute Kinder ernst nehmen und in ihrer Arbeit den Perspektivenwechsel auf 1.20 m berücksichtigen, betrachtet das Kinderbüro Basel als grossen Gewinn und schönes Resultat seiner bisherigen Anstrengungen.TEC21, Fr., 2009.04.03
03. April 2009 Ruedi Weidmann
Lehren lernen
Das Projekt Architektur und Schule des Bundes Schweizer Architekten bemüht sich seit vielen Jahren, Architektur als Thema in der Volksschule zu etablieren. In Pilotprojekten auf allen Schulstufen hat es viele Erfahrungen gesammelt. Dabei hat sich der anfängliche Fokus auf architektonisches Gestalten weit geöff net zugunsten einer breiten Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für ihre gestaltete Umwelt. Zurzeit entstehen zwei Lehrmittel, die das Thema in den regulären Unterricht integrieren helfen.
Die mittlerweile über zehnjährige Geschichte des Schulprojektes ist eine Geschichte des Lernens, wie Architektur erfolgreich vermittelt werden kann. Im Zentrum der ersten Pilotprojekte standen kleine Entwurfsaufgaben, die von Architektinnen und Architekten im Unterricht begleitet wurden. Die Jugendlichen schätzten diese Begegnungen und die Arbeit am eigenen Projekt sehr; die Lehrpersonen fühlten sich sicher mit den sorgfältig vorbereiteten Übungen. Von Seiten der Architektenschaft allerdings wurden Vorbehalte laut, dass die Architektur durch die didaktisch notwendige Vereinfachung zu sehr banalisiert werde. Ein praktischer Nachteil war, dass sich die Aufgaben wegen des Aufwandes vor allem für den Projektunterricht innerhalb einer Woche eigneten und weniger für den regulären Stundenplan. Einer grossen Verbreitung dieser Übungen stand ausserdem die Tatsache im Wege, dass eine architektonisch vorgebildete Person für den Unterricht notwendig war.
Didaktische Grundsätze
Aus diesen und anderen Erfahrungen liessen sich einige Grundsätze ableiten, die in den weiteren Pilotprojekten verfolgt wurden. Die Übungen sollten kürzer sein, sodass sie im normalen Unterrichtsschema Platz finden würden. Aus mehreren Aufgaben sollten modular aufgebaute Kurse zusammengestellt werden können, die sich über kürzere oder längere Zeiträume erstrecken. Auf allen Stufen sollten neben dem gestalterischen auch andere Zugänge zu Architektur und Umweltgestaltung geschaffen werden, etwa über planerische, soziale oder ökonomische Fragestellungen. Wichtig war es auch, Unterrichtseinheiten zu entwickeln, die ohne eine Begleitung durch Fachleute auskommen und den Lehrpersonen die grosse Scheu vor der Profession Architektur nehmen können.
Auch diese Ansätze bergen Gefahren, unter anderem die, dass Übungen nicht unbedingt im Sinne der Verfasser durchgeführt werden und dass unter Umständen Gewichtungen entstehen, die aus fachlicher Sicht nicht unbedingt gerechtfertigt sind. Damit muss aber jede Fachdisziplin leben, die ihre Inhalte in den Schulunterricht tragen will, insbesondere wenn es sich nicht um eine exakte Wissenschaft handelt.
Entscheidend für den didaktischen Erfolg ist neben einer spannenden Übungsanlage die Stufengerechtigkeit. In allen Pilotprojekten wurde deshalb intensiv mit den Lehrpersonen zusammengearbeitet, um sicher zu sein, dass die Lehrinhalte und der Ablauf des Unterrichts auf die jeweilige Alterstufe abgestimmt sind. Sehr wichtig ist auch, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur mit Informationen «gefüttert» werden, sondern sich aktiv beteiligen können. So erleben sie, dass Gestaltung «gemacht» wird, und erinnern sich später leichter an das Gelernte.
Zugänge ermöglichen
Als Maxime dient der Begriff der Sensibilisierung. Die Kinder sollen Zugangsmöglichkeiten zum Thema erhalten, aber es kann nicht darum gehen, ihnen in Tagen ein Fachwissen zu vermitteln, für dessen Erarbeitung Studierende mindestens fünf Jahre Vollstudium brauchen. Eines der wichtigsten Ziele ist es, Kinder und Jugendliche auf das Thema aufmerksam zu machen und ihr Interesse zu wecken. Aus der Dissertation des deutschen Psychologen Riklef Rambow weiss man, dass Laien, insbesondere auch Kinder und Jugendliche, praktisch blind sind für ihre gestaltete Umwelt.[1] Sie erleben sie als schicksalshaft und kommen kaum auf den Gedanken, dass es sich um absichtsvolle und begründete Gestaltung handelt. Erst wenn ein Neubau farblich oder formal besonders auffällt oder wenn er in irgendeinem Sinn «stört», wird er wahrgenommen. Neben diesem ernüchternden Befund gibt die Studie aber auch Anlass zu Hoffnung. Es sei nämlich vergleichsweise einfach, Kinder und Jugendliche auf die Gestaltung ihrer gebauten Umwelt aufmerksam zu machen. Sie liessen sich sehr schnell auf das Thema ein und begännen, sich aktiv damit zu beschäftigen. Die Erfahrungen der Fachstelle Architektur und Schule bestätigen diese Aussage. Selbst Zehnjährige beginnen nach wenigen Vorübungen, sich in ihrem Wohnort umzuschauen und ihre Beobachtungen auszutauschen. So spazierte beispielsweise eine vierte Primarschulklasse nach ihrem Pilotprojekt zum Thema Wohnen durch eine andere Stadt und diskutierte eifrig, ob in der Altstadt noch Leute wohnten oder alles nur noch Läden und Büros seien.
Verankerung im Unterricht
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind die Sachzwänge des Unterrichtsbetriebes. Bei der Wahl von Lehrmitteln haben die Lehrenden einen untrüglichen Sinn für Machbarkeit entwickelt. Schwer zu realisierende Übungen, die viel Vorbereitung erfordern, Inhalte, die zu viel Fachwissen voraussetzen oder materiell zu aufwendig sind, haben daher keine Chance auf Akzeptanz und Verbreitung. Ausserdem muss ein Thema in den Lehrplan passen. Deshalb kann es nicht darum gehen, ein Fach «Architektur und Umweltgestaltung» anzustreben. Vielmehr sollen die Übungen zu diesem Thema im Schema der bestehenden Fächer und in der Logik der Lehrpläne Platz finden. Steht im Lehrplan für Bildnerisches Gestalten zum Beispiel Farbe auf dem Programm, soll das Architektur-Lehrmittel Übungen bereithalten, in denen Farbe anhand von Architektur behandelt werden kann.
Lehrmittel wohnen
Das gegenwärtig wichtigste Vorhaben der Fachstelle Architektur und Schule ist die Erarbeitung von zwei Lehrmitteln, um das Thema im allgemeinen Unterricht zu verankern. Das erste entsteht im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen. Es ist dem Thema Wohnen und dessen vielfältigen Abhängigkeiten und Bezügen gewidmet. Die Zielgruppe ist die Sekundar- I-Stufe, das heisst Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren. In einem Schuber werden sechs Hefte mit je sechs Lernmodulen zu einem Thema zusammengestellt. Mit ihnen soll auch fachübergreifendes Lernen möglich sein. Die Themen sind: Wohnumfeld und Aussenraum, Lebensweise und Wohnform, Haushaltsformen und Raumangebot, Landverbrauch und Flächennutzung, Heimat und Zersiedelung, Infrastruktur und leibliches Wohl. Die darin enthaltenen Übungen beruhen alle auf Pilotprojekten, die auf dieser Stufe mit Erfolg durchgeführt wurden. Dabei zeigt die Erfahrung, dass oft schon kleine Korrekturen der Aufgabenstellung zu wesentlich besseren Ergebnissen, grösserem Lernerfolg und einem spannenderen Lernerlebnis führen können. Als Beispiel sei die Übung «Mein Lieblingsraum, wenn ich 25 bin» genannt. Die Kinder sollen lernen, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, diese Wunschvorstellung räumlich umzusetzen und in einer perspektivischen Skizze zu bearbeiten. Dazu schreiben sie ein Szenario und ergänzen es mit einer Zeichnung. Sie überlegen sich, was ihr Lieblingsraum sein wird, wie gross er ist, was es für eine Aussicht gibt, was für eine Form er hat und welchen Funktionen er dient. Mit diesen Vorstellungen bauen sie ein Modell, das sie mit bereitgestellten Klötzchen möblieren. Der Blick in dieses Modell wird mit der zugehörigen Aussicht fotografiert und schwarzweiss ausgedruckt und dient als Grundlage für eine farbige Überarbeitung, die mit Referenzbildern zu Materialien, Farben, Möbeln oder Funktionen ergänzt wird. So gelingt es den Schülern, ihre Vorstellungen stufengerecht umzusetzen.
Die Kinder sollen sich aber nicht nur auf der gestalterischen Ebene mit der Wohnung beschäftigen. So studieren sie beispielsweise in Zeitungen und im Internet den Wohnungsmarkt und suchen für eine imaginäre Patchworkfamilie, die zusammenziehen will, eine geeignete Wohnung. Dazu gehört auch die Berechnung der Miete, die sich die Familie aufgrund der Einkommen und der Lebenshaltungskosten leisten kann. Im Modul «Ist die Schweiz eine Stadt?» beschäftigen sie sich im Fach Mathematik mit Bevölkerungsstatistik und Flächenverbrauch in den verschiedenen Siedlungsformen. Im Modul «Auch draussen wird gewohnt» gibt es ein Rollenspiel, in dem die Bewohner einer Siedlung aushandeln, wie der gemeinsame Aussenraum genutzt werden soll. So lernen die Kinder das Thema Wohnen auf verschiedensten Ebenen kennen.
Lehrmittel Architektur und Umweltgestaltung
Das zweite Lehrmittel in Vorbereitung richtet sich an Sekundarschulen und Gymnasien mit Schülerinnen und Schülern im Alter von 14 bis 20 Jahren. In einem Schuber werden 80 Bildkarten mit architektonischen und ingenieurbautechnischen Werken, Städten, Gärten und Landschaften enthalten sein. Auf der Vorderseite steht jeweils eine prägnante und möglichst vielfältig lesbare Abbildung, auf der Rückseite sind zusätzliche Bilder, Pläne, Textinforma tionen und Quellenhinweise zu finden. Diese Bildkarten bilden den Ausgangspunkt für die Übungen, die im beigelegten Heft für die Lehrperson beschrieben sind. Sie können aber auch frei verwendet werden, zum Beispiel für kurze Vortragsübungen oder eine Einführungsdiskussion. Das Übungsheft enthält konkrete Angaben für die Lehrpersonen, wie sie eine Unterrichtseinheit durchführen können, dazu Variationsmöglichkeiten und Abbildungen von Schülerarbeiten aus den durchgeführten Tests.
Auch dieses Lehrmittel kann in verschiedenen Fächern eingesetzt werden. Im Bildnerischen Gestalten beispielsweise wird das Thema Licht als Material der Architektur behandelt. Anhand der Bildkarten zur Kapelle von Ronchamp, zum Centre du Monde Arabe, zum Farnsworth House, zu einem Engadiner Bauernhaus, zu Franz Füegs Kirche in Meggen und weiteren Gebäuden lernen die Schüler die unterschiedliche Behandlung von Licht kennen. Darauf schneiden sie aus einem Kartonwürfel Lichtöffnungen und fotografieren den Innenraum. Resultat sind die so entstandenen «Lichtbilder». Die Übung kann ergänzt werden durch zeichnerische Übungen von Licht und Schatten im Schulhaus oder durch Kurzvorträge der Schüler zu je einer der genannten Bauten.
Im Fach Mensch und Umwelt schlägt eine Übung vor, eine historische Abbildung der Landschaft am Wohnort auszuwählen und am selben Ort heute eine Aufnahme zu machen. Diese werden verglichen und diskutiert. In einem dritten Schritt gestalten die Schülerinnen und Schüler eine Collage mit der zukünftigen Entwicklung, oder sie schreiben einen Text darüber. Als Vorbereitung dienen Bildkarten, die die Entwicklung der Schweizer Landschaft zeigen oder die sich sonst mit Erscheinungsformen von Siedlungen und Landschaft beschäftigen. Eine Übung widmet sich dem Thema Einfamilienhaus und Zersiedelung. In einer Diskussion übernehmen die Schülerinnen und Schüler die Rollen von verschiedenen Interessengruppen wie Landbesitzer, Investor, Kaufinteressentin, Umweltschützer, Gemeindeverwaltung usw. und diskutieren die Vor- und Nachteile einer Einfamilienhausbebauung. Der Test einer solchen Diskussionsrunde zur Planung des Hardturmstadions in Zürich hat wider Erwarten sehr erfreuliche Ergebnisse gezeigt. Die Schüler vertiefen sich in die Motive ihrer Rolle und schwelgen in ihren schauspielerischen Talenten; gleichzeitig lernen sie, dass Architektur und Umweltgestaltung nicht von Einzelnen bestimmt, sondern immer von vielen Akteuren beeinflusst werden.
Hohe Anforderungen an Lehrmittel
Lehrmittel müssen sich auf dem Markt behaupten. Verlage und Interessengruppen – vom WWF bis zu den Milchproduzenten – buhlen um die Aufmerksamkeit der Lehrpersonen. Ein neues Lehrmittel muss nicht nur ein relevantes Thema behandeln, sondern attraktiv und niederschwellig sein und die Lehrenden mit guten Übungsbeispielen animieren. Es muss erschwinglich, möglichst offen und modular gegliedert sein und Raum lassen für eigene Anwendungen. Dies gilt insbesondere für Lehrmittel in den Fächern Bildnerisches Gestalten, Sprache oder Mensch und Umwelt, in denen Architektur und Umweltgestaltung Platz finden sollen. Diese Rahmenbedingungen musste die Fachstelle Architektur und Schule erst kennen lernen und in die Konzeption ihrer Lehrmittel integrieren. Der Schulverlag, der voraussichtlich die beiden geplanten Lehrmittel produzieren und vertreiben wird, hat da mit seinem didaktischen und merkantilen Wissen entscheidend mitgeholfen. Die Fachstelle Architektur und Schule plant, nach der Einführung ihrer ersten beiden Lehrmittel in der Deutschschweiz französische und italienische Versionen zu erarbeiten.
Trotz dem Fortschritt bei der Etablierung des Vereins «Spacespot» und der Erarbeitung der Lehrmittel bleibt der Erfolg einer breit abgestützten Sensibilisierung für die gebaute Umwelt auch weiterhin von den Anstrengungen der Fachleute abhängig, die sich im Schulunterricht engagieren. Die Fachstelle Architektur und Schule ruft sie deshalb auf, jede Gelegenheit zu nutzen, interessierte Lehrpersonen mit Rat und Tat zu unterstützen. Die persönliche Begegnung mit Architektinnen oder Ingenieuren im Unterricht ist eine der wirksamsten Methoden, Schüler und Schülerinnen für das Thema zu begeistern.
Anmerkung:
[1] Riklef Rambow: Experten-Laien-Kommunikation in der Architektur. Münster, 2000TEC21, Fr., 2009.04.03
03. April 2009 Hansjörg Gadient