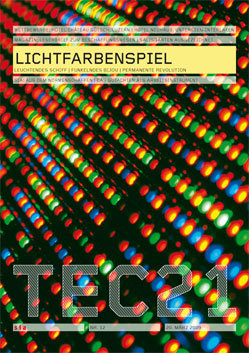Editorial
Anfang der 1970er-Jahre wurden die ersten lichtemittierenden Dioden, kurz LED, mit einer Lichtausbeute von unter 0.1 lm/W hergestellt. Knappe 50 Jahre später erreichen durchschnittliche LED um die 100 lm/W. Das ist einerseits eine beachtliche Steigerung, andererseits müssen die LED noch effizienter und günstiger werden, damit sie zu einer wirklichen Konkurrenz für herkömmliche Leuchtmittel im Baubereich werden können. Bei Spezialanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, werden LED aber gern genutzt, denn sie sind schaltfest, unempfindlich gegen Erschütterungen und langlebig. Verbreitet sind sie auch in Spitälern, denn sie erzeugen viel weniger Hitze im Operationsbereich und verbrauchen weniger Energie bei gleicher Lichtausbeute.
Fakt ist aber, dass LED heute mit etwa 6 Rp./Lumen noch wesentlich teurer als die herkömmlichen Systeme sind, die rund ein Hundertstel davon kosten. LED werden daher meist als Luxusobjekt gebraucht, als ein «Nice-to-have». Besonders für Medienfassaden und zur Akzentbeleuchtung werden sie eingesetzt, und ihre Reaktionsschnelligkeit wird genutzt, um visuelle Effekte für den Aussenraum zu erzeugen. Auf den Seiten 18 bis 28 dieser TEC21-Ausgabe werden Gebäude mit LED-beleuchteten Fassaden vorgestellt. In Linz wurde 2008 die Erweiterung des Ars Electronica Center (AEC) am Donauufer fertiggestellt. Die Fassadenbeleuchtung gilt mit ihren 40000 eingesetzten LED in Rot, Grün, Blau und Weiss als die derzeit grösste Medienfassade Europas. Im Massstab wesentlich kleiner und doch sehr auffällig ist das zweite Projekt, ein Neubau im Rohner Hafen nahe Bregenz am Bodensee. Das Gebäude wird für Veranstaltungen genutzt und überrascht seine Gäste mit Lichtspielen, die in der Abgeschiedenheit des Privathafens das Haus zu einer Art kleinem Leuchtturm werden lassen. Bei beiden Projekten wurde aber bei der Beleuchtung der Innenräume wiederum auf gängige Leuchtmittel gesetzt.
Nur selten gehen Planerinnen und Planer schon aufs Ganze und setzen eine komplette LED-Beleuchtung ein: Der Pariser Architekt Anthony Béchu entwickelte z.B. mit Philips ein Beleuchtungskonzept für die Büros des Versicherers Generali in Paris, und die Stuttgarter Architekten Behnisch stellten gemeinsam mit Nimbus das Lichtkonzept für die Hamburger Handelskammer fertig. LED-Systeme werden in Zukunft vielleicht heutige Leuchtmittel wie Glühlampe, Leuchtstoffröhre und Energiesparlampe ersetzen. Das Potenzial haben die kleinen Leuchtdioden sicherlich (S. 29ff.). Bis es soweit ist, erfreuen wir uns wohl weiter an bunten Lichtspielen, die die Möglichkeiten der LED bei Weitem nicht ausreizen.
Katinka Corts
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Hotel Château Gütsch in Luzern | Hotel Neuhaus, Unterseen-Interlaken
10 MAGAZIN
Leserbrief zum Beschaffungswesen | Salisgärten ausgezeichnet | Aus für Edisons Energieschleuder | Hilfe beim beruflichen Hürdenlauf
15 PERSÖNLICH
Ulrich Müther, Schalenbauer
18 LEUCHTENDES SCHIFF
Norbert Mayr
Die Fassade des erweiterten Ars Electronica Center in Linz ist die derzeit grösste Medienfassade Europas. 40000 LED beleuchten die gläserne Hülle und machen das Gebäude zum riesigen Bildschirm.
23 FUNKELNDES BI JOU
Katinka Corts
Im österreichischen Fussach steht seit 2008 ein kleines Veranstaltungs-gebäude im Hafenbecken. Bei Nacht erstrahlt die Fassade mithilfe von 1500 steuerbaren LED.
29 PERMANENTE REVOLUTION
Daniel Tschudy, Björn Schrader
Der technologische Fortschritt der LED ist immens. Und doch schöpfen die heute erhältlichen LED-Systeme noch lange nicht das Potenzial des Leuchtmittels aus.
34 SIA
Aus dem Normenschaffen des SIA | Raumplanung – Stopp der Zersiedelung? | Kurs: Einführung in das Normenwesen |
Das Gutachten als Arbeitsinstrument
36 PRODUKTE
36 FIRMEN
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Funkelndes Bijou
Eine scheinbar gewachsene Betonskulptur, umhüllt von Eisblumenglas und durchwirkt von farbigem Licht – das ist das neue Veranstaltungsgebäude, das «Nordwesthaus», im Rohner Hafen im österreichischen Fussach. Die Zwischenräume der Fassade werden von 125 LED-Leuchten mit Spezialoptik beleuchtet, und diese werden so gesteuert, dass das Gebäude fast in Bewegung zu sein scheint.
Das Gelände des heutigen Rohner Hafens bei Fussach war bis vor ein paar Jahren ein Kieswerk. Als dieses geschlossen wurde, entwickelte die Besitzerin des Geländes gemeinsam mit dem Architekturbüro Baumschlager Eberle ein Projekt für eine kleine Marina. Zunächst bauten die Architekten 1999 das Gebäude der Hafenverwaltung am Eingang des Geländes, ein kleines architektonisches Highlight. Als Ergänzung dazu sollte noch ein weiteres Gebäude entstehen, das für Veranstaltungen genutzt werden kann. Als Standort für den Neubau mit Veranstaltungsraum wurde die nordwestliche Ecke des 16 000 m² grossen Grundstücks gewählt: bei den Booten mit den hohen Segelmasten, in der Nähe der schilfumstandenen Hafeneinfahrt und in Sichtweite des Verwaltungsgebäudes (Abb. 05). Schon zu Beginn der Planung sollte das «Nordwesthaus» im Wasser gegründet werden, so konnte auch eine Bootsgarage darin Platz finden. Das 2008 fertiggestellte «Nordwesthaus» soll in angemessener Distanz ein attraktives Gegenüber, eine Art Gegenpol, sein. Gleichzeitig fassen beide Gebäude den relativ grossen Platz, der im Winter als Bootsparkplatz dient und auf dem sich im Sommer die Liegeplatzmieter und die Gäste treffen können. Bereits das Verwaltungsgebäude zog Architekturtouristen an, denn es ist eine Landmarke im Grünen am Bodensee in der Nähe von Bregenz. Mit dem Neubau schräg gegenüber haben die Architekten eine weitere Pilgerstätte geschaffen.
Zarte Betonhülle und Eisblumenglas
Vom Verwaltungsgebäude sind es nur ein paar Schritte zum «Nordwesthaus». Und doch liegen Welten und eine sicht- und spürbare technische Entwicklung zwischen den Bauten. Die Betonwände des Neubaus wurden im Entwurf gemeinsam mit den Ingenieuren von Mader & Flatz aus Bregenz so weit reduziert, dass sie Stämmen mit Ästen ähneln und Erinnerungen an Toyo Itos Tod’s-Gebäude in Tokio wecken.
Bei dem am Bodensee üblichen Wasserstand ( 396.00 m = lokales Null) ragt der Neubau etwa 13 m aus dem Wasser, unter dem Wasserspiegel reicht das Gebäude bis 2 m an den Seeboden. Der Unterbau wurde unter den Wasserspiegel verlängert, damit die «Garage» für Boote erreichbar ist. Der Betonkörper steht auf etwa 15 m langen Ortbeton-Bohrpfählen und widersteht Wasserdruck und Auftrieb. Von der Oberkante der Erdgeschossbodenplatte wächst ein Betongeflecht in biomorpher Form nach oben bis unter die Betondecke, welche die Basis für das Flachdach bildet. Als Bewehrung wählten die Ingenieure relativ dünne Betonstähle, die vor Ort zu Armierungskörben verarbeitet und in die Schalung «hineingedrückt » werden konnten. Anordnung und Menge der Betonstützen entsprechen einer Synergie aus den optischen Wünschen der Architekten und den statischen Vorgaben des Ingenieurs, so Mader. Die Analyse der Rohbaustruktur erfolgte anschliessend mit einfachen Ersatzquerschnitten. Die Lastannahmen umfassten den Bereich von Eigenlasten, Auflasten, Nutzlasten, Schnee, Wind, Wasserdruck und Erdbeben. Aus diesen Daten entwickelten die Ingenieure wiederum einige wenige Regelquerschnitte, in denen die Anordnung von Bewehrung und Leitungsführung vereinheitlicht wurden. Über die gesamte Höhe des Stahlbetongeästes wurde die Schalung vor Ort in vier Abschnitten gesetzt. Mit wenigen gekrümmten Schalungs elementen konnten alle Aussparungen der Etappen in den Wänden geformt werden. Im Anschluss wurden die Wände sorgfältig gegossen, die Schalungen nach der Trocknung entfernt, gesäubert und neu kombiniert für die anders geformten Aussparungen der weiteren Abschnitte verwendet.
Der Neubau wirkt filigran, scheint fast zerbrechlich. Diesen Eindruck verstärkt zudem das Glas, das ihn umhüllt und das an Eisblumen erinnert (Abb. 06 – 08). Diese spezielle Oberflächenbearbeitung, vom Hersteller «Ice-H» genannt, ist bei allen Gläsern mit einer Stärke ab 3 mm möglich. Auf das Glas wird eine Flüssigkeit aufgebracht, die sich beim Aushärten zusammenzieht und dabei kleinste Teile aus der Glasoberfläche bricht. Das entstandene Dekor im Glas ist somit kein wiederkehrendes Muster, sondern an jeder Stelle einmalig – ähnlich dem Craquelé bei Ölgemälden oder den Haarrissen in den Raku-Keramiken. Diese Bearbeitungsform ist schon seit mehreren Hundert Jahren bekannt und wurde ursprünglich zur Verzierung von Schmuck- und Glasteilen, später auch für Innendekor verwendet. Die Architekten entschieden sich für diese Glasoberfläche, weil sie für das Gebäude eine transparente Hülle wollten, die nicht aus Mattglas besteht und durch die die «Betonbäume» noch erkennbar sein sollten.
Schlichter Innenraum im Farbspiel
Über eine kleine landseitige Brücke gelangt man durch ein überhohes Tor in das Veranstaltungsgebäude und in einen kleinen Vorraum auf Erdgeschossniveau (Abb. 09). Zur tiefer liegenden Bootsgarage führen Betonstufen, die je nach Jahreszeit und Wasserstand überspült werden. Der Bootsplatz kann zum Beispiel bei Veranstaltungen genutzt werden. Geht man nach oben, findet man sich im Hauptraum, dem Veranstaltungsbereich, wieder. Hier gibt es neben dem Treppenaufgang eine schmale Cateringküche, die nur bei Bedarf geöffnet wird und sonst als eleganter Edelstahlriegel dezent im Raum steht. Der Raum wird nicht beheizt und kann im Sommer von jedermann für Seminare, Workshops und Apéros für bis zu 100 Leute gemietet werden. Je nach Veranstaltung können Holztische und -bänke in Reihe, übereck oder frei arrangiert werden. Der Hingucker im Raum ist, wie von aussen auch, die Betonhülle mit ihren Zwischenräumen, die nur bei abendlichen Veranstaltungen von farbigen LED beleuchtet werden. Eine ständige Beleuchtung in den Abendstunden ist nicht vorgesehen, da sich der Hafen im Naturschutzgebiet Rheindelta befindet.
Für die Allgemeinbeleuchtung wurden 30 Downlights in die rohe Betondecke eingebaut. 125 LED-Leuchten sorgen für eine effektvolle Akzentuierung in der Fassade. Damit die Leuchten von den Besucherinnen und Besuchern möglichst nicht gesehen werden, wurden sie in die Laibungen, sozusagen in die Astgabeln, eingelassen (Abb. 16). Sämtliche benötigten Leerrohre für die Kabelführung befinden sich zwischen der Bewehrung im Beton, in den Decken sowie in den «Ästen» und «Stämmen». Damit die Strahler (Abb. 15) nur die Astgabeln beleuchten und kein Streulicht in den Raum abgeben, wurde auf die Leuchte eine extrem asymmetrische Sekundäroptik mit einer Linse gesetzt.[1] Diese erlaubt eine weite Abstrahlung in die Laibung, lässt das Licht quer dazu, aber nur sehr eng in den Raum, sodass keine Blendung entsteht. So wird auch das Licht der wenigen Strahler, die direkt in die Bodenplatte eingesetzt wurden, nicht als unangenehm empfunden. Jede Leuchte ist mit je vier Highpower-LED in Rot, Grün und Blau (RGB) ausgestattet und kann direkt über eine DMX-Steuerung angesprochen werden.[2] Die zwölf Lichtpunkte sind nicht symmetrisch gesetzt, sondern so, dass die Abstände der drei Farben immer so gering wie möglich gehalten sind und damit die bis zu 9 m hohen Hohlräume möglichst gleichmässig ausgeleuchtet werden. Zu Beginn der Planung waren noch RGB-W-Leuchten angedacht, pro Farbe drei LED. Die weissen LED wurden dann aber zugunsten des Lumenoutputs der farbigen LED weggelassen, und es wurden jeweils vier LED eingesetzt. Reines Weiss gibt es als Beleuchtung damit nicht, für die Fassade wird via DMX ein Weiss aus den Farben gemischt. Mithilfe der eingesetzten Steuerungssoftware werden die Farben Rot und Grün, die ein stärkeres Lumenoutput haben als Blau, heruntergeregelt und Blau zu 100 % eingeschaltet. Dabei nutzt man den Effekt, dass das menschliche Auge sehr träge ist und das Gehirn einen etwaigen Farbstich korrigiert. Die Lichtplaner programmierten einige Lichtszenarien, vom kühlen Weiss über wallende grün-türkise Farbverläufe, die an Schilf im Wasser erinnern sollen, bis hin zum «Feuer», bei dem das Gebäude mehr und mehr in den gelben und roten Lichtflammen aufgeht (Abb. 12).
Die Frage nach dem Geld
Man darf sie stellen. Die Antwort ist allerdings ernüchternd. «Keiner hat was an dem Bau verdient, es wurde viel Neues ausprobiert, und daher ist das Projekt nicht mit anderen zu vergleichen», so Maria Rohner, die Bauherrin. Architekten, Ingenieure und Lichtplaner halten sich bedeckt, stimmen aber gern mit ein und ergänzen: «Es war eine spannende Zusammenarbeit, und alle Baubeteiligten haben viel Herzblut in das Projekt gesteckt», sagt Ledon- Projektleiter Bernd Clauss. Als die Architekten der Bauherrschaft ihr Projekt vorstellten, war diese begeistert, das Budget allerdings weit überschritten. In der Zumtobel-Gruppe, zu der auch Ledon gehört, fand sie einen Partner, der einen Grossteil der Beleuchtungskosten übernahm. Den Bau nutzt Ledon dafür als überdimensionales Werbeschild für das eigene Marketing. «Für uns ist das ein tolles Vorzeigeprojekt direkt vor unserer Haustür», so Clauss. Das Resultat ist ein Bau, in und an dem tatsächlich viel Neues zu finden ist. Einige der im Gebäude eingesetzten Produkte – wie beispielsweise die Betonschalung, das Eisblumenglas und besonders die LED-Leuchten – sollen in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden. Nicht nur der räumlichen Nähe der am Bau Beteiligten – alle im Umkreis von maximal 30 km –, sondern wohl auch der Freude am Experimentieren mit Form und Farbe ist es geschuldet, dass Auftraggeber und -nehmende dieses Projekt mit Lust und Engagement umgesetzt haben. Mit dem «Nordwesthaus» ist sicherlich eine neue Landmarke für Architekturtouristen entstanden. Und wenn es der Zufall so will, sehen diese es auch vor dem Nachthimmel funkeln.
Anmerkungen:
[1] Die Technologie der Linse gibt es nach Auskunft von Ledon schon lange, aber die gesamte Leuchte (inklusive Platine und Anordnung der LED) wurde für das Projekt neu entwickelt
[2] DMX ist ein Protokollstandard für eine Niedervolt-Steuerung in der Theatertechnik. Im Gegensatz zu DALI sendet DMX ständig Informationen und ermöglicht sehr schnelle Eff ekte und FarbwechselTEC21, Fr., 2009.03.20
20. März 2009 Katinka Corts-Münzner
verknüpfte Bauwerke
Nordwesthaus