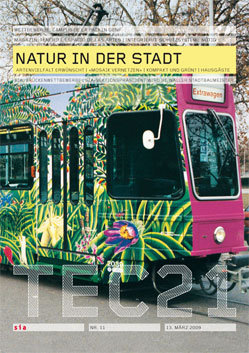Editorial
«Vielfalt ist eine Lebensversicherung», schrieb Mathias Plüss kürzlich im «Magazin» des «Tages-Anzeigers»[1], denn «Vielfalt bedeutet: Wenn etwas schiefgeht, sind nicht gleich alle betroffen. Vielfalt bedeutet: Wenn sich eine neue Aufgabe stellt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass schon einer da ist, der sie lösen kann.» Diese Feststellung gilt für viele Systeme. Sie ist in Zeiten sich rasch ändernder Umweltbedingungen auch ein gewichtiges Argument für die Erhaltung einer unserer wesentlichen Lebensgrundlagen: der Biodiversität, also der Vielfalt an Arten und Lebensräumen sowie der genetischen Vielfalt. Zwar hat sich die Schweiz gemeinsam mit anderen europäischen Ländern dazu verpflichtet, den Verlust an natürlicher Vielfalt bis ins Jahr 2010 zu stoppen. Die Erarbeitung einer konkreten Strategie dafür wurde in der Schweiz aber lange verzögert und erst kürzlich in Angriff genommen.
Den Städten kommt eine wichtige Rolle beim Schutz der Biodiversität zu, denn ein immer grösserer Anteil der Bevölkerung weltweit lebt in Städten. Natur und ihre Vielfalt im Wohnumfeld erleben zu können, ist nicht nur ein wichtiger Aspekt der Lebensqualität, sondern vermeidet auch weite Fahrten ins Grüne, um das Bedürfnis nach Natur ausleben zu können. Nicht zuletzt erhöht das Erleben von Artenvielfalt auch die Chance, dass sich die Stadtbewohner für deren Erhalt einsetzen.
Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen ist aber auch eine der Hauptursachen für den Rückgang der Biodiversität. Schutz der Biodiversität heisst damit in erster Linie, das weitere Ausufern versiegelter Flächen zu vermeiden und stattdessen bestehende Siedlungen zu verdichten. Damit erhöht sich aber auch der Druck auf die Grünräume in den Städten. Die Artikel zum Thema in diesem Heft zeigen jedoch, dass das Potenzial für die Förderung der Biodiversität auch in kompakteren Städten gross ist: Die Bevölkerung wünscht sich abwechslungs- und damit auch artenreiche Grünflächen. Durch eine entsprechende Gestaltung und Bewirtschaftung liesse sich die Vielfalt erhöhen (S.18ff.). Zentral ist auch die Erhaltung besonders wertvoller Naturräume und die Vernetzung dieser Gebiete untereinander, auf die beispielsweise die Stadt Zürich hinarbeitet (S.23ff.). Dass in kompakten Städten auch die Vertikale für Grünräume erschlossen werden könnte und die kleinen, ungeplanten Grünräume gefördert werden sollten, schlägt der Artikel «Kompakt und grün?» vor. In «Harmlose Hausgäste schützen» schliesslich wird das Augenmerk auf Fledermäuse gelegt, deren Lebensraum u.a. durch energetische Sanierungen und Dachausbauten bedroht ist. Weiss man um die Bedürfnisse dieser Tiere, lassen sich nachhaltiges Bauen und Artenschutz aber durchaus unter einen Hut bringen.
Claudia Carle
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Campus de la Paix in Genf
10 MAGAZIN
Tenerife Espacio de las Artes | «Bailout» rettet Museum | Partikelfilter ohne Nebenwirkungen | CO2-Fixierung im Boden | Integrierte Schutzsysteme nötig | Kranke Bäume als Quelle für Treibhausgase
18 ARTENVIELFALT ERWÜNSCHT
Claudia Carle
Ein Forschungsprojekt untersuchte, wie Grünräume in der Stadt gestaltet sein müssen, damit sie eine hohe Artenvielfalt aufweisen und gleichzeitig den Wünschen der Bevölkerung entsprechen.
23 «MOSAIK DER LEBENSRÄUME ERHALTEN UND VERNETZEN»
Lukas Denzler
Im Interview erläutert Karin Hindenlang, Leiterin Naturförderung bei Grün Stadt Zürich, was in Zürich für den Schutz der Biodiversität getan wird.
26 KOMPAKT UND GRÜN?
Ingeborg Schinninger, Rudolf Maier, Werner Nöbauer
Eine Studie aus Wien ging der Frage nach, wie Städte trotz verdichteter Bauweise ausreichend Grünräume aufweisen können.
28 HARMLOSE HAUSGÄSTE SCHÜTZEN
Irene Weinberger
Fledermausquartiere werden oft bei Sanierungen oder Umbauten zerstört. Dabei liessen sie sich mit wenig Aufwand erhalten.
34 SIA
Der Brückenwettbewerb | Stadtbaumeister St. Gallen | SIA-Mitglieder zeigen ihr Werk | Zwei neue Normen
36 MESSE UND PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Artenvielfalt erwünscht
Städte werden oft als das Gegenteil von Natur wahrgenommen. Dabei weisen städtische Grünräume eine erstaunlich hohe Vielfalt an Tierarten auf, wie ein interdisziplinäres Forschungsprojekt in drei Schweizer Städten zeigte. Es untersuchte, von welchen Faktoren die Artenvielfalt in den sehr unterschiedlichen städtischen Grünräumen abhängt. Ausserdem wollte man wissen, ob sich eine grosse Artenvielfalt auch mit den Wünschen der Bewohner an ihre grüne Umgebung deckt.
Natur in der Stadt hat viele Gesichter: Sie reicht von exakt geschnittenen Rasenflächen bis zu wild wucherndem Grün auf ungenutzten Bahnarealen, von Einzelbäumen am Strassenrand bis zu grossflächigen Parks, von der neu gestalten Grünanlage bis zu uralten Villengärten. Teilweise nehmen wir diese Flächen mehr als grüne Dekoration denn als Lebensräume für Pflanzen und Tiere wahr. Aber auch diese vom Menschen oft stark beeinflussten Orte dienen einer erstaunlich vielfältigen Artengemeinschaft als Lebensraum. «Wir waren überrascht, wie viele Arten selbst an unattraktiven Standorten in der Stadt leben», sagt Fabio Bontadina von der Zürcher Arbeitsgemeinschaft SWILD. Zusammen mit Projektpartnern von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), den Universitäten Bern und Zürich sowie dem Planungsbüro Studi Associati SA aus Lugano untersuchte er im Rahmen des Forschungsprojektes «BiodiverCity»[1] die Artenvielfalt in städtischen Grünräumen und die Erwartungen der Bevölkerung an diese Räume. Beantwortet werden sollte dabei die Frage, wie aus Sicht der Bevölkerung bzw. unter dem Aspekt der Artenvielfalt der optimale Grünraum aussieht und ob sich diese Ansprüche zur Deckung bringen lassen.
Erhebung von Artenzahlen und Eigenschaften der Grünräume
Um die Artenvielfalt und die massgeblichen Einflussfaktoren zu bestimmen, wurden in den Städten Lugano, Luzern und Zürich die Artenzahlen von Vögeln, Fledermäusen sowie Insekten und Spinnen erhoben. Dafür wurden in jeder der drei Städte 32 Unter suchungspunkte festgelegt. Innerhalb eines Radius von 50 Metern um diese Punkte wurden mögliche Einflussfaktoren für die Artenzahlen erfasst: der Versiegelungsgrad, das Alter des Grünraumes und die Häufi gkeit der Rasenschnitte als Mass für die Bewirtschaftungsintensität. Um ein Mass für die Vielfältigkeit innerhalb der Untersuchungsflächen zu erhalten, wurde auch erhoben, aus welchen verschiedenen Lebensraumtypen wie Wiesen, Bäumen oder Sträuchern sie sich zusammensetzen und wie diese räumlich angeordnet sind, das heisst, ob es sich um jeweils grosse Flächen oder ein kleinteiliges Mosaik handelt.
«Die Artenvielfalt, die wir an einem bestimmten Punkt vorfi nden, wird auch durch die Eigenschaften der Umgebung bestimmt», erläutert Thomas Sattler von der WSL. «Je isolierter und je schwerer zugänglich ein Grünraum ist, desto weniger Arten können von benachbarten Grünflächen einwandern bzw. desto grösser ist die Gefahr, dass eingewanderte Arten wieder aussterben.» Dieser Effekt ist unterschiedlich stark, je nachdem wie mobil eine Art ist. Für flugunfähige Insekten ist die Umgebung in einem viel kleineren Radius relevant als für Vögel oder Fledermäuse.
Um den Einfluss der Grünraumeigenschaften auf die Artenzahlen berechnen zu können, wurden die Untersuchungspunkte so ausgewählt, dass sie eine möglichst grosse Bandbreite erfassen: von ganz neu angelegten Grünarealen bis zu über 150 Jahre alten, von nahezu unversiegelten Flächen bis hin zu Bereichen mit 92 % Versiegelungsgrad und von Gelände, das nicht bewirtschaftet wird, bis hin zu alle zehn Tage gemähten Rasenflächen.
Überraschend hohe Artenvielfalt
Trotz dieser grossen Bandbreite sind die Artenzahlen relativ homogen. Zum einen fanden die Forschenden in allen drei Städten durchschnittlich etwa gleich viele Arten pro Standort (Abb. 3). Ausserdem unterscheiden sich die Artenzahlen zwischen den artenärmsten und den artenreichsten Standorten weniger stark als von den Forschern erwartet. Insgesamt beherbergen alle drei Städte eine «überraschend hohe Artenvielfalt», schreiben die Forscher. Bei den Insekten und Spinnen liegt sie beispielsweise in der gleichen Grössenordnung wie in Landwirtschafts- und Waldgebieten (Abb. 5). Es wurden auch mehrere Arten gefunden, die bisher in der Schweiz noch nie beobachtet wurden. Grösstenteils sind dies mediterrane Arten, denen Städte als Wärmeinseln das Überleben auch ausserhalb ihres angestammten Verbreitungsgebietes ermöglichen.
Gestaltung einer Grünfläche entscheidend für Artenvielfalt
Wenig überraschend ist hingegen, in welchen Grünräumen die höchsten Artenzahlen vorkommen (Abb. 4): Je älter eine Grünfläche ist und je mehr Strukturvielfalt sie aufweist, desto mehr Insekten- und Spinnenarten leben dort. Je stärker versiegelt hingegen eine Fläche ist und je häufi ger sie bewirtschaftet wird, umso weniger Insekten und Spinnenarten fühlen sich dort wohl. Für Vögel ist vor allem die Strukturvielfalt und hier besonders die Anzahl an Bäumen entscheidend: Je mehr Bäume, desto mehr Vogelarten, wobei eine Mischung aus Laub- und Nadelbäumen optimal ist. Für die Fledermäuse werden die Auswertungen erst im Herbst 2009 abgeschlossen.
Die Botschaft der Biologen lautet also, dass die wichtigsten Entscheidungen für die Artenvielfalt eines Grünraumes bei dessen Gestaltung getroffen werden: über den Versiegelungsgrad, die Vielfalt an Strukturen und die Anzahl an Bäumen. «Das sollten Grünraumplaner neben den ästhetischen Kriterien mit berücksichtigen», wünscht sich Fabio Bontadina. Ist die Gestaltung einmal festgelegt, hat aber auch die Bewirtschaftungsintensität einen grossen Einfluss. «Auch in eher stark versiegelten Flächen kann bei extensiver Bewirtschaftung die Artenvielfalt relativ hoch sein», heisst es im Ergebnisbericht von BiodiverCity.
Grün ist wichtig für städtische Lebensqualität
Aber wünschen sich die Stadtbewohner überhaupt artenreiche Grünräume? Oder haben sie ganz andere Prioritäten? Und welche Bedeutung hat das städtische Grün für ihre Lebensqualität? Diesen Fragen ging man im sozialwissenschaftlichen Teil des Forschungsprojekts nach. Dafür wurden 7000 Fragebogen an einen repräsentativen Querschnitt der Schweizer Bevölkerung verschickt. Befragt wurden somit nicht nur Stadt-, sondern auch Bewohner nichtstädtischer Gebiete. Der Rücklauf an Fragebogen war mit 26% erstaunlich hoch. «Es zeigte sich sehr deutlich, dass Grünräume ein wichtiger Teil der Lebensqualität sind», erklärt Robert Home von der WSL. Dabei messen Stadtbewohner den Grünräumen eine grössere Bedeutung zu als die Landbewohner. Insgesamt schätzen Stadtbewohner ihre Lebensqualität niedriger ein als Landbewohner. «Das zeigt, dass Natur in der Stadt von spezieller Bedeutung ist, weil sie einen Kontrast zum gebauten Umfeld bildet», so Robert Home. «Offensichtlich scheint bei den Städtern das Gefühl eines Mangels die Wichtigkeit von Grünräumen zu erhöhen.» Von dieser These sei man zwar immer ausgegangen, wissenschaftliche Belege habe es dafür aber bisher nicht gegeben.
Naturnah, aber gepflegt
Wie diese Grünräume aus Sicht der Bevölkerung konkret aussehen sollen, wurde neben dem Fragebogen auch mit computergenerierten Fotos untersucht, die einen städtischen Grünraum in verschiedenen Gestaltungsvarianten zeigen (Abb. 6 bis 9). Bevorzugt wurden von den Befragten jene Varianten, die relativ komplexe, also abwechslungs- und strukturreiche Grünräume zeigen. «Es wurden viel komplexere Grünräume bevorzugt, als wir erwartet hatten», so Robert Home. Nach Wildwuchs darf es aber trotzdem nicht aussehen: Die Befragung zeigte, dass die Grünflächen zwar naturnah sein dürfen, aber gleichzeitig gepflegt aussehen müssen. «In der Praxis könnte das zum Beispiel bedeuten, dass man der Begehbarkeit zuliebe Wiesenflächen nur am Rand schneidet und in der Mitte das Gras stehen lässt (bei Spielwiesen umgekehrt). Die Übergangsbereiche zwischen geschnittenen und ungeschnittenen Bereichen können auch ökologisch wertvoll sein. Zusätzlich könnte man auf Schildern erläutern, warum das Areal so gestaltet wurde.»
Angebote für verschiedene Nutzer
Die Auswertung zeigte auch, dass die Bevölkerung Natur nicht nur um der Natur willen möchte, sondern die Grünräume zugänglich und nutzbar sein sollen – auch für diejenigen, die sie real gar nicht nutzen. Das heisst, dass sie in relativ kurzer Zeit erreichbar sein müssen und Möglichkeiten für verschiedene Nutzerinteressen anbieten sollten, beispielsweise Wege, Bänke und Spielmöglichkeiten. Zum Wunsch nach Zugänglichkeit gehört auch, dass man sich in den Grünanlagen sicher fühlen muss. Hier ortet Fabio Bontadina eine mögliche Schwäche des Forschungsprojektes. Die Fotomontagen zeigen die Grünräume an einem hellen, sonnigen Tag. «Wir haben uns gefragt, ob die Leute bei der Betrachtung der Bilder immer alle Konsequenzen bedacht haben. Würden sie in einer Nachtsituation immer noch die strukturreichen Grünräume bevorzugen, wenn Bäume und Sträucher die Sicht einschränken? Oder wie sieht es aus, wenn sich der unbefestigte Weg an einem Regentag in Matsch verwandelt?» Vom Umfang des Forschungsprojektes her waren hier aber Grenzen gesetzt.
Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit?
Vergleicht man die in der Untersuchung geäusserten Wünsche der Bevölkerung mit den Anforderungen an möglichst artenreiche Grünräume, dann decken sich beide Ansprüche zu einem überraschend grossen Teil. «Sind Grünräume so gestaltet, wie sie sich die Bevölkerung gemäss unseren Untersuchungen wünscht, ist man vom Optimum aus Sicht der Biodiversität gar nicht so weit weg», meint Fabio Bontadina. In einem Nachfolgeprojekt soll untersucht werden, ob die Stadtbewohner eine naturnahe Gestaltung von Grünanlagen noch stärker unterstützen, wenn dadurch bestimmte Tierarten neuen Lebensraum erhalten. Erste Analysen haben gezeigt, dass beispielsweise der Buntspecht sowohl ein Indikator für eine hohe Biodiversität im Siedlungsgebiet ist als auch bei der Bevölkerung sehr beliebt ist. Die Forscher stellen sich vor, dass solche Sympathieträger als Botschafter für naturnahe Aufwertungen dienen und damit mehr Natur im Siedlungsraum ermöglichen könnten. «Wenn man sich andererseits anschaut, wie Grünräume heute tatsächlich gestaltet sind, hat man den Eindruck, dass die Planer die Bedürfnisse der Bevölkerung falsch einschätzen», so Bontadina. Man wolle daher in einem Nachfolgeprojekt die gleiche Befragung mit Grünraumplanern durchführen, um hier mögliche Unterschiede zwischen den Wünschen der Bevölkerung und der Einschätzung durch Experten aufzudecken. Damit die Ergebnisse des Forschungsprojektes Eingang in die Praxis finden, ist ausserdem geplant, konkrete Empfehlungen für Grünraumplanung und -bewirtschaftung zu erarbeiten, mit denen die Biodiversität städtischer Grünräume erhöht werden kann.
Anmerkung:
[1] Das Projekt «BiodiverCity» ist Teil des Nationalen Forschungsprogramms NFP 54 «Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung» und wurde von folgenden Personen durchgeführt: Marco Moretti (WSL, Projektleiter), Nicole Bauer (WSL), Fabio Bontadina (Uni BE, SWILD), Paolo Della Bruna, (Studi Associati SA), Peter Duelli (WSL), Sandra Gloor (SWILD), Robert Home (Uni ZH, WSL), Marcel Hunziker (WSL), Martin Obrist (WSL), Thomas Sattler (Uni BE, WSL), Simone Fontana (WSL, Uni BS); www.nfp54.ch; www.biodivercity.chTEC21, Fr., 2009.03.13
13. März 2009 Claudia Carle
«Mosaik der Lebensräume erhalten und vernetzen»
Im Jahr 2008 lebten weltweit erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Obwohl nach Angaben des Uno-Umweltprogramms UNEP Städte nur zwei bis drei Prozent der Landfläche beanspruchen, verfügen sie über eine erstaunlich hohe Biodiversität. Sie verbrauchen aber 75 Prozent der weltweiten Ressourcen. Daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung der Städte für den Schutz der Biodiversität. Wie die Stadt Zürich diese Herausforderung meistern will, erläutert Karin Hindenlang, Leiterin Naturförderung bei Grün Stadt Zürich.
TEC21: Stadtnatur wird bis heute oft als Natur zweiter Klasse empfunden. Seit wann ist die Natur in Zürich ein Thema? Karin Hindenlang: Engagierte Menschen haben schon vor vielen Jahren damit angefangen, für spezielle Arten wie Vögel oder Fledermäuse etwas zu tun. Innerhalb der Stadtverwaltung hat man vor etwa 20 Jahren erkannt, dass zwischen Grünflächenbewirtschaftung und Naturschutz Synergien stärker genutzt werden können. Wichtig war natürlich auch die Erkenntnis, dass Grünflächen und Natur für die städtische Lebensqualität sehr wichtig sind. Kinder können beispielsweise in naturnahen Gebieten für ihre Entwicklung wichtige Erfahrungen machen, die in stark überbauten Gebieten nicht möglich sind. Die künftige Herausforderung in Zürich besteht zum einen darin, die bestehenden wertvollen Naturräume zu schützen und diese besser miteinander zu einem funktionalen Grünraum zu vernetzen. Zum anderen gilt es, das kleinräumige Mosaik von vielfältigen Lebensräumen in der Stadt zu erhalten. 1990 wurde das Inventar der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte per Stadtratsbeschluss in Kraft gesetzt, das heute 560 Objekte auf Stadtgebiet umfasst; die 20 wertvollsten Gebiete wurden 2003 formell unter Schutz gestellt, weitere sollen in den nächsten Jahren folgen.
TEC21: Was macht Städte für wild wachsende Pflanzen und wild lebende Tiere so attraktiv? Karin Hindenlang: Städte zeichnen sich durch ein sehr kleinräumiges Mosaik von Lebensräumen aus. Diese Kleinräumigkeit und der Strukturreichtum kommen durch die menschliche Nutzung zustande. Die Kombination von Nutzung, Gestaltung und Ökologie macht die Stadt zu etwas Besonderem. Wärmeliebende und an karge Standorte angepasste Arten finden ebenso Lebensraum wie Wald- oder Feuchtgebietsbewohner. Gebäude, Dächer, Mauern stellen für Vögel, aber auch für andere Tier- und Pflanzenarten einen Ersatz für Felsen dar, so zum Beispiel für Steinmarder, Turm- und Wanderfalken, den Dreifingrigen Steinbrech und die Königskerze.
TEC21: In Zürich leben Alpensegler an Grossmünster und Fraumünster; am Kamin des Heizkraftwerks Josefstrasse brüten Falken (siehe Kasten). Sind das Einzelfälle? Karin Hindenlang: Nein, das sind keine Einzelfälle. Im Inventar der Gebäudebrüter – dazu zählen Mauer- und Alpensegler, Falken, Schwalben und Dohlen – sind über 1000 Gebäude verzeichnet. Die Brutplätze sind bekannt, aber nur ein Bruchteil dieser Gebäude ist auch geschützt. Wenn also ein Umbau realisiert wird, dann können wir oft nur über Beratung oder Sensibilisierung bewirken, dass das Brutangebot erhalten bleibt. Solche Flagship-Arten sind für uns eine grosse Chance, um die Bevölkerung für Naturwerte zu sensibilisieren.
TEC21: Betrachten wir nun auch die etwas weniger spektakulären Arten. Welche Gebiete der Stadt Zürich sind für das Überleben von Tieren und Pflanzen besonders wichtig? Karin Hindenlang: Dazu zählen sicher der Üetliberg, die Allmend Brunau und die Katzenseen, aber auch bewaldete Bachläufe wie etwa das Wehrenbachtobel. Diese Gebiete bezeichnen wir als Kerngebiete. Aber auch die Obstgärten sind wertvoll. Mit dem Projekt «10 000 Obstbäume» wollen wir diese nicht nur erhalten, sondern auch neue pflanzen. Im besiedelten Raum gibt es ungezählte kleine wertvolle Gebiete.
TEC21: Gibt es auch Gebiete, die auf den ersten Blick nicht als besonders wertvoll erscheinen, für die Erhaltung der Biodiversität aber trotzdem bedeutsam sind? Karin Hindenlang: Ja, dazu zählt etwa das SBB-Areal um den Hauptbahnhof. Diese kargen Ruderalflächen sind wichtige Lebensräume für Reptilien und verschiedene Insektenarten. Bedeutsam sind diese Flächen, weil sie längerfristig erhalten bleiben, was bei Industriearealen nicht immer der Fall ist.
TEC21: Was unternimmt Grün Stadt Zürich konkret, um diese wertvollen Gebiete zu schützen? Karin Hindenlang: Über den Richtplan und die Nutzungsplanung versuchen wir, die Interessen des Naturschutzes zu wahren. Auch wenn heute einige wertvolle Objekte geschützt sind, sind wir mit der Situation konfrontiert, dass 90 Prozent der wertvollen Flächen zwar inventarisiert, aber die wenigsten davon auch rechtlich geschützt sind. Zudem sind seit 1990 vor allem in der Bauzone rund 100 wertvolle Objekte oder 45 Hektaren durch Bautätigkeit zerstört oder verändert worden. Das möchten wir in Zukunft ändern. Im «Grünbuch der Stadt Zürich» aus dem Jahre 2006 ist festgehalten, dass die geschützten Flächen um 140 Hektaren auf rund 250 Hektaren zunehmen sollen. Dazu hat sich die Stadt Zürich auch im Rahmen der internationalen Initiative «Biodiversity Countdown 2010» (siehe Kasten S. 25) verpflichtet.
TEC21: Sind die Grundlagen wie Inventare für den Schutz der Biodiversität vorhanden? Karin Hindenlang: Wir wissen recht viel über die in Zürich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten und machen regelmässig Inventaraufnahmen. Mit der Biotoptypenkartierung, die 2010 abgeschlossen sein wird, stehen künftig flächendeckende Informationen über die Vegetation in der Stadt zur Verfügung. Der Naturwertindex liefert bereits heute eine Gesamtschau von der Stadt bezüglich ihrer biologischen und naturräumlichen Situation. Er weist jeder Hektare der Stadt Zürich einen bestimmten Wert zu, der aus über 170 000 Teil informationen berechnet wird. Letztes Jahr haben wird diesen Index zum ersten Mal berechnet. Er dient uns als Bewertungs-, Planungs- und Kommunikationsinstrument.
TEC21: Im Naturschutz spielt die Vernetzung von Lebensräumen zur Sicherung genügend grosser Populationen eine wichtige Rolle. Wie sieht es mit der Vernetzung in der Stadt aus? Karin Hindenlang: Zu den wichtigsten Vernetzungsachsen zählen einerseits die grossen Hügelzüge vom Pfannenstil über den Zürichberg hin zum Käfer- und Hönggerberg sowie die Albiskette mit dem Üetliberg. Andererseits sind es die bewaldeten Tobel und Bäche sowie die Limmat und die Sihl. Auch das lang gestreckte SBB-Areal ist wichtig für die Ausbreitung von Pflanzen und Tieren. Diese Korridore sind in der aktuell laufenden Teilrevision des Richtplanes sowie der Bau- und Zonenordnung (BZO) zu berücksichtigen. Aus diesem Grund haben wir die Vernetzungskorridore ausführlich beschrieben (Abb. 1). In diesen Korridoren sind teilweise spezielle Trittsteinbiotope nötig, erst so wird die Ausbreitung von weniger mobilen Arten möglich.
TEC21: Der Münchner Zoologe Josef Reichholf sieht die Artenvielfalt in den Städten insbesondere durch die bauliche Verdichtung bedroht. Er befürchtet, dass beispielsweise in Berlin die Artenvielfalt, nachdem diese vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zugenommen hat, infolge der enormen Bautätigkeit bereits wieder zurückgeht. Karin Hindenlang: Die innere Verdichtung ist gegenwärtig sicher eine der grössten Bedrohungen – und zwar nicht nur für die Biodiversität, sondern auch für die Lebensqualität (S. 26 ff.). Deshalb gilt es zum einen, möglichst viele wertvolle Gebiete zu erhalten. Zum anderen versuchen wir, über eine aktive Bauberatung auf die Quantität und Qualität der Grünflächen Einfluss zu nehmen. Schliesslich sind auch im Rahmen der Stadtplanung in Gebieten mit Nachverdichtungspotenzial ausreichend Frei- und Grünräume vorzusehen. Diese Ziele zu erreichen ist vermutlich die grösste Herausforderung für Grün Stadt Zürich in den nächsten Jahren.
TEC21: Ist es schwierig, Städter vom Schutz der Natur zu überzeugen? Karin Hindenlang: Die Bereitschaft, für die Natur etwas zu tun, ist sicher gestiegen. Neben unserem Ziel, das Naturverständnis über Erlebnisse und persönliche Erfahrungen zu fördern, ergibt sich ein neues Handlungsfeld: Wir möchten den Stadtbewohnern auch zeigen, wo sie einen eigenen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Naturwerte leisten können. Auf den stadteigenen Flächen haben wir schon viel erreicht. Bei Flächen, die nicht im Besitz der Stadt sind, liegt noch ein grosses Potenzial brach. Ich denke da beispielsweise an die Baugenossenschaften. Die naturnahe und zugleich nutzerfreundliche Gestaltung dieser Wohnumgebungen ist ein Gewinn an Lebensqualität. Eine grosse Chance bietet sich nächs tes Jahr mit der internationalen Initiative «Countdown 2010». Wir werden versuchen, möglichst viele Menschen für die Erhaltung und Förderung der Biodiversität zu gewinnen.
TEC21: Zürich wurde kürzlich im Rahmen des Forschungsprojektes BiodiverCity unter die Lupe genommen (S. 18 ff.). Offenbar ergaben die Befragungen auch, dass die Menschen sich Umgebungen wünschen, die oft auch für Tiere und Pflanzen attraktiv sind. Doch die Realität wird dem nicht immer gerecht. Läuft hier in der Planung etwas falsch? Karin Hindenlang: Natürlich läuft nicht immer alles nach Wunsch. Wichtig ist auch hier eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen. Nicht alle Plätze und Grünräume müssen gleich aussehen. Und moderne Pärke sollen ebenfalls möglich sein. Denn auch dort gibt es für die Natur Chancen, wenn etwa ein Teil des Parks aus Kiesflächen besteht. Die Menschen sollen sich mit ihrer Umgebung beschäftigen. Das ist entscheidend. Ein gutes Beispiel ist das Projekt «Natur ums Schulhaus» aus den 1990er-Jahren. Dank diesem Projekt ist es heute selbstverständlich, dass Kinder, Lehrer und Eltern bei der Planung von Schulhausumgebungen mitwirken können. Dabei fliesst das Thema Natur mit ein. Wenn uns das auch in anderen Bereichen gelingt und dies zu einer qualitativ hochstehenden baulichen Entwicklung führt, die insbesondere eine ausreichende Versorgung mit Grünräumen gewährleistet, dann haben wir unser Ziel erreicht.TEC21, Fr., 2009.03.13
13. März 2009 Lukas Denzler