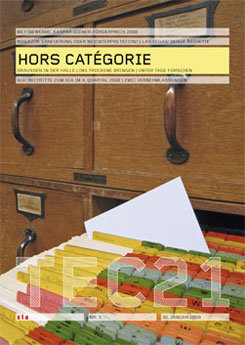Editorial
Im Archiv der Vorgängerzeitschriften von TEC21 wurden bis in die 1950er-Jahre die im Heft beschriebenen Bauwerke registriert und in Kategorien abgelegt: von Autobahnen bis zu Zahnradbahnen, jeweils von A–Z sortiert und katalogisiert. Aber auch die Registerkarte «Verschiedenes» ist zu finden. Hier sind besondere Bauaufgaben abgelegt, die in Nutzung oder Bauart zu speziell sind, als dass sie mit anderen vergleichbaren Objekten einer eigenen Kategorie hätten zugeordnet werden können. Als Beispiele seien etwa die filigranen Gewölbereihen-Pfeilerstaumauern von Robert -Maillart erwähnt oder auch die in Spritzbeton erstellten Motorschiffe von Conrad Zschokke.
Wenn das Archiv in der beschriebenen Form heute noch fortgeführt würde, gäbe es weiterhin interessante Einträge in der Rubrik «Verschiedenes». Einen Beitrag zur Fortsetzung dieser fiktiven Kartei der ungewöhnlichen Bauwerke möchten wir mit dem vorliegenden Heft leisten. Dabei geht es weniger um Entwurf und Ausführung der Bauwerke an sich als um deren spezielle Nutzung.
Die ab Seite 20 vorgestellte Konstruktion der Halle in Gaissach bei Bad Tölz (D) ist durchaus innovativ und interessant, einzigartig ist aber ihr Verwendungszweck als Simulationshalle für Berg- und Luftrettungseinsätze. In dieser Halle können die Einsatzkräfte der bayrischen Bergwacht nun unabhängig von der Witterung und ohne die Nutzung von echten Rettungshelikoptern Rettungsaktionen trainieren.
Beim zweiten präsentierten Bauwerk, einem Trockendock, ist das Prinzip altbekannt, die Nutzung im konkreten Fall aber speziell: Statt Schiffen werden – wie 1986 die hohlen Pfeiler für das Oosterschelde-Sturmflutwehr in den Niederlanden – Bohrinseln im Trockenen zusammengebaut und anschliessend mit Schleppern an ihren Einsatzort gebracht. Ein Schweizer Ingenieurbüro baute das Objekt in Abu Dhabi. Die Bohrinseln, die bisher an Land erstellt und anschliessend ins Meer gezogen wurden, können darin unabhängiger von der Witterung und logistisch einfacher zusammengebaut werden.
Weniger spektakulär, in der Ausführung aber ebenfalls anspruchsvoll ist die Erweiterung des Felslabors Mont Terri im Jura um einen zusätzlichen Stollen. In dieser Anlage wird im Auftrag des Bundes erforscht, inwieweit sich Opalinuston zum Bau eines geologischen Tiefenlagers für radioaktive Abfälle eignet. Um ein Quellen des Tons zu verhindern, musste der 2008 fertiggestellte neue Laborstollen trocken gefräst werden.
Die beschriebenen Bauwerke sind sehr unterschiedlich. Sie widerspiegeln die Vielfalt der Anforderungen, die die technische und gesellschaftliche Entwicklung an dasIngenieurwesen stellt, und zeigen, wie individuell und «verschieden» diese Bauaufgaben erfüllt wurden.