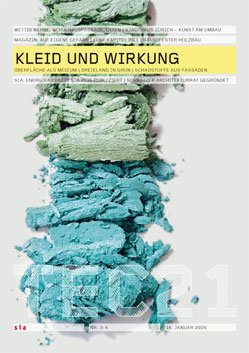Editorial
Der erste Eindruck zählt. Ein Gebäude wird vom Betrachter zunächst visuell wahrgenommen, die Gestaltung der Oberfläche ist also massgeblich für seine Akzeptanz. Oder anders: Kleider machen nicht nur Leute, sondern auch Bauten.
In letzter Zeit ist das Interesse an individueller Fassadengestaltung gewachsen. Ausstellungen wie die diesjährige «Ornament neu aufgelegt» im Schweizerischen Architekturmuseum zeigen aktuelle Projekte, die Adolf Loos’ Kritik am Ornament als Zeichen der Degeneration widerlegen. Preise wie «Die gute Farbe» des Schweizerischen Werkbunds und des Hauses der Farbe ehren Bauten, die sich durch einen qualitativ hochwertigen Umgang mit Farbe auszeichnen (vgl. TEC21-Dossier «Die gute Farbe 2008», September 2008).
Dass eine intensive Auseinandersetzung mit der Oberfläche hintergründige Lösungen hervorbringen kann, zeigen die Arbeiten, die das Münchner Büro Hild und K in den letzten Jahren realisiert hat: Hier erhält die Oberfläche eine Aufgabe, die über das reine Aussenden von visuellen Reizen hinausgeht. Sie wird mit einer Informationsfunktion belegt wie etwa bei einer Fassadensanierung in Berlin – oder nimmt, wie bei einem Wohnhaus im deutschen Aggstall, über die Gestaltung der Aussenfläche Einfluss auf die Proportion der Innenräume («Oberfläche als Medium», S.18).
Auch die vor Kurzem fertiggestellte Wohnüberbauung Grünenberg in Wädenswil zeigt, dass Farben mehr sein können als Make-up, als nachträgliches Anmalen oder sogar Vertuschen. Die Architekten Annette Gigon und Mike Guyer haben sich gemeinsam mit dem Künstler Pierre André Ferrand auf das Wagnis eingelassen, die Fassaden der drei Volumen in korrespondierenden Grüntönen zu streichen – ohne die Konkurrenz des natürlichen Grüns der umgebenden Vegetation zu scheuen («Dreiklang in Grün», S. 24). Die Farbe ist dabei das eigentlich integrative Element, das die Bauten mit ihrer Umgebung verknüpft.
Die ansprechende Optik kann aber auch Schattenseiten haben: Neue Studien der Eawag und der Empa belegen, dass Biozide, die Farben und Putzen für Aussenwärmedämmungen zum Schutz vor Pilz- und Algenbefall beigemischt werden, mit dem Regenwasser in Gewässer ausgewaschen werden können («Schadstoffe aus Fassaden», S. 28). Reduziert werden kann dieses Umweltrisiko nicht nur durch die Entwicklung besserer Produkte oder die Behandlung des abfliessenden Regenwassers, sondern auch durch die Gestaltung der Gebäude und ihrer Umgebung.
Tina Cieslik
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Fassadensanierung Schulhaus, Olten | Stadthaus Zürich – Kunst am Umbau
10 MAGAZIN
Auf eigene Gefahr | Oberflächlich, aber vielschichtig | Altersheimbau in der Stadt Zürich| Fünf Kapitel Bill | Holz als sicherer Wert | Standfester Holzbau
18 OBERFLÄCHE ALS MEDIUM
Falk Jaeger
Architektur: Ist Oberfläche mehr als Make-up? Das Münchner Architekturbüro Hild und K bringt Gebäude zum Sprechen.
24 DREIKLANG IN GRÜN
Tina Cieslik
Architektur: Die Farbigkeit der Überbauung Grünenberg in Wädenswil wirkt integrativ: Durch sie fügen sich die Bauten sowohl in den Park als auch in die gebaute Umgebung ein.
28 SCHADSTOFFE AUS FASSADEN
Michael Burkhardt et al.
Umwelt: Zum Schutz vor Algen und Pilzen enthalten Fassadenfarben und -putze Biozide, die in Gewässer ausgewaschen werden können. Bei der Lösung des Problems sind Produktehersteller, Architekten und Bauherren gefordert.
33 SIA
Energieausweis SIA 2031 publiziert | Schweizer Architekturrat gegründet | Von Helsinki nach St. Petersburg | Publikationsverzeichnis 2009 | Bauleiter Hochbau
37 FIRMEN
39 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Oberfläche als Medium
Die Oberfläche eines Gebäudes trägt wesentlich zu seiner Akzeptanz bei. Das Münchner Architekturbüro Hild und K hat in den vergangenen Jahren auf unterschiedliche Weise versucht, das Bedürfnis nach Schmuck und narrativen Elementen auf hintergründige, intelligente Art zu befriedigen. Wie kann man der Forderung der Postmoderne nach einer Ergänzung der Moderne um Gemütswert und kommunikative Elemente nachkommen, ohne in Historismen zu verfallen? Die Projekte der letzten zwölf Jahre zeigen ein breites Spektrum von Interventionsmöglichkeiten.
Als der Berliner Publizist Wolf Jobst Siedler Anfang der 1960er-Jahre durch Berlin flanierte und die ihres Stuckkleids beraubten Fassaden der Kaiserzeit musterte, machte er eine interessante Entdeckung: «... jetzt, da [das Dekor-Gewimmel] entfernt wurde, wird sichtbar, was bis gestern durch den Stuckzierrat verborgen blieb: Die architektonische Leistung ist schlecht. Denn nun erst stimmen keine Masse mehr: nicht die Grösse der Fenster und nicht ihr Abstand voneinander, nicht der Winkel am Erkervorsprung und nicht die einst durch Gesimse Schinkelscher Herkunft dekorierten Blindfenster.»[1]
Dekoration der Oberfläche zur Kaschierung von Bausünden? Dieser Vorwurf erscheint uns heute kleinlich. Mit Emphase werden Stuckfassaden gepflegt, restauriert, zum Teil rekonstruiert: Die von der zeitgenössischen Architektur gequälte Volksseele verlangt danach. Doch jetzt leiden die Architekten unter der Nostalgiewelle und suchen nach Auswegen.
Dreidimensionales Graffito
Den Auftakt zur Beschäftigung mit dieser Frage machten Andreas Hild und Dionys Ottl von Hild und K 1996 mit dem Bau einer Wertstoffsammelstelle im bayrischen Landshut: Sie umfriedeten die Anlage mit einer Mauer aus rechteckigen Betonfertigteilen, mit denen durch unterschiedlich angeordnete Aussparungen der immer gleichen Grösse die Buchstaben geformt werden. «Sammeln» steht da in übermannshohen Lettern zu lesen. Die Elemente erinnern an Buchstaben, wie sie von Graffiti-Sprayern gestaltet werden, der goldene Anstrich vermittelt ein Gefühl von Wertigkeit. Offenkundig nötigt die Arbeit den Sprayern Respekt ab, denn sie haben sich an der Anlage noch nicht verewigt.
Ebenfalls in Landshut gestalteten die Architekten 1997 die Bushaltestelle Ländtorplatz am Rande der Altstadt (Bilder 4 5). Die Architekten wollten die eher bescheidene Aufgabe dazu nutzen, etwas Besonderes zu gestalten: Anstelle einer herkömmlichen Pfosten-Riegel- Konstruktion entwarfen sie zunächst eine Stahlskulptur mit rostiger Oberfläche im Stil Richard Serras, was bei der Auftraggeberin, der Stadt Landshut, nicht auf Gegenliebe stiess. Daraufhin entstand die Idee, ein Biedermeierdekor überdimensional auf das Wartehäuschen zu projizieren. Mittels Laserschneideverfahren wurde das florale Dekor aus 12 mm starken gekanteten Cortenstahlplatten ausgeschnitten und praktisch zu einem Wartehaus gefaltet: Das Ornament wurde zur Tragstruktur des kleinen Bauwerks. Die Oberfläche – rostüber zogener Stahl – steht in Kontrast zum eher aus dem Luxussegment bekannten Dekor. Auf humorvolle, leicht ironische Art fügt sich das moderne Häuschen in die historisch geprägte Umgebung ein.
Vergrössern, verfremden
Als Hild und K zwei Jahre später ein Gründerzeithaus in Berlin zu sanieren hatten, das zwischen zwei noch prächtig im Schmuck stehenden Fassaden ganz nackt und bloss wirkte, erinnerten sie sich dieses Prinzips. Der Baueingabeplan vom Ende des 19. Jahrhunderts zeigte die zeitgenössischen Verzierungen der fünfgeschossigen Fassade. Er wurde eingescannt und hundertfach auf den Massstab 1:1 vergrössert. Die daraus entstehende Vergröberung ergibt einen verblüffenden Effekt: Baluster werden zu Flaschenkürbissen, Fensterverdachungen erscheinen wie dick verschneit, Kapitelle quellen auf, als seien sie aus Hefeteig. Die weichgezeichneten Schmuckelemente erinnern an Formen des Jugendstils oder an Rudolf Steiners Säulenordnung mit ihren wogenden Kapitellen im ersten Goetheanum in Dornach.Das auf diese Weise «designte» Dekor liessen die Architekten als vertieftes Relief mittels einer Art Schablonenputz auf die Fassade des Hauses aufbringen. Schattenwurf und Plastizität der wenige Zentimeter tiefen Dekorschicht unterscheiden sich dabei deutlich von der dreidimensional geformten Nachbarfassade (Bilder 7-8), die Gesamtwirkung ist dennoch verblüffend. Zumal das Dekor seinen eigenen Schatten schon eingebaut hat, denn die Schattierungen, mit denen der Baumeister um 1900 seine Bauzeichnung effektvoll verschönert hatte, übernahmen die Architekten gleich mit. Ein Scherz, der dadurch noch scherzhafter wird, dass die Schatten von der im Norden stehenden Mitternachtssonne geworfen werden ... Hild und K vermeiden es, skulpturale Elemente als Dekor zur Wirkung zu bringen: Sie bearbeiten die Oberfläche, erzeugen eine grafische Wirkung und nutzen sie zur Übermittlung semantischer Botschaften. Ihre Berliner Fassade ist nicht gedankenlos geschmückt, sie erzählt eine Geschichte. Das Dekor wurde mit einem Trick in die Gegenwartsarchitektur geschmuggelt.
Experimentell weitergedacht haben die Architekten das Prinzip der Reproduktion durch Vergrösserung verfremdeter Dekors bei einem kleinen Projekt in München. An einem Wohnungsbau aus dem Jahr 1901 mussten die maroden Balkone an der Hofseite ersetzt werden. Als Reminiszenz an die schmiedeeisernen Balkongitter der Jahrhundertwende suchten die Architekten nach einem figurativen historistischen Muster. Sie fotografierten ein Dekorband der Strassenfassade und lösten das Bild in ein Bandraster auf. Eine Laserschneideanlage perforierte die Stahlplatten mit dem Raster. So entstanden durchbrochene Brüstungsgitter, die in der Nahsicht abstrakte Strukturen zeigen. Wahrnehmen lässt sich das vegetabile Dekor erst aus grösserer Entfernung, vom Nachbarhaus oder vom Hof aus (Bilder 10-11).
Von aussen nach innen
Sucht man nach weiteren Experimenten dieser Art im Werk der Architekten, stösst man auf ein im Jahr 2000 entstandenes Haus in Aggstall (D), einem kleinen Weiler zwischen München und Regensburg. Auch bei dessen Aussenhaut geht es um eine Reliefwirkung, diesmal erzeugt durch vorstehende Ziegel, die ein Rautenmuster bilden. Von weitem entsteht der Eindruck, das Gebäude sei mit einer Brokattapete beklebt oder von einem Norwegerpulli umhüllt (Bild 1). Aus der Nähe zeigt sich, dass es sich um korngelb geschlämmte Ziegelwände handelt und das Dekor vor allem durch die Schattenwirkung entsteht. Das vermeintliche, einer Tapete entsprechende Flächenmuster erweist sich als geometrische Ornamentierung, die mit dem Mass- und Proportionssystem des Hauses in Zusammenhang steht. Das Grundmuster besteht aus repetierten Vierecken, sozusagen grob gepixelten Rauten. Da sich das Rautenmuster fortlaufend um die Hauskanten legt (Bild 2), fungiert die Raute als Modul. Dieser Modulordnung sind auch die Wandöffnungen unterworfen: Fenster und Türen sind in das Muster eingepasst, das Aussendekor nimmt also auf die Proportionen der Innenräume Einfluss. Die Oberfläche wird zur Struktur, die Struktur zur Proportion.
Vom Dekor zur Geometrie
Einen ähnlichen Ansatz verfolgten Hild und K 1994 beim Neubau eines Lagerhauses für Farben in Eichstätt (D). Mit handelsüblichen Porenbetonfassadenplatten in zwei verschiedenen Stärken und sechs unterschiedlichen Längen formten sie eine schlichte Fassade für den als einschiffige Halle konzipierten Bau. Durch die regellose Kombination der Platten bei immer gleicher Breite entsteht ein apartes Spiel der Fensteröffnungen, durch die unterschiedliche Bauteilstärke ein Schatten werfendes, vertikales Relief. Die Fenster sind rahmenlos bündig in die Fassade eingesetzt und werden durch die dickeren Elemente geschützt. Am Abend wird der Eindruck durch eine unprätentiöse, doch umso effektvollere Beleuchtung noch verstärkt: Die Beleuchtungskörper werden im Traufbereich von den dünneren Elementen aufgenommen. Wegen der normierten Bauteile blieb die Konstruktion einfach und kostengünstig, und auch die Montage war nicht mit Mehraufwand verbunden. Hier geht es nicht um die Dekoration schlechter Architektur, sondern um die Architektur selbst. Wolf Jobst Siedler hätte keine Kritik anzubringen.
Die Weiterentwicklung dieser Überlegung führte 2004 beim Bau des Bayerischen Forschungs- und Technologiezentrums für Sportwissenschaften in München zu einem noch geometrischeren, reduzierteren Ergebnis. Das Gebäude wurde entsprechend den Vorgaben des Campus-Masterplans und mit kleinem Budget realisiert. Entstanden ist ein Systembau aus Betonfertigteilen. Einzige ins Auge fallende Gestaltungsmassnahme sind die zwei sich abwechselnden Fensterformate. Auf den nicht von Fenstern durchbrochenen Flächen wird das Fassadenraster in nahezu monochromatischen Weiss- und Hellgrautönen fortgeführt. Die einzelnen Rasterfelder unterscheiden sich durch verschiedene Lagen von Farbaufträgen und wechselnde Streichrichtungen. Es entsteht eine luzide Oberfläche, die der gleichförmigen, rationalistischen Reihung der Lochfassade etwas Leichtes, Elegantes verleiht. Hild und Ottl beschäftigen sich intensiv mit dem Verhältnis von Bauwerk und möglichen Modulationen der Oberflächen. Durch die Diskussion haben sie sich von populären künstlerischen Ornamentmotiven entfernt und in Richtung architektonisch-abstrakte Motive bewegt. «Häuser sollen normal aussehen», sagen sie, doch unverändert bleibt ihr Bemühen, die Oberflächen zum Sprechen zu bringen.
Literatur:
[1] Wolf Jobst Siedler, Elisabeth Niggemeyer: Die gemordete Stadt – Abgesang auf Putte und Strasse, Platz und Baum. F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, 1964, S. 13TEC21, Fr., 2009.01.16
16. Januar 2009 Falk Jaeger
Dreiklang in Grün
Die Wohnüberbauung Grünenberg der Zürcher Architekten Annette Gigon und Mike Guyer steht im Park der gleichnamigen Villa in Wädenswil ZH, im Spannungsfeld zwischen Natur, Industrie und heterogenen Wohnbauten. Drei polygonale Solitäre besetzen in versetzter Anordnung den Hang. Durch ihre subtile Farbigkeit fügen sich die Bauten sowohl in den Park als auch in die gebaute Umgebung ein, ohne beliebig zu wirken.
Die Villa Grünenberg liegt an privilegierter Stelle: in Hanglage mit einem 180°-Panorama über den Zürichsee, inmitten eines Parks mit altem Baumbestand. Der Park selbst wurde um die Jahrhundertwende vom Unternehmer Heinrich Blattmann-Ziegler, dem Besitzer der unterhalb des Grundstücks gelegenen Fabrik, nach dem Vorbild spätklassizistischer Landschaftsgärten angelegt. Die Familie wohnte zunächst in unmittelbarer Nachbarschaft zum Unternehmen, auf dem Gelände des späteren Parks befanden sich Obstwiesen. Im nordwestlichen Teil des Grundstücks, dort, wo die heutige Wohnüberbauung steht, liess Blattmann ein Arboretum mit exotischen Bäumen anlegen. Einher mit dem steigenden Wohlstand der Familie ging dann der Wunsch nach einem repräsentativeren Wohnsitz: 1911 bauten die Zürcher Architekten Robert Bischoff und Hermann Weideli im Grünenberg-Park eine Villa für die Familie.[1]
Als Ensemble von Park und Fabrikantenvilla in Sichtweite des familieneigenen Unternehmens spiegelt das Anwesen den Lebensstil der beginnenden Industrialisierung am linken Zürichseeufer wider und wurde daher von der Denkmalpflege als regional bedeutsam eingestuft. Der letzte Grundeigentümer liess als Kompromiss zwischen wirtschaftlicher Nutzung des Geländes und denkmalpflegerischem Interesse am integralen Erhalt der Anlage einen privaten Gestaltungsplan entwickeln: das 23 000 m² grosse Grundstück wurde in mehrere Bauzonen aufgeteilt, die Villa blieb erhalten, 15 000 m² des Terrains sollten nicht überbaut werden und den Bewohnern als Grünfläche erhalten bleiben. Den Wettbewerb auf Einladung konnten im Sommer 2002 die Zürcher Architekten Annette Gigon und Mike Guyer für sich entscheiden.
Gegossener Stein
Von 2005 bis 2007 wurde die Zone im nordwestlichen Teil des Parks bebaut. Leitmotiv des Projekts war es, der Villa in Bezug auf Präsenz und Dominanz den Vorrang zu lassen und die Neubauten dem Park zuzuordnen. Diese Überlegung hatte Einfluss auf die Anordnung der Volumen im Gelände: Die versetzte Position der Häuser erlaubt Durch- und Ausblicke in den Park und auf den See. Aber auch die formale Gestaltung der Körper trägt dem Konzept Rechnung: Kompakt sitzen die drei Gebäude im Hang, Loggien und auskragende Betonelemente gliedern die in Grüntönen variierenden Baukörper. Die mehrseitig orientierten oder durchlaufenden Grundrisse bieten für jede der 30 Wohnungen Seesicht, ebenso wie eine optimale Besonnung der Innenräume. Dafür wurden acht verschiedene Wohnungstypen entwickelt, von nach drei Seiten orientierten Wohnungen über kreuzweise angeordnete Maisonette-Wohnungen bis zu über die ganze Bautiefe reichenden Wohnräumen. Zur Materialisierung der Fassaden wurde mit Beton ein Material gewählt, das durch seine steinerne Erscheinung die Volumina der einzelnen Bauten noch betont.
Farbigkeit in Licht und Schatten
Komplettiert wird dieses Konzept durch die Farbigkeit der Fassaden. Jedes der drei Volumen ist in einer schwer fassbaren Nuance von Grün gestrichen, das Spektrum reicht von hellem Gelbgrün beim Haus A, dem kleinsten der Gruppe, über dunkles Olivgrau bis zu Ockergrün bei Haus B und Haus C. Farbig ist nur die nach aussen gerichtete Oberfläche, Laibungen von Fenstern und die Innenseiten der Pfeiler der Loggien sind in sandgestrahltem Beton belassen. Die Farbe ist appliziert und kann in naher Zukunft schon fast wie Patina wirken. Je nach Lichteinfall oder bei Regen changiert das Erscheinungsbild, Assoziationen mit der Witterung ausgesetzten Findlingen drängen sich auf. Bei der Entwicklung des Farbkonzepts arbeiteten die Architekten mit Pierre André Ferrand zusammen, es ist das erste gemeinsame Projekt mit dem Genfer Künstler. Durch die unregelmässige Form der Bauten und ihre Lage im Hang, vor dem Hintergrund der spiegelnden Oberfläche des Sees, inmitten der alten Bäume, drängte sich für Ferrand die Assoziation von Klippen, von kompakten felsigen Volumen auf – dies umso mehr, als für die Häuser in dieser Phase noch keine auskragenden Balkone projektiert waren. Daraufhin war klar, dass jedes Gebäude monolithisch in einer einzigen, eher dunklen Farbe gestrichen werden sollte. Anzahl und formale Gestaltung der Bauten legten zudem eine bestimmte Beziehung zwischen den Gebäuden nahe: die Aufteilung A, B C (ein kleines, zwei grosse Gebäude) übersetzte sich beim Farbkonzept in zwei Tönungen des gleichen Farbspektrums, ergänzt um eine dritte Farbe, die nicht lediglich eine chromatische Variation der ersten beiden sein sollte. Dieser Kontrast innerhalb der Farbfamilie erlaubte es zum einen, die innere Einheit des Ensembles zu stärken und es gegen die benachbarten, rot getönten Gebäude abzugrenzen. Zum anderen sollte die Identifikation der zukünftigen Bewohner mit ihrem Wohngebäude gestärkt werden.
Aufgrund der Kompaktheit der Bauten tendierte Ferrand zu dunklen, mineralischen Tönen, die Bauherrschaft empfand diese aber als zu trist. Eine Lösung zeichnete sich durch die Vorliebe der Architekten für vegetabile Farben ab; trotz dem Risiko, dass ein auf den Beton aufgetragenes künstliches Grün mit der umgebenden Vegetation konkurrieren könnte. Das helle Grün von Haus A war die Ausgangsfarbe, es entspricht einer Schattierung, die die Architekten schon bei früheren Projekten[2] benutzten. Es wurde ergänzt durch ein Ockergelb- Grün, als dritte Farbe setzte sich ein Olivgrau durch. Bei der Auswahl war es wichtig, dass sich die Farben klar voneinander abgrenzten, um den dazwischen liegenden Raum grösser erscheinen zu lassen. Zudem bestand die Gefahr, dass sich, je nach Lichtverhältnissen und Blickwinkel, Wände zweier unterschiedlicher Häuser mehr glichen als die Wände desselben Gebäudes. Gleichzeitig galt es, eine Atmosphäre der Ruhe zu schaffen, ohne fade und langweilig zu wirken.
Die Farbe komplettiert den Entwurf und erweitert das Projekt um eine Dimension. Sie erlaubt die Verschränkung von Bauten und Park, auch wenn sich Ferrand rückblickend zumindest beim olivgrauen Haus B eine noch dunklere Schattierung gewünscht hätte.
Anmerkungen:
[1] Adrian Scherrer: Vom Garten zur Wohnlandschaft – Zur Geschichte des Grünenberg-Parks. Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2005, S.31 ff .
[2] Z.B. «Espace de l’art concret» (EAC) in Mouans Sartoux, Frankreich, 2004TEC21, Fr., 2009.01.16
16. Januar 2009 Tina Cieslik