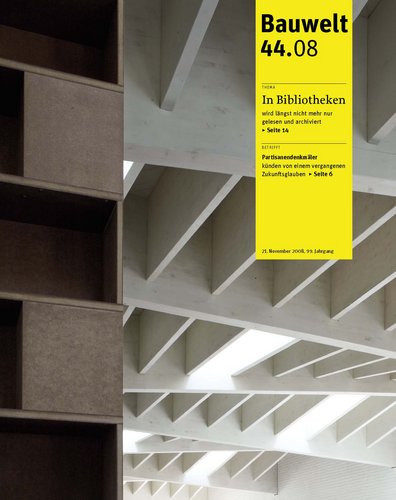Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Auf der Suche nach der Wirklichkeit von Los Angeles | Ralph Eue
03 Museum for Arts and Design in New York | Hubertus Adam
03 „Standortmitte“ in Köln und Bonn | Uta Winterhager
04 SMAQ im DAZ | Sebastian Spix
BETRIFFT
06 Partisanendenkmäler | Robert Burghardt
WETTBEWERBE
10 „The LM Project“ in Kopenhagen | Friederike Meyer
12 Entscheidungen
13 Auslobungen
THEMA
14 Vom Wissensspeicher zum Public Paradise | Ulrich Brinkmann
16 Bezirksbibliothek Berlin-Köpenick | Michael Kasiske
22 Universitätsbibliothek der HTW Dresden | Roland Züger
28 Stadtbücherei im Bahnhof Luckenwalde | Ulrich Brinkmann
REZENSIONEN
35 Temporäres Denkmal | Eva Maria Froschauer
35 Architektonische Qualität | Jürgen Tietz
35 Zeitmaschine Architektur | Thomas Werner
RUBRIKEN
05 wer wo was wann
34 Kalender
36 Anzeigen
40 Die letzte Seite