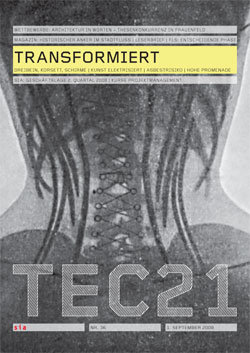Editorial
«die form eines gegenstandes halte so lange, das heisst sei so lange erträglich, solange der gegenstand physisch hält. Ich will das zu erklären suchen: ein anzug wird seine form häufiger wechseln als ein wertvoller pelz.»[1] Um mit Adolf Loos zu sprechen, handelt es sich bei den in diesem Heft thematisierten Bauten um wertvolle Pelze, deren Physis an sich intakt war. Doch sei es, dass sich Motten einnisteten («Asbest: Risiko abklären»), dass die Nähte nicht mehr stark genug waren («Hohe Promenade») oder dass sie aus der Mode gekommen waren («Kunst elektrisiert», «Dreibein, Korsett und Regenschirme»): Die Bauten wurden einer Transformation unterzogen.
Das Titelbild illustriert ein anderes Kleidungsstück, das noch bis vor Kurzem démodé war (dass es heute wieder en vogue ist, ist eine andere Geschichte). Das Korsett ist vielfach negativ konnotiert. Dem modischen Accessoire, das den Zwang symbolisiert, sich einzuschnüren, um ein zweifelhaftes Schönheitsideal zu erfüllen, brach erst das Verdikt der Mediziner, die drastisch auf die Verformung des Knochenkostüms verwiesen, das Genick bzw. das Fischbein.
Auch auf dem Gebiet der Architektur hat es sich keinen guten Namen gemacht. Sah sich die Moderne im Korsett der Stile gefangen, aus dem sich das Neue Bauen zu befreien trachtete, hadern heutige Architekten mit dem konstruktiven Korsett, das ihnen die Schwerkraft und die Gesetze der Baustatik auferlegen. Die Zerstörung von Baukultur wird ebenso unter «Architektur im Korsett» subsumiert wie umgekehrt Bauvorschriften, Kostenrahmen und Auflagen des Denkmalschutzes.
Wenn «Kürschner» am Werk sind, die ihr Fach meisterlich beherrschen, schöpfen sie aus der Beschränkung das Potenzial: Sie rücken dem Schädlingsbefall vorzeitig zu Leibe, verstärken die Nähte, ehe auch das Fell berieben ist, und arbeiten den Pelz so um, dass ihn die Modeströmung nicht hinwegfegt. Das Korsett im übertragenen Sinn – beim Caixa Forum die beschränkte Tragfähigkeit der Umfassungsmauern – ausgerechnet mit einem Korsett im wörtlichen Sinn – der Konstruktion – zu sprengen, mithin das Korsett zum Clou der Lösung zu machen, ist Homöopathie: Similia similibus curantur (Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt).
Rahel Hartmann Schweizer
Anmerkung
[1] Adolf Loos, «Ornament und Verbrechen», 1908, in: Ulrich Conrads: Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts. Vieweg. Braunschweig/Wiesbaden, 1981, S.15ff .
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Architektur in Worten – Thesenkonkurrenz
14 MAGAZIN
Historischer Anker im Stadtfluss | Leserbrief: Rollen eines Ingenieurs | FLS: Entscheidende Phase
24 DREIBEIN, KORSETT UND REGENSCHIRME
Heinrich Schnetzer Ingenieurwesen: Die Integration der Umfassungsmauern des Madrider Elektrizitätswerks in das neue Caixa Forum gelang den Ingenieuren WGG Schnetzer Puskas mit einem ebenso diskreten wie anspruchsvollen Tragwerkskonzept.
29 KUNST ELEKTRISIERT
Klaus Englert Architektur: Die architektonische Attraktion des Caixa Forum von Herzog & de Meuron sind die gusseisernen, perforierten Fassadenplatten, die das auf die Ziegelfassade des Elektrizitätswerks aufgepfropfte Gehäuse wie eine Aussenhaut abschirmen.
34 ASBESTRISIKO ABKLÄREN
Daniel Bürgi Umwelt: Die Mehrheit aller Bauten aus den 1950er- bis 1980er-Jahren enthält Asbest. Kommen diese ins Sanierungsalter, werden mit einer Asbestabklärung vor Baubeginn Gesundheitsrisiken vermieden.
38 HOHE PROMENADE
Anna Ciari, Carlo Bianchi Denkmalpflege: Um die Erdbebensicherheit nachzuweisen, wurde ein neues, verformungsbasiertes Verfahren für Mauerwerksbauten für die Anwendung an einem Altbau – der Zürcher Kantonsschule Hohe Promenade – adaptiert.
44 SIA
Geschäftslage im 2. Quartal 2008 | Kurse Projektmanagement | Innovation unter Tage
49 PRODUKTE
61 IMPRESSUM
62 VERANSTALTUNGEN
Kunst elektrisiert
Madrid erlebt momentan einen regelrechten Museumsboom. Manche beschwören schon ein neues «siglo de oro», ein neues Goldenes Zeitalter, herauf, denn im Herzen Madrids wird derzeit eine Kunstmeile vollendet, die alles Dagewesene in Spanien in den Schatten stellt.
Entlang dem Paseo del Prado, der von der prachtvollen Plaza Cibeles im Norden bis zum Bahnhof Atocha im Süden führt, befinden sich in kurzer Entfernung die drei wichtigsten Kunstsammlungen Madrids: Museo Thyssen-Bornemisza mit den Sammlungen von Heinrich und Carmen Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional del Prado mit den königlichen Sammlungen und Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía mit Werken aus dem 20. Jahrhundert. Die Museumsmeile «Paseo del Arte» umfasst die Erweiterung dieser grossen Kunstsammlungen sowie die Errichtung der gerade fertiggestellten Kunsthalle Caixa Forum der renommierten katalanischen Stiftung La Caixa. Damit ist das ambitionierte Projekt «Paseo del Arte» noch nicht abgeschlossen, denn Prado-Direktor Miguel Zugaza möchte sein Museum durch Hinzunahme des angrenzenden Museo del Ejército (Heeresmuseum) und des Casón del Buen Retiro zum «Campus del Museo del Prado» vereinen, um zusätzliche Ausstellungsflächen und ein Forschungszentrum zu erhalten. Zu guter Letzt kommt noch die städtebauliche Umgestaltung des Paseo del Prado durch den Portugiesen Alvaro Siza hinzu.
Der Umbau der drei namhaften staatlichen Museen am Paseo del Prado konnte im Herbst 2007 mit dem von Rafael Moneo gestalteten Erweiterungsbau des Museo del Prado beendet werden. Im Februar folgte schliesslich die private Kunsthalle der Stiftung La Caixa. Lange mussten die Madrider auf das mit viel Vorschusslorbeeren bedachte Caixa Forum des Basler Teams Herzog & de Meuron warten. Doch nun braucht man nur die Strasse zu überqueren, um vom Prado zur neuen Kunsthalle zu gelangen. Auch der erweiterte Musentempel Museo Thyssen-Bornemisza und das Museo Reina Sofía mit Jean Nouvels aufsehenerregendem Anbau befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Herzog & de Meuron stellten sich der anspruchsvollen Aufgabe, die denkmalgeschützten Umfassungsmauern eines Elektrizitätswerks, der «Central Eléctrica del Mediodía» von 1899, nahezu komplett in den Museumsneubau zu integrieren. Arata Isozaki hatte es etwas einfacher, als er sechs Jahre zuvor für die Caixa Forum-Kunsthalle in Barcelona den Ziegelbau der 1911 von Josep Puig i Cadafalch errichteten modernistischen Tuchfabrik lediglich um einen abgesenkten Eingangsbereich erweiterte. Herzog & de Meuron akzentuierten nicht nur die spannungsvollen Beziehungen zwischen Alt- und Neubau, sie erklärten das neue Museum schlechthin zum «Magneten» für ganz Madrid. Gemessen an der moderaten Formensprache des «klassizistischen» Prado-Annexes gingen die Schweizer Baumeister ein grösseres Wagnis ein. Sie wollten beweisen, wie radikal zeitgenössisches und fantasievolles Bauen in einem traditionellen städtischen Umfeld möglich ist. Nun, der Nachweis ist ihnen zweifellos geglückt.
Gebirgsmassiv
Gegenüber des Königlichen Botanischen Gartens gelegen, ragt das Caixa Forum aus dem leicht ansteigenden Wohnviertel wie ein Gebirgsmassiv empor. Der neue Baukörper wurde auf die bestehende Ziegelfassade des Elektrizitätswerks aufgestockt, während man den Granitsockel des Altbaus abriss. Die hochgezogene Fassade versteht Jacques Herzog als «zerklüftete Landschaft», geprägt von Schrägen und Einbuchtungen. Dabei orientiert sich das Rot der gusseisernen Fassadenplatten an den Dachziegeln der angrenzenden Wohnbauten. Diese Platten gehören zur architektonischen Attraktion des Museums: Sie besitzen alle ein engmaschiges Perforationsraster, ausserdem unregelmässig geformte Einschnitte. Diese Module schirmen das aufgepfropfte Gehäuse wie eine Aussenhaut ab. Herzog & de Meuron interessieren sich seit mehreren Jahren für diese hybriden Konstruktionselemente, die sie wegen ihrer textilen und dekorativen Eigenschaften schätzen. Auch in der im Bau befindlichen «Ciudad del Flamenco» von Jérez de la Frontera kommen diese Elemente, die an die Fassadenstruktur der Moschee von Córdoba (784–987 n. Chr.) erinnern, zum Einsatz. Die «porösen» Platten des Caixa Forum funktionieren gleichzeitig als Fassade und Fensteröffnung: Sie schliessen ab, leiten aber zugleich gedämpftes Licht in die Museumsräume, in denen sie für ein angenehmes Clair-obscur sorgen.
Pilzdach
Auch konstruktionstechnisch hebt sich der hochkomplexe Baukörper von allen anderen Museumsprojekten auf dem Paseo del Arte deutlich ab (siehe «Dreibein, Korsett und Regenschirme», S. 24 ff.). Harry Gugger, Partner von Herzog & de Meuron, erklärte dazu: «Anfangs dachte niemand an die enormen Schwierigkeiten, die das Projekt mit sich brachte. Zunächst galt es, das Gebäude abzustützen, erst danach konnte der Granitsockel des Altbaus entfernt werden.» Das gesamte Gebäude lastet in den Untergeschossen auf drei mächtigen Pfeilern, die aus dem Fundament ragen. Doch davon bemerkt der Besucher nichts. Er nimmt nur den verkleideten Betonkern wahr, einen mächtigen Stängel, über dem sich das Gebäude wie ein Pilzdach wölbt. Dieser prismatisch geformte Eingangsbereich mit öffentlichem Platz unter dem schützenden Dach mutet wie expressionistische Filmarchitektur an. Die in den zwei Untergeschossen untergebrachten Säle, an deren Wände perforierte Aluminiumplatten angebracht wurden, sind allesamt stützenlos. Ebenso die Ausstellungssäle in der zweiten und dritten Etage. In den fünf oberen Geschossen, die sich über dem buchstäblich aufgelösten Sockelgeschoss erheben, demonstrieren die Basler, wie man Räume sinnlich gestaltet: Im Restaurant hängen tropfenförmige Lampen aus der Werkstatt von Herzog & de Meuron. Die Treppenhausspirale mit ihren elegant geschwungenen Ecken erstrahlt in blendendem Weiss. Und im Foyer überrascht der ruppige Charme eines von Neonröhren, Stahlboden und unverdeckten Ablüftungsrohren geprägten Industrie-Ambientes. Das Direktorenzimmer mag zunächst klaustrophobische Ängste wecken, bis man die Fensterschlitze unterhalb der Decke entdeckt.
Seit Langem gehört es zum Arbeitsprinzip von Herzog & de Meuron, mit bildenden Künstlern und Fotografen zusammenzuarbeiten. Diesmal luden sie den französischen Gartenkünstler Patrick Blanc ein, auf dem öffentlichen Vorplatz, der früher von einer Tankstelle verstellt war, landschaftsarchitektonische Akzente zu setzen. Blanc gestaltete die Brandmauer eines den Platz einfassenden Gebäudes als lebendige Pflanzenwand. An dieser quer zur Kunsthalle emporragenden Wand wachsen 15 000 Pflanzen von 250 verschiedenen Arten, aufgehängt an einem metallischen Gewebe, das gleichzeitig als Bewässerungssystem dient. Gegenüber dem Botanischen Garten zweifellos ein unwiderstehlicher Blickfang für die Passanten am Paseo del Prado.
Das Caixa Forum wird sich als machtvolle Konkurrenz zum benachbarten Museo Reina Sofía entwickeln. Beide Institutionen haben sich in Spanien als führende Museen für die Kunst des 20. Jahrhunderts etabliert, allerdings liegt der Sammlungsschwerpunkt des Caixa Forum mehr auf der Gegenwartskunst, beginnend mit den Nachkriegsströmungen um Joseph Beuys, Bruce Nauman, Bill Viola, Anselm Kiefer, Gerhard Richter und Georg Baselitz. Ähnlich wie das Museo Reina Sofía, das seit Kurzem der experimentierfreudige Manuel Borja Villel leitet, wird man nicht nur auf Ausstellungen setzen, sondern auf Konzertreihen, Debatten und ungewohnte Veranstaltungsformen. Die Rivalität der beiden Institutionen am Paseo del Prado dürfte sich als befruchtend erweisen.TEC21, Mo., 2008.09.01
01. September 2008 Klaus Englert
verknüpfte Bauwerke
Paseo del Prado
Museo del Prado - Erweiterung
Reina-Sofía-Museum
Caixa-Forum