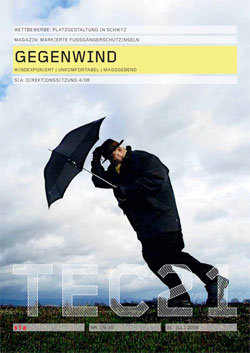Editorial
Hochwasser, Murgänge, Lawinenniedergänge und andere Elementarereignisse führen uns immer wieder vor Augen, welche zerstörerischen Potenziale weiterhin in der gezähmt scheinenden Natur schlummern und wie verwundbar unsere technisierte Gesellschaft durch derartige Ereignisse ist. Demgegenüber sind Erdbeben in der Schweiz in neuerer Zeit glücklicherweise weitgehend ausgeblieben. Ihre Eintretenswahrscheinlichkeit ist in bestimmten Gebieten aber nicht vernachlässigbar, und ihr Schadenpotenzial ist hoch. Gegen diese und weitere Naturgefahren sind in den letzten Jahrzehnten bauliche Schutzmassnahmen getroffen, Konzepte entwickelt und gesetzliche Grundlagen und Normen geschaffen worden.
TEC21 hat die Entwicklungen beim Schutz vor Natureinwirkungen aufmerksam verfolgt und regelmässig Forschungsergebnisse, Schutzkonzepte und realisierte Massnahmen vorgestellt. In den letzten Jahren ist dabei wenig über Windeinwirkungen auf Bauwerke und über die entsprechenden Gegenmassnahmen berichtet worden. Dies erstaunt, denn Stürme oder Orkane gehören zu den wenigen Naturgefahren, die sich grundsätzlich überall und jederzeit manifestieren können. Offenbar ist gegenwärtig Wind als Gefährdungsbild im Vergleich zu anderen Risiken nicht prioritär. Dabei liegt das letzte grosse Schadenereignis, der Orkan Lothar im Dezember 1999, weniger als ein Jahrzehnt zurück. Dieser «Jahrhundertsturm» forderte in der Schweiz mehrere Todesopfer, beschädigte zahlreiche Gebäude und legte grosse Teile der Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur kurzfristig lahm.
Ein derartiges Ereignis kann sich, statistisch gesehen, in wenigen Jahren wiederholen. Dieses Szenario hat uns bewogen, im vorliegenden Heft das Thema Wind und Windeinwirkungen auf Bauwerke und Menschen aufzugreifen. Eine zentrale Rolle bei der Erfassung und Beurteilung von Windeinwirkungen spielen die einschlägigen Normen SIA 261 und 261/1 (2003), deren Anwendung aber häufig zu Kontroversen Anlass bot. Hier brachte der 2006 erschienene Kommentar in der SIA-Dokumentation D 0188 eine wesentliche Verbesserung für die praktische Anwendung. Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis zeigen die spezialisierten Autoren der drei Beiträge, wie mit Hilfe der normativen Grundlagen Gefährdungen, oder auch nur Belästigungen, durch Windeinwirkungen an Hochbauten erfasst, modelliert und vermieden werden können.
In diesem Heft erscheint der Wind als zerstörerische Kraft, gegen die das Menschenwerk und die Menschen mit technischen Mitteln geschützt werden müssen. Um der vielgesichtigen Naturkraft Wind gerecht zu werden, wird sich das nächste Heft unter dem Titel «Aufwind» mit den nützlichen Aspekten im Sinne der technischen Nutzung der natürlichen Ressource Wind zur Energiegewinnung auseinandersetzen.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Platzgestaltung in Schwyz
11 MAGAZIN
Markierte Fussgängerschutzinseln
14 WINDEXPONIERT
Andreas Gianoli, Paul Lüchinger
Für Bauwerksformen, die nicht in der SIA-Norm aufgeführt sind, müssen eingehende Winduntersuchungen vorgenommen werden – z.B. Windkanalversuche.
18 UNKOMFORTABEL
Jacques-André Hertig
Ungünstig gestaltete oder platzierte Gebäude können unkomfortable Situationen verursachen. Störende Windböen und lästiger Durchzug lassen sich mit bestehenden Planungswerkzeugen verhindern.
24 MASSGEBEND
Bruno Zimmerli, Jacques-André Hertig
Die Ermittlung der Windkräfte nach SIA 261 ist komplex. Die ergänzende Dokumentation D 0188 ist dafür ein hilfreiches Werkzeug.
29 SIA
Direktionssitzung 4/08
31 PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Windexponiert
Zur Ermittlung der Windkräfte, die auf gewöhnliche Bauwerke einwirken, sind die SIA-Normen ein einfaches und bewährtes Hilfsmittel. Bei speziellen Bauwerken stossen sie jedoch an ihre Grenzen. Für die Konstruktion und Bemessung solcher Tragwerke sind weiterführende Untersuchungen erforderlich. So können Messungen am Modell im Windkanal aussagekräftige Ergebnisse liefern.
Wind und Böen nehmen Menschen – im Gegensatz zu anderen Einwirkungen auf Tragwerke – direkt wahr, sei es als angenehme Brise oder als zerstörerischen Sturm. Windstärke und Windrichtung ändern sich ständig und sind kaum voraussehbar. Für die Arbeit des Tragwerks- oder Fassadenplaners müssen diese komplexen Verhältnisse vereinfacht werden. Im Normenwerk des SIA wird dabei so vorgegangen, dass der Wind als statisch wirkende Kraft behandelt wird, in die die dynamische Wirkung auf die Bauwerke mit einem Beiwert eingerechnet wird. Bei Strukturen, die nicht schwingungsanfällig sind, ist dieser Wert gleich eins, deshalb kann das Verfahren nach der SIA-Norm im Allgemeinen einfach und konsistent eingesetzt werden. Bei speziellen Problemen wird auf die erforderlichen Vorgehensweisen verwiesen.
Auf Gebäude oder Gebäudeteile wirkende Windkräfte werden anhand von äusseren Gegebenheiten (Standort, Lage und Geometrie des Bauwerks) und des Schwingungsverhaltens des Tragwerks ermittelt. Sofern die entsprechenden Parameter eines Bauwerks durch die Angaben in den Normenwerken abgedeckt sind, können diese ohne weitere Untersuchungen übernommen werden. Ist dies nicht der Fall, wird eine Interpolation und Interpretation erforderlich, die jedoch nicht ohne weiteres die erforderliche Genauigkeit und Sicherheit erzielt. Dies gilt insbesondere für Bauwerksformen, die nicht im Anhang der SIA-Norm aufgeführt sind (Bild 2), für schwingungsanfällige Strukturen (Bild 3) und für Bauwerke an exponierter Lage (Bild 1). In diesen Fällen drängen sich weiterführende Untersuchungen und Berechnungen auf.
Untersuchungen im Windkanal
Die spezifischen Angaben für die Kräfte auf aussergewöhnliche Bauwerksformen und für das Schwingungsverhalten von Tragwerken können in Windkanalversuchen ermittelt werden. Dazu wird ein Modell des Bauwerks in einem Windkanal untersucht. Durch das Anordnen von Hindernissen wird im Kanal ein Windprofil erzeugt, das dem real zu erwartenden entspricht. Das Modell wird sowohl als Solitär als auch umgeben von den vorhandenen und den in Zukunft zu erwartenden Nachbarbauten untersucht (Bilder 4 und 5). Das Modell ist mit Sensoren ausgestattet, die die entstehenden Druckkräfte auf die Oberfläche messen. Aus diesen Ergebnissen können mit Hilfe von Umrechnungen und statistischen Auswertungen die statischen Windkräfte auf das reale Bauwerk ermittelt werden. Da die Steifigkeit und das Schwingungsverhalten des Windkanalmodells nicht denen des effektiven Bauwerks entsprechen, sind für die Ermittlung der dynamischen Bauwerksreaktion weitere Schritte erforderlich. Dazu wird ein äquivalentes Stab- oder FE-Modell des Tragwerks erstellt und in einer Computersimulation mit den gemessenen Lastzeitreihen belastet. So können die dynamischen Effekte untersucht und quantifiziert werden. Mit diesen Untersuchungen wird eine höhere Planungssicherheit erzielt, weil realitätsnahe Windkräfte angesetzt werden können. In diversen Fällen können dadurch die Trag- und Fassadenkonstruktionen optimiert werden.
Bis heute ist es nur begrenzt möglich, Windkanalversuche durch rein rechnerische Simulationen zu ersetzen. Solche sind im Hochbau jedoch auch nur selten erforderlich, weil die Windkanalversuche schnell und im Verhältnis zu den Bausummen kostengünstig durchgeführt werden können. Im Weiteren können bei einer Windkanaluntersuchung zusätzlich die Windverhältnisse in den umgebenden Freiflächen simuliert und gemessen und bei der Planung der Nutzung der Aussenräume verwendet werden (siehe dazu auch Artikel «Unkomfortabel» Seite 18 ff.).
Lokale Windverhältnisse
Bei exponierten Standorten reicht die Ermittlung des Referenzstaudrucks mit den Angaben aus den Normen nicht mehr aus. Hier bietet sich für die Ermittlung der Windverhältnisse neben Windkanalversuchen auch das Auswerten der Messwerte von lokalen Windmessstationen an. Da Windmessdaten im Allgemeinen nicht direkt am Bauplatz vorhanden sind, müssen umliegende Messstationen herangezogen und die Werte extrapoliert und mit bekannten Angaben bei ähnlichen Lagen abgeglichen werden. Diese Untersuchungen sind von ausgewiesenen Fachleuten durchzuführen, weil die richtige Interpretation der Daten grosse Erfahrung verlangt.
Tragsicherheit: Wind oder Erdbeben
Mit der Ermittlung von realitätsnahen Windkräften und den zugehörigen Bauwerksreaktionen ist ein wichtiger Teil der erforderlichen Arbeit für den Tragwerksentwurf getan. Der Nachweis der Tragsicherheit erfolgt danach gemäss den entsprechenden Konstruktionsnormen. Neben dem Wind ist auch die Einwirkung von Erdbeben zu untersuchen. Vereinfacht gilt bei Hochhäusern, dass bei einem weichen Tragwerk eher die Windeinwirkung massgebend ist. Eine steife, gedrungene Tragstruktur ist dagegen eher empfindlich gegenüber Erdbeben. Da bei den in der Schweiz üblichen Hochhausabmessungen nicht ohne weiteres erkennbar ist, welche Bemessungssituation massgebend wird, müssen beide Einwirkungen untersucht und einander gegenübergestellt werden. Ab einer gewissen Gebäudehöhe wird weise für die Gesamtstabilität am Gebäudefuss die Windbeanspruchung dominant. Bei der Abstufung der Aussteifungswände ist aber zu beachten, dass in den oberen Geschossen trotzdem die Erdbebenbeanspruchung für die Tragwerksbemessung massgebend werden kann. Im Zuge der Einführung erhöhter Erdbebenanforderungen wurden verschiedene Gebäude bezüglich ihrer Erdbebensicherheit überprüft, ohne dass der Wind beachtet wurde. Eine gemeinsame Betrachtung der beiden Bemessungssituationen ist jedoch unabdingbar.
Gebrauchstauglichkeit: Eine Frage des Komforts
Da es sich bei Wind um eine dynamische Einwirkung handelt, sind neben den Deformationen auch die Schwingungen und Beschleunigungen des Gebäudes zu untersuchen und zu beurteilen. Gerade Letztere werden von den Menschen direkt wahrgenommen. Die zulässigen maximalen Beschleunigungen werden mit der Auftretenswahrscheinlichkeit des Windereignisses gekoppelt und sind, im Gegensatz zu den Deformationen, nicht in der Norm geregelt. Sie müssen darum direkt mit der Bauherrschaft festgelegt werden. Auf Grund von weit reichenden Abklärungen über die Wahrnehmung und das Wohlbefinden von Gebäudebenutzern werden in der Literatur verschiedene Grenzwerte, die sich von «nicht spürbar» über «lästig» bis «unzulässig» erstrecken, angegeben. Sie sind abhängig von der Nutzung des Bauwerks. Bei einer Büronutzung sind beispielsweise grössere Beschleunigungen tolerierbar als bei einem Wohngebäude (Bild 5). Das müssen die Planer bei der Projektierung gebührend berücksichtigen, da die Tragstruktur im Allgemeinen später kaum oder nur sehr aufwendig verstärkt werden kann.
Bei einer Untersuchung des Windkomforts auf den Freiflächen im Aussenraum werden die Zonen unterschiedlicher Windgeschwindigkeiten in einem Plan dargestellt und mit der vorgesehenen Nutzung abgeglichen (Bild 9). Bereiche mit unangenehmen Windverhältnissen scheiden beispielsweise für Strassencafés aus. Zonen mit gefährlich hohen Windgeschwindigkeiten zwischen zwei eng beieinanderstehenden Gebäuden können durch geschicktes Platzieren von Hindernissen wie Bäumen, Vordächern oder Skulpturen auf dem grossen Platz entschärft werden (Bilder 7 und 8). Anhand der Untersuchungen kann ausserdem beurteilt werden, ob bei einer Eingangssituation mit Turbulenzen und Aufwinden zu rechnen ist, sodass eine allfällige Anpassung der Gebäudeform erwogen werden kann (Bild 8).TEC21, Mo., 2008.07.21
21. Juli 2008 Andreas Gianoli, Paul Lüchinger
Unkomfortabel
Wind auf Plätzen, zwischen Gebäuden, unter Dächern oder vergleichbaren Aussensituationen kann lästig sein. Bauten haben einen wesentlichen Einfluss auf die Windgeschwindigkeiten. Um diese in der Planung abschätzen zu können, sind detaillierte Studien erforderlich. Dabei ist der Komfort – im ingenieurtechnischen Sinne – eine wichtige Grösse.
PlanerInnen müssen zahlreiche Fallkategorien für Erscheinungsformen des Winds unterscheiden (Bilder 6 bis 10). Die vertrauteste Kategorie ist der Wind in Fussgängerzonen, auf Plätzen, (Dach-)Terrassen oder entlang von Strassen und Sportplätzen. Insbesondere verursachen Überdachungen bei Plätzen, aber auch Tunnels oder Unterführungen, die natürlich durchlüftet werden, eine Beschleunigung des Windes, die sich beispielsweise als Luftzug bemerkbar macht. So tritt der Wind in unterirdischen Passagen und Verbindungsgängen zwischen den Gebäuden teilweise (unerwünscht) ausgeprägt auf. Ebenso auf Brücken, wo er die Kippsicherheit von Fahrzeugen gefährden kann, oder in Stadien, wo Zonen mit Durchzug entstehen können. Schneeverwehungen treten an unerwünschten Orten auf, oder Zonen mit kalter Luft sorgen für Ärger. Verschiedene Fallkategorien stehen in Verbindung mit dem Unfall- oder Brandschutz und müssen in der Planung analysiert werden. Komfortansprüche sollten ebenfalls bereits in den ersten Planungsschritten eines Projekts diskutiert werden, da nachträgliche Anpassungen sehr kostspielig sein können.
Berücksichtigung von Komfort
Der Begriff des Komforts im Zusammenhang mit Winderscheinungen wird von Fachleuten heute allgemein anerkannt[1],[2],[3]. Menschen, die sich beispielsweise in der Nähe von grossen Gebäuden, in Unterständen oder auf offenen Plätzen aufhalten, dürfen demnach keinen Windgeschwindigkeiten ausgesetzt werden, die sie als unangenehm empfinden (Bild 4). Als noch komfortabel wird grundlegend ein Wind unter 6 m/s verstanden, je nach Tätigkeit und Situation werden aber höhere Windgeschwidigkeiten akzeptiert (Bild 5)1. Dank architektonischen Dispositionen zu Beginn der Bauphase ist der Aspekt des Benutzerkomforts während starker Windböen heutzutage relativ gut kontrollierbar – Durchzug und unerwünscht hohe Windspitzen können mit betrieblichen und mit baulichen Massnahmen verhindert werden.
Ein relatives Kriterium für die Beurteilung
Um Lösungen für den unzureichenden Komfort einer Anlage zu finden, wird in einem ersten Schritt eine klimatologische Analyse des Standorts durchgeführt. Diese liefert statistische Windgeschwindigkeiten je nach Tages- und Jahreszeit. Alsdann wird beurteilt, welche Schutzmassnahmen getroffen werden müssen. Allenfalls lassen sich betriebliche Lösungen (z.B. Grenzwert im Sport oder Schutzmassnahme im Brandfall, wie Durchlüftung im Gebäude oder in hinterlüfteter Fassade reduzieren) finden. Müssen bauliche Massnahmen getroffen werden, sind weiterführende Untersuchungen erforderlich. Sie beschäftigen sich mit der Evaluation des jeweiligen Komfortniveaus im Zusammenhang mit den gemessenen Windgeschwindigkeiten. Dabei wird die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen verglichen (Bild 4).
Einfache Berechnungen, deren Basis auf den Formeln der SIA-Norm 260 beruht, liefern durchaus zufriedenstellende Ergebnisse für wirkungsvolle Sicherheitsmassnahmen bezüglich Komfort. Auch die Entwicklung numerischer Modelle ist so weit fortgeschritten, dass deren Anwendung die Qualität des Komforts beispielsweise von dem Wind ausgesetzten Fussgängerzonen bestimmen kann. Diese Resultate können mit Windkanalversuchen verifiziert werden[2],[3]. Sie werden oft für eine Problemanalyse beigezogen und um die vorgeschlagenen Massnahmen zu testen – vornehmlich aber, um die Tragsicherheit zu garantieren. Zusätzliche weiterführende Untersuchungen bezüglich Benutzerkomfort – d.h. Gebrauchstauglichkeit – würden aber zu Einsparungen bei den Baukosten führen. Zumal Messserien der Windfelder auf Bodenhöhe bereits heute in die Windkanalversuche integriert werden und somit kein erhöhter Aufwand verursacht wird. Das Mass für Komfort kann auch rechnerisch ermittelt werden. Es erlaubt, die örtlich durch den Luftzug erzeugten Behinderungen zu erfassen. Die Definition des Komforts an der Stelle, wo die Störung zu bestimmen ist, ergibt sich aus folgender Gleichung[1]: siehe Illustration.
wobei _Uref und σref die mittlere Windgeschwindigkeit und die Standardabweichung der Variation der Windgeschwindigkeit für den betrachteten Ort ohne störende Gebäude bedeuten. Gleichermassen sind _U und σ die mittlere Windgeschwindigkeit und die Standardabweichung der Variationen der Windgeschwindigkeit an der Stelle mit störendem Objekt. Dieses Kriterium ist somit nicht absolut[1], sondern relativ und vergleicht den Zustand der Umgebung einmal mit und einmal ohne Gebäude (Bild 11).
Wind auf einem offenen Platz
Am Beispiel eines Verwaltungsgebäudes werden die Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung untersucht und die Windeinwirkung auf die Fassaden analysiert. Um die Komfortveränderung ausserhalb des Verwaltungsgebäudes zu bestimmen, werden drei Windrichtungen berücksichtigt: Föhn (Bild 13), S- bis SW-Wind (Bild 14), Bise (Bild 15). Die IngenieurInnen stellten fest, dass die vom Gebäude provozierten Wirbel nur von der Windgeschwindigkeit an der Gebäudespitze abhängen. Der Einfluss kann mit Hilfe der in der SIA-Norm 261 enthaltenen Formeln berechnet werden. Diese Schätzung beruht auf dem Verhältnis des durch den Wind verursachten Staudrucks an der Spitze des Gebäudes und desjenigen 2 m über Boden. Einbussen des Komforts treten nur dann auf, wenn der Wind aus ungünstiger Richtung (je nach Ort veränderlich) ausreichend stark (mindesten 25 km/h) bläst. Ausserdem ist die Windbeschleunigung lokal begrenzt und kann durch bauliche Massnahmen wie Windbrecher und Wände oder durch pflanzliche Anlagen eingeschränkt werden. Diese Problemstellung kann auch mit Windkanalversuchen oder anhand numerischer Berechnungen mit den erst kürzlich entwickelten CFD-Modellen (Computational Fluid Dynamics)[4] angegangen werden.
Wind in offenen Gebäudedurchgängen
Die Luftströmungen in offenen Gebäudedurchgängen sind abhängig vom Druckunterschied der beiden betroffenen Fassaden. Er lässt sich mit der in der SIA-Norm enthaltenen Druckbeiwerttabelle berechnen. Diese Druckbeiwerte der Fassaden (Δcp) hängen von der Wind - richtung und der Windgeschwindigkeit ab. Um deren Verteilung zu ermitteln, benutzen die Ingenieure die sogenannte Windrose (Bild 3). Für einen bestimmten Ort zeigt sie auf einem Kreis bei jeder Gradeinteilung (enspricht der Windrichtung) die Windwahrscheinlichkeit. Aus meteorologischen Messungen wird die mittlere Windgeschwindigkeit für jeweils eine Dauer von 10 min berechnet, dabei müssen die Daten aus der Meteomessstation für den betrachteten Punkt am Gebäude inter- bzw. extrapoliert werden. Die ermittelten Daten werden nach Windklasse (z. B. Klassen von 1 m/s) und Windsektor (normalerweise 10-Grad- Sektoren) geordnet und in einer Wahrscheinlichkeitstabelle, mit 25 Geschwindigkeitsspalten und 36 Sektorenzeilen, dargestellt. Diese Tabelle zeigt für jede Windklasse und jeden Windsektor die Häufigkeit bzw. die Auftretenswahrscheinlichkeit des Windes in der entsprechenden Gebäudeöffnung. Diese Tabelle wird dann in Form der Windrose als vektoriellesDiagramm dargestellt. Sind die massgebende Windrichtung aus der Windrose und die entsprechenden Druckbeiwerte der Fassaden (Δcp) mit dem dazugehörigen dynamischen Druckbeiwert aus den Tabellen der SIA-Norm ermittelt, können die Druckdifferenzen berechnet werden. Damit lassen sich schliesslich die Luftströmungen in den geplanten Gebäudeanlagen interpretieren und deren Auftretenswahrscheinlichkeiten eruieren. Solange diese Wahrscheinlichkeiten kleiner bleiben als die geforderten Komfortkriterien (Bilder 4 und 5), sind keine Massnahmen erforderlich. Andernfalls sind betriebliche oder bauliche Vorkehrungen zu treffen: Türen, Schiebetüren, Vorhang, Luftvorhang, Hindernis usw. Sind solche Massnahmen bereits in der frühen Planungsphase berücksichtigt, können erhebliche Kosten in der Ausführung gespart werden. Die weiterführenden Untersuchungen in Bezug auf die Gebrauchstauglichkeit im Sinne des Benutzerkomforts können nicht zuletzt auch ein grösseres Vertrauen in die Auswahl der Standorte der Bauwerke und die Realisation der Aussenanlagen schaffen.
Anmerkungen
[1] CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment: Aerodynamique, REEF – Volume II. Sciences du bâtiment, April 1980
[2] Beranek,W. J.: General rules for the determination of wind environment. Wind Engineering, Proceedings of the Fifth International Conference, Fort Collins Colorado, Juli 1979, S. 225–234
[3] Beranek,W. J.: Determination of the wind environment around building configuration. Colloque Construire avec la vent, Nantes, 15.–19. Juni 1981, S. II–1–1 bis II–1–15
[4] Blocken and Carmeliet: Pedestrian Wind Environment around Buildings: Literature Review and Practical Examples, Journal of Thermal Envelope and Building Science, 28/2004, S. 107–159
[5] Beispiele aus den Referenzprojekten von Hertig und H&L SA: Studien für Projekte wie Zollgebäude Boncourt, Letzigrund-Stadion Zürich, Stade de La Praille Genf, Herti-Eisstadion Zug usw.TEC21, Mo., 2008.07.21
21. Juli 2008 Jacques-André Hertig