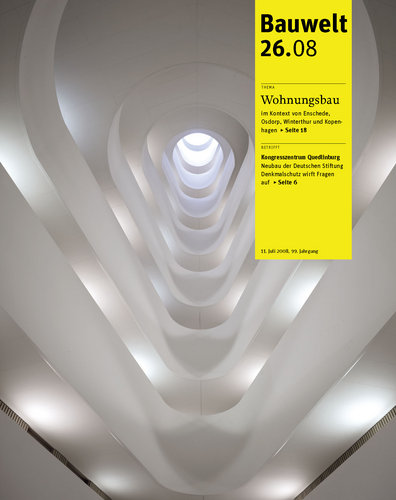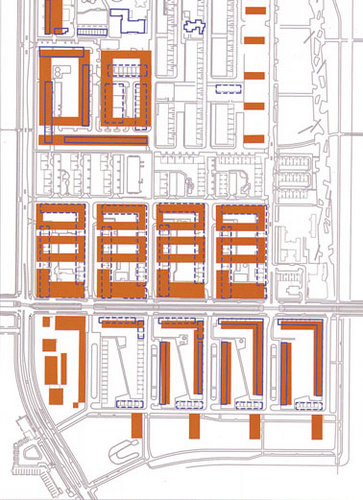Inhalt
WOCHENSCHAU
02 Der Fotograf Alexander Rodtschenko im Berliner Gropius-Bau | Christoph Tempel
02 Heterotopia. Outsider-Art im DAM | Thomas Amos
04 Pixelprojekt_Ruhrgebiet | Ulrich Brinkmann
BETRIFFT
06 Kongresszentrum Quedlinburg | Günter Kowa
WETTBEWERBE
12 Umbau des Hauptbahnhofs in Oslo | Friederike Meyer
15 Entscheidungen
16 Auslobungen
THEMA
18 De Eekenhof | Jaap Jan Berg
24 Klassizismus für die Ikea-Generation | André Kempe, Oliver Thill
30 Triangel Haus | Nils Ballhausen
34 VM Bjerget | Nils Ballhausen
REZENSIONEN
41 Flexible Housing | Susanne Schindler
41 Lebensräume| Volker Lembken
41 Neues Wohnen in der zweiten Lebenshälfte | Alexander Kluy
RUBRIKEN
05 wer wo was wann
40 Kalender
42 Anzeigen
48 Die letzte Seite