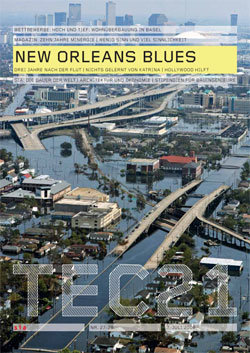Editorial
Es war eine Frage der Zeit, bis ein Hurrikan einmal genau über New Orleans ziehen und das Wasser aus dem Golf von Mexiko durch die vielen Seen und Kanäle im Mississippidelta bis in die Stadt hinauftreiben würde. Alle wussten das. Doch als es am 29. August 2005 soweit war, brachen an über hundert Stellen die Dämme, die in einem solchen Fall die Stadt unter dem Meeresspiegel schützen sollten. Auch das hatten viele vorausgesagt. Vier Fünftel des Stadtgebiets wurden überschwemmt, 1300 Menschen starben.
Drei Jahre danach wollten wir wissen, wie New Orleans seinen Wiederaufbau meistert, was dabei Neues entsteht und welche Lehren für die Verbesserung des Flutschutzes gezogen worden sind – doch das sind offenbar Fragen, die der schweizerischen Art der Katastrophenbewältigung entspringen. Für New Orleans sind sie nicht angemessen. Das merkten wir, als die bestellten Artikel eintrafen: Oliver Pohlisch erzählt, wer in den letzten drei Jahren was getan hat – oder vielmehr: nicht getan hat. Denn der Wiederaufbau zerstörter Quartiere kommt nicht voran. Nur wenige neue Häuser wurden gebaut, dank Selbsthilfe und NGO. Die Bevölkerung ist um 30 % geschrumpft. Schlendrian und Korruption sind legendär in der Stadt. Auch darauf zielt New Orleans’ Übername «The Big Easy», der nicht nur die aussergewöhnliche Kultur feiert, die aus dem Zusammenleben der französischen Gründerbevölkerung mit den Nachkommen der Sklaven und Einwanderern aus der französischen Karibik sowie anderen USStaaten entstanden ist. Hinzu kommen bald 30 Jahre neoliberaler Steuerpolitik: Die Gemeinden in den USA sind heute zu arm, um sich selbst zu helfen.
Fast noch unglaublicher ist der Bericht von Robert G. Bea. Der Professor am Institut für Bau- und Umweltingenieurwesen der Universität Berkeley untersuchte als Mitglied einer unabhängigen Kommission die Gründe für das Versagen des Flutschutzsystems. Er beschreibt dieses als Flickwerk und Resultat von Jahrzehnten der Misswirtschaft. Katrina sei keine Umwelt-, sondern eine politische Katastrophe, schreibt Bea. Und sie werde sich wiederholen, denn aus Katrina habe man nichts gelernt. Der Ingenieur ist so wütend, dass er gar nicht auf unsere Bitte einging, technische Verbesserungsvorschläge zu machen; sinnlos scheint ihm dies, solange keine politische Kultur in Sicht ist, die sie umsetzen könnte.
Wenn die Gemeinden verarmt sind, die Verwaltung zerstritten und die Politik korrupt ist, gibt es in den USA eine weitere Instanz, die einspringen kann, auch wenn sie nicht offi ziell zum berühmten «System of Checks and Balances» gehört – Hollywood. Lilian Pfaff beschreibt eines der wenigen funktionierenden Aufbauprojekte in New Orleans. Hinter dem internationalen Architekturwettbewerb steht der Schauspieler Brad Pitt.
Ruedi Weidmann
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Hoch und Tief: Wohnüberbauung in Basel
14 MAGAZIN
Zehn Jahre Minergie | Wenig Sinn und viel Sinnlichkeit – Ausstellung im S AM Basel
22 NEW ORLEANS – DREI JAHRE NACH DER FLUT
Oliver Pohlisch
In New Orleans harzt der Wiederaufbau nach dem Hurrikan Katrina. Am ehesten funktionieren noch Selbsthilfeprojekte der Stadtbevölkerung.
28 NICHTS GELERNT VON KATRINA
Robert G.Bea
Der Flutschutz von New Orleans brach 2005 an über 100 Stellen, weil Politik und Gesellschaft versagt haben: der Bericht eines wütenden Spezialisten, der vor Ort war.
33 HOLLYWOOD HILFT
Lilian Pfaff
Brad Pitt, Hollywoodstar und Architekturliebhaber mit sozialem Gewissen, nutzt den Kult um seine Person für architektonisch interessante Wiederaufbauhilfe.
38 SIA
Die Dauer der Welt | Architektur und Ökonomie | Stipendien für junge Bauingenieure
45 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
New Orleans – Drei Jahre nach der Flut
Vor drei Jahren, am 29. August 2005, fegte Katrina über New Orleans. Die Flutwelle, die der Hurrikan vor sich hertrieb, brachte Deiche und Schutzmauern zum Bersten, vier Fünftel der Stadt wurden überschwemmt, 1300 Menschen starben. Heute sind die Spuren der Verwüstung noch immer deutlich sichtbar. Der Wiederaufbau geht nur schleppend voran. Die hoffnungsvollsten Projekte werden durch NGO und Bürgerinitiativen in Gang gebracht – nicht zuletzt als Reaktion auf Stadtentwicklungspläne, die für ärmere afroamerikanische Teile der Bevölkerung keinen Platz mehr in New Orleans vorsehen.
Wie Filmkulissen eines Südstaatenmelodrams nehmen sich die Fassaden vereinzelter rekonstruierter Häuser in den von der Katastrophe geschaffenen weiten Brachen der Stadt aus. Um sie herum wurden komplette Gebäudezeilen abgerissen, und über die verbliebenen Betonfundamente breitet sich Wildwuchs aus. Nicht wenige Ruinen stehen aber noch; ihre Fenster sind mit Brettern vernagelt und die Türen von den Behörden versiegelt worden. Immerhin: Dort, wo sich von der Federal Emergency Management Agency (FEMA) bereitgestellte Wohnwagen befinden, arbeiten weitere Hausbesitzer beharrlich an der Wiederherstellung ihres Zuhauses. Die Pfahlbau-Ästhetik, die bei der Rekonstruktion dominiert, wird von den Versicherungen quasi mitdiktiert. Diese entschädigen nur, wenn die Eigentümer ihr Heim gemäss den Vorgaben der FEMA für das jeweilige Stadtviertel auf eine bestimmte Höhe anheben. Die geringe Dichte des Wiederaufbaus hingegen ist das Ergebnis einer knausrigen Verteilung von bundesstaatlichen Geldern an Hausbesitzer ohne ausreichenden Versicherungsschutz: Die Mittelvergabe aus dem Home Road Program bemisst sich am Verkehrswert eines Gebäudes vor der Katastrophe. Im Falle des Eigentums von afroamerikanischen Mittelschichts- und Arbeiterfamilien liegt dieser oft weit unter den Kosten für die Instandsetzung.
Nach der Katastrophe der Themenpark?
Seit die Stadt wieder trockengelegt ist, kämpft die schwarze Community oft unbeachtet von den Medien darum, überhaupt eine Zukunft in New Orleans zu haben. Zwar ist die Einwohnerzahl wieder auf 327000 gestiegen, das sind 72% der Bevölkerungsgrösse vor Katrina. Allerdings war die Stadt im Sommer 2005 zu 67% schwarz, heute ist sie es nur noch zu 58%. Nach Ansicht des Urbanisten Mike Davis wird die Rückkehr der afroamerikanischen Bevölkerung von einer Politik erschwert, welche die Katastrophe als einmalige Chance begriffen hat, um New Orleans mit Vertreibungen, Privatisierungen und Umstrukturierungen in einen makellosen Themenpark für den gehobenen Tourismus zu verwandeln. Schwarze fänden darin nur noch als Museumshüter der von ihnen geprägten weltbekannten Jazz- und Karnevalskultur Verwendung.[1]
Einer der grössten Grundstücksbesitzer im French Quarter äusserte sich unverblümt: «Der Hurrikan hat arme Leute und Kriminelle aus der Stadt gefegt, und wir hoffen, dass sie nicht zurückkommen werden. Die Party ist für diese Leute endlich vorbei, und nun müssen sie sich einen anderen Platz zum Leben in den Vereinigten Staaten suchen.» In der Bevölkerung ging die Angst vor einem Landraub um: Der schwarzen Arbeiter- und Mittelschicht solle dank planerischen Restriktionen der Grund abspenstig gemacht werden, damit Investoren darauf profitable Grossprojekte errichten könnten. Tatsächlich hatte der demokratische Bürgermeister Ray Nagin im Rahmen des im Winter 2005 lancierten «Bring New OrleansBack»-Plans (BNOB-Plan) das von der US-Immobilienbranche gesponserte Urban Land Institute (ULI) damit beauftragt, ein Landnutzungskonzept für New Orleans zu erstellen. Die ULI-Planer propagierten eine radikale Zäsur in der Stadtentwicklung. Sie schlugen vor, die Siedlungsfläche zu verkleinern, und illustrierten das mit Karten, auf denen die am stärksten überfluteten Quartiere durch Grünflächen ersetzt waren. Dieser Vorschlag erwies sich als PR-Desaster. Die Wut betroffener Einwohner darüber, dass die Zukunft ihrer Viertel in Frage gestellt wurde, liess die Mitgliederzahlen von Nachbarschaftsorganisationen und Bürgerinitiativen massiv ansteigen. Einige begannen sogar, mit Hilfe von Architekturbüros und Wissenschaftern eigene Entwicklungspläne für ihr Quartier aufzustellen.
Ein Plan, bei dem alle mitreden
Bürgermeister Nagin distanzierte sich schnell von der Idee der Stadtverkleinerung, da er fürchtete, bei den bevorstehenden Wahlen sein Amt zu verlieren. Stattdessen betonte er nun, dass alle das sofortige Recht auf Rückkehr hätten. Der freie Markt solle entscheiden, welche Quartiere Überlebenschancen hätten und welche nicht. Der Stadtrat beauftragte Wohnungsbauberater Paul Lambert mit der Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren in den 46 von der Flut betroffenen Stadtteilen. Der so genannte Lambert-Plan wurde mit 2.9 Mio. Dollar aus Bundesmitteln gefördert. Weil ihm aber ein langfristiges Konzept für die gesamte Stadt fehlte, gab die Louisiana Recovery Authority (LRA) die dringend gebrauchten Hilfsmittel des Bundes nicht frei. Ein Jahr nach Katrina war New Orleans die letzte betroffene Verwaltungseinheit, die noch immer keinen kohärenten Wiederaufbauplan vorweisen konnte. Die LRA begann nun Druck auf die Kommune auszuüben, und die Rockefeller Foundation erklärte sich bereit, ein die ganze Stadt umfassendes Planungsverfahren mit 3.5 Mio. Dollar zu unterstützen. Der Bundesstaat Louisiana, die Stadt und die FEMA kamen schliesslich überein, mit diesem Geld den «Unified New Orleans Plan» (UNOP) anzuschieben.
Der UNOP-Prozess kann wohl als eines der grössten Bürgerbeteiligungsverfahren in der US-Geschichte gelten. Seine wesentliche Aufgabe war es, den Unmut unter den zivilgesellschaftlichen Akteuren über den bisherigen Verlauf des Wiederaufbaus zu kanalisieren. In den dreizehn städtischen Planungsdistrikten konnten die am UNOP-Prozess teilnehmenden Nachbarschaftsvertreter je ein Team aus landesweit tätigen Architektur- und Planungsbüros auswählen, mit dem sie Pläne für ihren Distrikt entwarfen. Diese Arbeit wurde mit der Entwicklung eines Gesamtkonzepts für New Orleans synchronisiert. Auf drei sogenannten Community Congresses partizipierten auch noch nicht zurückgekehrte Flüchtlinge per Konferenzschaltung in andere US-Städte am Planungsprozess.[2]
Nur vier Monate waren für den UNOP-Prozess angesetzt. Rob Olshansky, Professor für Stadtplanung an der Universität Urbana, Illinois, und Mitarbeiter des UNOP-Stabes, bezeichnet ihn als äusserst erfolgreich. Nach dieser kurzen Zeit konnte der LRA ein kohärenter Entwicklungsplan vorgelegt werden, der endlich die Auszahlung der staatlichen Wiederaufbaugelder auslöste. «UNOP hat eine grosse Anzahl von Einwohnern dazu gebracht, über ihre Viertel und die Beziehungen zwischen den einzelnen Stadtteilen nachzudenken und zu diskutieren», so Olshansky. Die quartierübergreifende Vernetzung von Nachbarschaftsgruppen sei gefördert worden, und der UNOP bilde eine solide Basis für die folgenden Planungen der Kommune.[3]
Im Dezember 2006, während der UNOP-Prozess anlief, bündelte Bürgermeister Nagin acht verschiedene Verwaltungsstellen im Office of Recovery Management (später in New Orleans Redevelopment Agency umbenannt) zur besseren Koordination des städtischen Wiederaufbaus. Als dessen Chef setzte er Edward J. Blakely ein, Dekan der Fakultät für Stadtplanung an der Universität Berkeley, der sich beim Wiederaufbau Oaklands nach dem Erdbeben von 1989 einen guten Ruf als Experte für Stadtentwicklung im Katastrophenfall erworben hatte. Blakely übersetzte den UNOP im Frühjahr 2007 in den sogenannten «17 Target Zones»-Plan. Dieser weist 17 Förderzonen mit jeweils einem Durchmesser von einer halben Meile aus, die sich entlang wichtiger Verkehrsachsen und rund um traditionelle Geschäftszentren erstrecken. Blakely baut auf einen Domino-Effekt: Die begrenzten Finanzmittel der Stadt werden in Infrastruktur investiert und als Darlehen für private Investitionen in diese Zonen vergeben. Deren Revitalisierung, hofft er, greife mit der Zeit auf die umliegenden Areale über. Die Intensität der Förderung soll sich nach dem Ausmass der Zerstörung der Bausubstanz und der sozialen Strukturen in der jeweiligen Zone richten. Darüber hinaus will die Stadt vor allem den Ausbau medizinischer Einrichtungen im Stadtzentrum als einen Motor der lokalen Wirtschaft fördern.
Der Katastrophenmanager bleibt stecken
Doch heute, ein Jahr später, zeigen sich viele Einwohner der Stadt darüber frustriert, dass in den 17 Förderzonen nur wenige Aktivitäten zu registrieren sind. Ed Blakely erklärt die schleppende Entwicklung mit bürokratischen Hürden, einer verzögerten Auszahlung der Bundeshilfen und den strengen Massstäben für die Ausgabe öffentlicher Gelder. Letzteres sei eine Konsequenz aus der an Misswirtschaft reichen Geschichte der Stadtverwaltung. Zudem wird Blakely nicht müde, darauf hinzuweisen, dass der Wiederaufbau von Oakland schliesslich mehr als eine Dekade gedauert habe. Inzwischen herrscht erneut Kakofonie im Wiederaufbauprozess. Die New Orleans Building Corporation, im Jahr 2000 vom Stadtrat eingesetzt, um städtischen Grund profitabel zu entwickeln, treibt die Transformation der alten Hafenanlagen am Mississippi in eine Kette von Parks, Veranstaltungsorten und Restaurants voran. Doch für die Uferaufwertung und andere von privatwirtschaftlicher Seite favorisierte Grossprojekte wie Sportstätten rund um den Superdome, neue Behördenkomplexe sowie einen Theaterdistrikt am Rande des French Quarter fehlt das Geld. Die von lokalen Unternehmern getragene Initiative «Global New Orleans, a Vision for Change» möchte es mit dem Verkauf der Betreiberrechte des Louis Armstrong International Airport an Louisiana beschaffen. 500 Mio. Dollar soll der Staat dafür an die Stadt zahlen und mit dem Ausbau des Flughafens möglichst noch den Wirtschaftsstandort New Orleans attraktiver machen.
Architekturlabor dank Non-Profit-Sektor und Showbiz
Vorderhand ist die Selbstorganisation auf Stadtteilebene das Schlüsselelement im Wiederaufbau. Doch trotz allen Vernetzungsbemühungen: Die jahrelange staatliche Politik der Mittelverknappung und des Rückzugs aus kommunalen Dienstleistungen zwingt die einzelnen Stadtteile tendenziell in einen Wettbewerb um Hilfsgelder von karitativ gesinnten Privatpersonen und Unternehmen. «Nachbarschaften, die nicht kreativ denken und ihre Angelegenheiten selbst in die Hände nehmen, können ins Hintertreffen geraten», legitimiert etwa die Broadmoor Development Corporation ihre Kooperation mit HGTV, einem kommer-ziellen Fernsehprogramm mit Einrichtungs- und Garten-Ratgebersendungen, beim Bau von zwei Häusern und diversen Aufräumarbeiten im Stadtteil.[4]
Dort, wo die Bewohner kaum eigene Mittel besitzen, um ihre Existenz in New Orleans sicherzustellen, ist in den vergangenen zwei Jahren immerhin eine vielfältige Szene von Non-Profit-Organisationen eingesprungen. Mit akademischer Expertise und oft dank öffentlichkeitswirksamer Unterstützung durch das Showbiz hat sie kleinteilige Wiederaufbauprojekte angeschoben und trotzt so der Behauptung, dass die Quartiere der ärmeren Afroamerikaner keine Zukunft hätten. In dem von der Flut am schwersten heimgesuchten Lower Ninth Ward und in angrenzenden Vierteln entwickelt sich New Orleans dank dem Non-Profit-Sektor zum Schaufenster experimenteller Öko-Architektur für schmale Geldbeutel und prekäre Topografien. Das «Make it Right»-Projekt von Hollywoodstar Brad Pitt ist derzeit das aufsehenerregendste unter diesen Projekten (vgl. Artikel S. 33–35).
Brad Pitt unterstützt daneben auch ein Projekt von Global Green USA, einer landesweiten Organisation, die nachhaltiges Bauen propagiert. Zusammen mit der Home Depot tion hat sie im Mai das erste Solarenergiehaus im Lower Ninth Ward eingeweiht.[5] Als temporäres Büro der Holy Cross Neighborhood Association und Besucherzentrum ist es Teil einer grösseren Anlage nach einem Entwurf von Matthew Berman und Andrew Kotchen von Workshop/APD, der unter 125 Eingaben im Wettbewerb «Sustainable Design for New Orleans» ausgewählt wurde. Das Projekt umfasst sechs Einfamilienhäuser, ein Apartmenthaus mit 18 Wohnungen, ein Community Center und ein Institut für nachhaltiges Design und Klimaschutz.
Ein anderes Vorhaben fokussiert auf den Schutz des kreativen Milieus der ärmeren afroamerikanischen Quartiere. Das Musicians’ Village im Upper Ninth Ward soll mit über siebzig Einfamilienhäusern Heimstatt für Musiker und Musikerinnen werden, die durch Katrina ihr Hab und Gut verloren haben. Realisiert wird die Siedlung von Habitat for Humanity, ihr Entwurf beruht auf Ideen von Harry Cornick jr. und Branford Marsalis, zwei der berühmtesten Musiker mit Wurzeln in New Orleans. Herzstück der Siedlung wird das Ellis Marsalis Center for Music mit Konzertsaal, Proberäumen, Einrichtungen für den Musikunterricht und einem Quartierzentrum mit sozialen Dienstleistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage sein. Habitat for Humanity hat es besonders gut verstanden, Politiker und andere Prominente für das eigene Projekt einzuspannen. Selbst Präsident Bush hat schon einige Nägel ins Dachgebälk gehämmert.
Den nachhaltigsten Widerstand gegen ein Verschwinden der afroamerikanischen Quartiere hat aber wohl Acorn geleistet. Die in den 1970er-Jahren gegründete landesweite Organisa-tion einkommensschwacher Mieter und Hausbesitzer verfügt in New Orleans über eine Mitgliederbasis von 9000 Familien. Als die Stadt im Dezember 2005 den Hausbesitzern mit Enteignung und Abriss ihres beschädigten Eigentums drohte, wenn sie die Schlammmassen und ihren wertlos gewordenen Hausrat nicht entsorgten, organisierte Acorn 15 000 Freiwillige für Aufräumarbeiten und konnte so 2500 Häuser retten.[6]
Acorn stellte auch das Planungsteam für das Lower Ninth Ward im erwähnten UNOP-Verfahren. Mit Hilfe von Forschenden dreier Universitäten dokumentierte Acorn im «People’s Plan for Rebuilding the Lower Ninth Ward» den Rückkehrwillen der Bevölkerung des Quartiers und entwickelte ein detailliertes Konzept für dessen Revitalisierung. Es war entscheidend für die mit 145 Mio. Dollar dotierte Aufnahme des Lower Ninth Ward als Wiederaufbauzone in den «17 Target Zones»-Plan. Damit war die Idee einer Renaturierung des Quartiers endgültig vom Tisch. Im Februar 2007 konnte Acorn im Lower Ninth Ward zwei sturmresistente Energiesparhäuser fertig stellen, und die Organisation hat auch den Zuschlag für den Wiederaufbau von weiteren 150 Objekten erhalten.
12000 Obdachlose – Stadt bricht Sozialsiedlungen ab
Doch Nachbarschaftsvertretungen und Non-Profit-Organisationen können sich nicht allen Härten staatlicher Politik entgegenstellen. Vor allem einfachen Mieterinnen und Mietern scheint die Rückkehr in ihre Stadt auf Dauer verbaut zu sein. Die Flutkatastrophe hat zwei Drittel des Mietwohnungsbestandes in Mitleidenschaft gezogen. Die folgende Knappheit hat zu horrenden Mietpreissteigerungen geführt. Hope House, eine Mieterinitiative, berichtet von monatlich vier- bis fünfhundert Personen, die sie wegen abgedrehter Strom- und Wasserversorgung, drohender oder schon erfolgter Räumung um Hilfe bitten. Mit 12000 ist die Zahl der Obdachlosen heute doppelt so hoch wie vor der Flut. Die Kommune trägt noch aktiv zu dieser Wohnungskrise bei. Der Stadtrat beschloss im Dezember 2007, vier Sozialbausiedlungen mit 4500 Wohnungen abzureissen. Schon vor Katrina standen sie im Ruf, «Brutstätten der Kriminalität» zu sein. Die «New York Times» kritisierte diesen Beschluss als ein Echo der rabiaten Slumreinigungspolitik der 1960er-Jahre und pries Teile der Siedlungen als vorbildliche Beispiele des öffentlichen Wohnungsbaus während der Phase des New Deal in den 1930er-Jahren.[7] Die einst für die Siedlungen zuständige städtische Sozialwohnungsbaubehörde wurde 2000 wegen Misswirtschaft unter Zwangsverwaltung des Bundesministeriums für Stadtplanung (HUD) gestellt. Das HUD will nun anstelle der alten Bauten von privaten Investoren Anlagen mit sozialer Durchmischung errichten lassen. Es wird dort nicht mehr genug Platz für die rund 20000 Personen geben, die vor Katrina in diesen Housing Projects lebten. Die UNO fordert den Stopp des Abrisses, da er eine Menschenrechtsverletzung darstelle.
Die Vernichtung öffentlichen Wohnraums ist tatsächlich ein Indiz für die Absicht massgeblicher Akteure in Politik und Wirtschaft, zumindest die rasche Rückkehr der afroamerikanischen Working Poor ans Mississippiufer zu verhindern. Dass sich aber die apokalyptischen Prophezeiungen von Mike Davis und anderen nicht bruchlos bewahrheitet haben, ist vor allem den lokalen Stadtteilinitiativen und landesweiten Non-Profit-Organisationen zu verdanken, die das Fortbestehen der am stärksten zerstörten Viertel mit Vehemenz zu sichern versuchen. Ob die Kommune diese städtische Bewegung zukünftig stärker an politischen Entscheidungen teilhaben lassen möchte, wird sich dann wirklich zeigen, wenn sie über die Verwendung der vielen leergeräumten Grundstücke von Hauseigentümern entscheiden muss, die – gegen Entschädigung aus dem Road Home Program – New Orleans tatsächlich für immer Lebewohl gesagt haben.
Anmerkungen
[1] Mike Davis: «Gentrifying Disaster», in: Mother Jones, 25. Oktober 2005
[2] Zum UNOP-Prozess und dessen Vorgeschichte vgl. Ray Mikell: A Unified New Orleans? Neighborhood Organizations, Factionalism and Rebuilding after Katrina: A Preliminary Report, 6. Januar 2007, New Orleans
[3] Gespräch mit dem Autor am 21.Mai 2008
[4] Becky Bohrer: «With ‹Katrina Fatigue› Worn Off, Magazines Chronicle a Rebirth», in: The Washington Post, 5. April 2008, S. F11, Washington
[5] Website von Global Green: www.globalgreen.org
[6] Website von Acorn: www.acorn.org
[7] Nicolai Ourousoff: «High Noon in New Orleans: The Bulldozers Are Ready», in: The New York Times, 19. Dezember 2007, New YorkTEC21, Mo., 2008.07.07
07. Juli 2008 Oliver Pohlisch
Nichts gelernt von Katrina
Das Flutschutzsystem von New Orleans versagte beim Hurrikan Katrina kläglich. An über 100 Stellen brachen Dämme, 80 % des Stadtgebiets wurden überschwemmt. Robert Bea, der Autor dieses Artikels, ist Professor am Institut für Bau- und Umweltingenieurwesen in Berkeley. 2005 untersuchte er in New Orleans die Gründe für dieses Versagen. Sein Resultat: Seit 1965, als Hurrikan Betsy einen Drittel der Stadt unter Wasser setzte, hat man nichts gelernt, die Zuständigkeiten bleiben weiter ungeregelt, die Reparaturen sind Flickwerk – «Katrina» war keine Umwelt-, sondern eine politische Katastrophe. Und sie wird sich wiederholen. Der Bericht eines wütenden Ingenieurs.
Eine Hauptursache für das Versagen des Flutschutzes wurzelt in seiner langen Entstehungsgeschichte. Das System wurde seit dem frühen 18. Jahrhundert entwickelt, als man den ersten Deichring um die Stadt legte – nach Vorbildern in Frankreich, dem Herkunftsland vieler Einwohner von New Orleans. Seitdem errichtete man höhere und breitere Dämme, und zwar stets auf der Krone der schon vorhandenen Deiche. In den 1850er-Jahren wurden Entwässerungskanäle gegraben, die für den Ablauf von Regen- und Flutwasser aus der Stadt sorgen sollten. Im frühen 20. Jahrhundert baute man Pumpstationen mit den innovativen Wood-Propellerpumpen. Mit der Ausdehnung der Stadt wurden weitere Flächen eingedeicht, die Sümpfe trocken gelegt, aufgeschüttet und besiedelt. Das Flutschutzsystem ähnelt einem Flickenteppich, an dem über mehrere Generationen hinweg gewerkelt wurde. Von einem integrierten und kohärenten System kann keine Rede sein, vielmehr von einer Ansammlung zusammenhangsloser Stücke, die mit vielfältigsten Mitteln und Methoden konzipiert, gestaltet, konstruiert, betrieben und instand gehalten werden.
Ein dramatischer Weckruf durch Hurrikan Betsy im Jahre 1965 wies auf die Defekte und Unzulänglichkeiten dieses Systems hin: Dämme brachen, Pumpanlagen versagten ihren Dienst, über 30 % der Stadt wurden überflutet. Der Autor lebte zu dieser Zeit im Osten von New Orleans. Seine Familie verlor ihr Haus und alle Habseligkeiten. Betsy führte vor, dass die bis ins Herz von New Orleans gegrabenen kommerziellen Wasserwege und Entwässerungskanäle die vom Hurrikan verursachte Flut in die Stadt lenkten und in einigen Fällen gar verstärkten.
Nach dem Hurrikan Betsy nahm man sich vor, dass «das niemals wieder passieren würde». Während der folgenden Monate ergriffen der Bezirk, der Staat Louisiana und die Bundesbehörden Massnahmen zur Planung von Reparaturen und zum Ausbau des Systems. Künftig sollte ein Schutz vor einer 200- bis 300-Jahr-Flut gewährleistet werden. Auf der Ebene des Bundes verantwortete hauptsächlich das U.S. Army Corps of Engineers die Planung und Konstruktion der Schutzdämme. Der Staat Louisiana und der Bezirk übernahmen deren Betrieb und Instandhaltung. Planung, Konstruktion, Betrieb und Instandhaltung der Flutwasserbeseitigung fielen hingegen in die Zuständigkeit der Bezirksbehörden. Die Koordination und Kommunikation zwischen diesen vielen Amtsstellen erstickte oft schon im Keim. Aus vielerlei Gründen war bis in die frühen 1990er-Jahre noch nicht einmal die Planung für das verbesserte Post-Betsy-System abgeschlossen. Die verantwortlichen Behörden konnten sich nie einigen, was auf welche Weise zu tun sei. Die Frage, wer was bezahlen musste, wurde zur Hauptsache. Das U.S. Army Corps of Engineers war zahlreichen technologischen, zeitlichen und finanziellen Zwängen sowie politischem Druck ausgesetzt. Technische Anforderungen an den Flutschutz kollidierten mit den Interessen von Fischerei und Umweltschutz. Es wurden neue Pläne entwickelt, um mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt zuvermeiden. Im Lauf der Jahre führten die lokalen Deichbehörden einige Reparaturen und Sanierungen von Teilen des Systems durch.
In den 1990er-Jahren kam der Ausbau des Systems schliesslich voran. Endlich einigte man sich, wer was, wo und wie tun – und wer wofür zahlen sollte. Doch dafür war man eine Reihe von Kompromissen eingegangen. Und in der Folge tat man alles mögliche, um Kosten zu reduzieren und die Zeit bis zum Abschluss der Arbeiten abzukürzen. Unglücklicherweise wusste niemand genau, wie sich dies auf die Funktionssicherheit des Flutschutzsystems auswirken würde. Anspruchsvolle Technologie und hohe Qualität wurden Eigeninteressen geopfert. Forschungsergebnisse fanden ihren Weg in die Praxis nicht. Und die Lehren, die andere Länder wie die Niederlande, Grossbritannien oder Japan aus den Erfahrungen mit Fluten gezogen hatten, wurden nicht beherzigt. Auf Bundes-, Staats- und Bezirksebene wurden die Haushaltsmittel für den Flutschutz Schritt für Schritt reduziert. Die Finanzierung erfolgte sporadisch. Instandsetzungen wurden bestenfalls oberflächlich durchgeführt, Teile des Systems zerfielen. Zu Beginn des Jahres 2005 schätzte man, dass es mindestens zehn weitere Jahre dauern würde, um das System, das 1965 bewilligt worden war, endlich fertig zu stellen.
In dieser Periode gab es beunruhigende Anzeichen dafür, dass sich der Aushub weiterer kommerzieller Wasserwege – wie der Mississippi River Gulf Outlet und der Inner Harbor Navigation Canal – extrem nachteilig auf die natürliche Umgebung auswirkte. Schützende Feuchtgebiete und Sümpfe verschwanden in alarmierendem Ausmass. New Orleans, einst ein Binnenhafen, wurde zum offenen Küstenhafen. Den Hurrikans, die vom Golf von Mexiko kamen, war die Stadt nun direkt ausgesetzt. Durch die kombinierte Wirkung aus Bodensetzungen, Expansion der Siedlungsfläche und steigendem Meeresspiegel geriet der grösste Teil von New Orleans unter Meereshöhe.
Nach vierzig Jahren Arbeit, die auf Hurrikan Betsy folgten, prüfte am 29. August 2005 Hurrikan Katrina den Flutschutz des Grossraums New Orleans. Dieses Mal wurden 80 % des Gebietes überschwemmt. Auch der Verlust von Menschenleben, die Zahl der obdachlos gewordenen Familien und der beeinträchtigten und zerstörten Existenzen waren substanziell grösser als bei Betsy. Geschätzt wurde, dass die absoluten direkten und indirekten Kosten der Flutschäden die Grenze von tausend Milliarden Dollar überschritt.
Der Autor traf einige Wochen nach Hurrikan Katrina in New Orleans ein. Er war Mitglied einer unabhängigen Untersuchungskommission (Independent Levee Investigation Team, ILIT) mit über dreissig erfahrenen Forschern und Ingenieuren sowie Studierenden. In freiwilliger Arbeit suchten sie nach den Ursachen für die Brüche und Fehlfunktionen des Flutschutzes. Ein Grossteil des Gebiets befand sich noch unter Wasser, während auf den DachbödenLeichen geborgen wurden. Der Autor stand vor seinem ehemaligen Zuhause und musste mit ansehen, wie die jetzigen Besitzer ihre Habseligkeiten zur Tür herausschleppten, gerade so, wie er es vierzig Jahre zuvor getan hatte.
Nach dem Versagen des Flutschutzsystems waren eilig Untersuchungen eingeleitet worden. Die finanziell am besten ausgestattete wurde vom U.S. Army Corps of Engineers durchgeführt: Mehrere hundert Wissenschafter und Ingenieure waren darin involviert. Vom Corps of Engineers und dem Department of Defense wurden gleich zwei Aufsichtsgremien eingesetzt, um die Untersuchungsergebnisse des Corps of Engineers nochmals zu überprüfen.
Wegen der Grössenordnung der Katastrophe herrschte besonders beim Corps of Engineers ein extremer politischer Druck, Tatsachen zu bestreiten und von ihnen abzulenken. Anfänglich erklärte das Corps of Engineers das Versagen des Flutschutzes öffentlich zu einem Akt «höherer Gewalt» – das System sei einfach überwältigt worden von einem Hurrikan bisher nicht gekannter Stärke. Es waren zunächst vier andere Untersuchungen, die beunruhigende Hinweise darauf gaben, dass das System nicht so funktioniert hatte wie vorgesehen, dass Teile vorzeitig oder auf unvorhergesehene Weise versagten – und gewisse Teile schlichtweg fehlten! Eine wurde vom National Institute for Standards and Technology (NIST) durchgeführt, eine andere durch ein Team von Ingenieuren und Wissenschaftern aus Louisiana, die schon sehr bald nach dem Hurrikan in New Orleans eingetroffen waren. Eine weitere unternahm die American Society of Civil Engineers (ASCE). Schliesslich finanzierten die National Science Foundation und die University of California in Berkeley eine vierte Untersuchungskommission – das Independent Levee Investigation Team. In den ersten Tagen nach Hurrikan Katrina erklärte das Team aus Louisiana, dass es sich bei dem Desaster nicht um höhere Gewalt gehandelt habe – es sei von Menschenhand verursacht und überdies auch vorhergesagt worden. Dies brachte das Team in direkte Konfrontation mit dem Corps of Engineers. Die ersten Ergebnisse von NIST, ASCE und ILIT erhärteten jedoch die Einschätzungen des Teams aus Louisiana.
Technische und strukturelle Ursachen
Nach über 8000 Arbeitsstunden, die der Autor für eigene Untersuchungen und das Studium der Ergebnisse anderer Untersuchungsteams aufgewendet hat, kann er die Gründe für das Versagen des Flutschutzes in zwei Kategorien einteilen: technische und strukturelle. Die technischen Gründe umfassen Schadensarten, die bei der Planung des Schutzes nicht berücksichtigt worden waren. Ein Überlaufschutz war nicht vorgesehen; das Eindringen von Wasser zwischen die Flutschutzmauern und den Grund, auf dem sie stehen, wurde ebenfalls nicht in Erwägung gezogen; Erdschichten mit niedriger Festigkeit wurden nicht sorgfältig aufgespürt, stark wasserleitende Schichten einfach ignoriert.
Doch die Hauptgründe für das Versagen fallen in die strukturell-politische Kategorie. Die Organisation des Systems erwies sich als disfunktional: Für die Vision und die Führung, die nötig gewesen wären, um ein hochqualitatives und funktionssicheres Flutschutzsystem zu errichten, fühlte sich keine der involvierten Behörden verantwortlich. Es waren keinerlei Ressourcen bewilligt und eingesetzt worden, um solch eine Vision zu realisieren.
Diese und andere, ähnlich schmerzvolle Erfahrungen haben zur Erkenntnis geführt, dass es keine «Naturkatastrophen» gibt. Es gibt natürliche Gefahren wie Hurrikane, Taifune und Erdbeben, und es gibt menschliche Anmassung, Arroganz, Ignoranz und Trägheit. Kombiniert man beides, ist früher oder später eine Katastrophe zu erwarten. Genau davon handelt die Geschichte vom Versagen des Flutabwehrsystems in New Orleans beim Hurrikan Katrina.
Gegenwart
Heute gibt es viele Orte in der Stadt, an denen die Ablagerungen und Schäden der Flut noch sichtbar sind. Zahlreiche Menschen bleiben Vertriebene. Viele sind desillusioniert und kommen nicht mehr zurück. Die Stadt und ihre Einwohner kämpfen tagtäglich um eine Rückkehr zur Normalität. Symptome der Katrina-Müdigkeit sind unübersehbar.
Die Brüche im Flutschutzsystem sind repariert worden. In einigen Fällen wurden die Dämme auf die vor Katrina genehmigte Höhe aufgestockt. Man führte einige Verbesserungen durch, etwa den Bau von Pumpanlagen und von Toren an den Mündungen der zentralen Entwässerungskanäle. Doch bereits sind Mängel und Unzulänglichkeiten an den Reparaturen offensichtlich geworden. Die Reparaturen mussten selber wieder repariert werden, neue Pumpen und Fluttore versagten in Tests.Die schwer beschädigten und rissigen Bereiche unmittelbar neben den vielen Dammbrüchen wurden nicht saniert. An verschiedenen Orten zeigen sich beunruhigende und unerklärbare Lecks, zum Beispiel nahe den Einbrüchen am 17th Street Canal und im Lower Ninth Ward. Das System hat noch viele schwache Glieder – und die Kette des Flutschutzes ist nur so stark wie seine schwächsten Glieder.
Einige Verbesserungen wurden am institutionellen System unternommen. Zum Beispiel hat das Corps of Engineers zwölf «Actions for Change» gestartet, die einige Fehler der Vergangenheit vermeiden helfen sollen. Der Staat Louisiana hat die zahlreichen für den Flutschutz verantwortlichen Behörden reorganisiert und konsolidiert. Erneut hat man sich das bekannte «Nie wieder» zum Vorsatz genommen. Aber echter struktureller Wandel ist weder schnell noch gratis zu haben. Die Unfähigkeit der Behörden von Bund, Staat und Bezirk, ihr Handeln an die Veränderung der Umwelt anzupassen, ist die Erklärung für vieles, das wir heute im Gebiet sehen – gleiches Denken, gleiche Resultate.
Zukunft
Wenn wir die Geschichte der letzten vierzig Jahre betrachten, um die Zukunft des Flutschutzes im Grossraum New Orleans abzuschätzen, erscheint diese düster. Viele Fehler werden wiederholt. Wir lernen die vielen Lektionen von Betsy und Katrina nicht. Um es diesmal richtig zu machen, wäre wirkliches Engagement der Öffentlichkeit, der Industrie, der Regierung und des Ingenieurwesens gefragt. Erforderlich wären eine Vision, Führung, Kooperation und angemessene Ressourcen. Die Vision muss auf naturfreundliche und nachhaltige Flutschutzstrategien setzen. Dies beinhaltet zum Beispiel die Wiederherstellung und Wiederbelebung von natürlichen Sturm- und Flutbarrieren wie Sümpfen, Marschland und Flachwasserzonen. Dazu gehört aber auch, dass dem Wasser ein angemessener Raum überlassen wird und nur Gebiete besiedelt werden, die ausreichend geschützt werden können. Und dazu gehört schliesslich die richtige Anwendung fortgeschrittener und erprobter Flutschutz-Technologien. Doch eine solche einheitliche Vision scheint nicht in Sicht. Statt die Natur zum Verbündeten bei den Anstrengungen für einen langfristigen, nachhaltigen Flutschutz zu machen, kämpfen wir weiter gegen sie an. Unter diesen Umständen müssen wir mehr Katastrophen vom Typ Katrina erwarten. Es ist nur eine Frage der Zeit.
[Robert G. Bea, Ph.D., Professor am Institut für Bau- und Umweltingenieurwesen der Universität von Kalifornien in Berkeley]TEC21, Mo., 2008.07.07
07. Juli 2008 Robert G. Bea