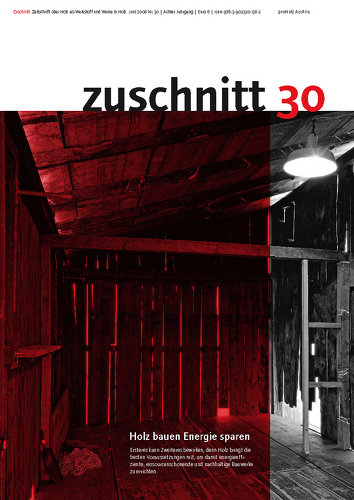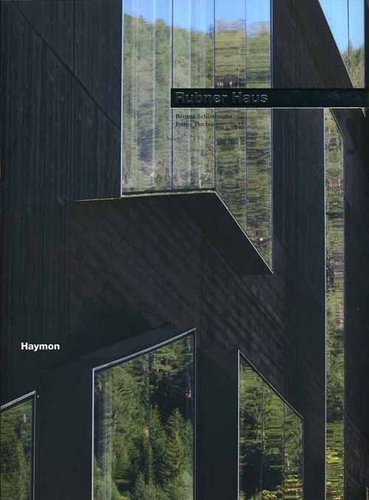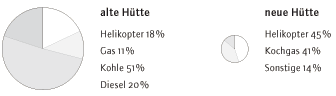Editorial
In Wirklichkeit ist es ein Fass ohne Boden. Sich dem Thema Energiesparen und Bauen zu nähern bedeutet, eine Tür zu öffnen, um in einen Raum zu gelangen, von dem aus sich unzählige weitere Türen öffnen lassen usw. Es ist ein Labyrinth aus Fakten und Zahlen, aus Erfahrung und Forschung, aber auch aus Vorurteilen und Missinterpretationen, aus Halbwahrheiten und Märchen.
Das alles noch dazu vor dem Hintergrund der weltweiten Diskussion über CO2-Ausstoß und Feinstaub, Klimawandel, Nachhaltigkeit und ob die Menschheit in fünfzig, hundert oder zweihundert Jahren zugrunde geht.
Als Einzelner fühlt man sich da hilflos, überfordert und nicht in der Lage abzuschätzen, wer recht hat, was sein wird und wie man reagieren soll. Begonnen hat alles in den 1970er Jahren. Zuerst wurden die scheinbar unendlichen Ölreserven knapp, bald darauf drängten sich Schlagworte wie Treibhauseffekt, Ozonloch, Saurer Regen und Waldsterben ins Bewusstsein. Inzwischen ist der Klimawandel in aller Munde, explodieren die Bevölkerungszahlen, gehen die förderbaren Vorräte an fossilen Energieträgern tatsächlich zur Neige und drängen die Schwellen- und Entwicklungsländer darauf, einen mit den Industriestaaten vergleichbaren Lebensstandard zu erreichen, der wiederum auf einer Steigerung des Energieverbrauchs basiert.
Mittlerweile ist man sich einig darüber, dass eine Energiewende, ein Wechsel von großteils fossilen zu erneuerbaren Energiequellen, à la longue zwingend ist. Es existieren Strategien und Alternativen, deren Umsetzung vieles verändern würde – je schneller, desto besser. Im Bauwesen – und nicht nur hier – sind technische Innovationen, Effizienzsteigerung und eine gesamtheitliche Sichtweise Schlüsselparameter, um Energie zu sparen. Dabei geht es nicht nur um Heizenergie, nicht nur um den Energieverbrauch, der anfällt, um ein Bauwerk entsprechend seiner Funktion komfortabel zu nutzen, sondern auch um jene Energie, die für Errichtung, Wartung und Instandhaltung, Adaptierung, für Abbruch und Entsorgung aufgewendet werden muss – also eine Lebenszyklusrechnung. Der Materialeinsatz für Gebäude ließe sich erheblich reduzieren. Leicht zu bauen bedeutet zugleich, energieschonend zu bauen. Bauwerke mit hoher Lebensdauer tragen wesentlich zum Energiesparen bei – dazu müssen sie jedoch auch einfach gewartet werden können und eine Nutzungsflexibilität aufweisen, die nachträgliche Änderungen erlaubt. Und warum gibt es keine Rücknahmeverpflichtung für Bauteile so wie für alte Batterien?
Wenn man alle Parameter berücksichtigt, ist es schon (oder besser: auch) heute wirtschaftlicher, energiesparend zu bauen und zu nutzen als »konventionell«. Man ist in der Lage, Häuser zu errichten, die nicht mehr Energie verbrauchen, als sie erzeugen – warum soll man dann noch auf Ölheizungen setzen? Die Energiepreise werden weiter steigen – warum soll man dann noch Einfamilienhäuser im Grünen bauen und auf das Auto angewiesen sein?
Energiebewusst zu bauen heißt auch, die Umweltbelastungen zu minimieren, und hier spielt nicht zuletzt die Materialwahl eine wesentliche Rolle. Dass »ökologische«, energiesparende Architektur etwas mit alternativen Lebensformen zu tun haben muss und dass ein Passivhaus schon von weitem als solches erkennbar ist (und damit sein Aussehen entschuldigt wird), sind längst überholte Vorurteile.
Für die Holzwirtschaft birgt die Entwicklung große Chancen, denn Holz als Baumaterial erfüllt eine Reihe von Voraussetzungen für energiesparendes Bauen und vieles, das damit zusammenhängt:
Großen Anteil am Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes verbraucht bereits die Herstellung des Baustoffs. Der dafür benötigte Primärenergieinhalt (PEI) führt die graue Energie an, die dafür notwendig ist, und unterscheidet zusätzlich zwischen der aufgewendeten erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energie. Hier schneiden nachwachsende Rohstoffe wie Holz besonders günstig ab. Alle Argumente, die für den Baustoff Holz sprechen, stehen in Verbindung mit diesem Sachverhalt bzw. mit den unmittelbaren Eigenschaften des Materials, die in Summe zu Energieeinsparungen führen:
Holz ist ein heimischer Rohstoff. Bei entsprechender Planung, können lange Transportwege vermieden und regionale Betriebe gestärkt werden. Holz dämmt, Holz speichert und Holz ist leicht – auch das führt zur Entlastung beim Transport –, im Verhältnis dazu jedoch extrem tragfähig. Das heißt, Holzbau verbraucht weniger Material und Platz. Bauteile aus Holz können im Werk vorgefertigt werden. Dadurch steigt die Verarbeitungsqualität und sinkt die Bauzeit – und damit auch der Energieverbrauch. Holzbauteile sind langlebig, wartungsarm und können vergleichsweise einfach ausgetauscht werden. Die daraus resultierende Flexibilität eines Bauwerks aus Holz trägt wiederum zu seiner Dauerhaftigkeit bei, da bei Nutzungsänderungen Adaptierungen möglich sind. Sie sind meist zerstörungsfrei trennbar und können wiederverwendet oder weiterverarbeitet werden. Wenn das Material schließlich thermisch entsorgt wird, dann wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie ursprünglich gespeichert wurde – daher nennt man Holz auch CO2-neutral. Diese Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, zusammenfassend kann man jedenfalls sagen: Wer mit Holz baut, spart Energie und im Energiesparen liegt die Zukunft.
Eva Guttmann