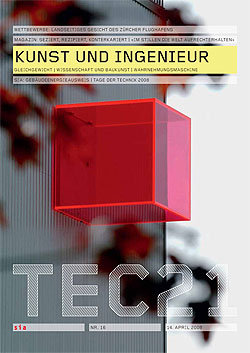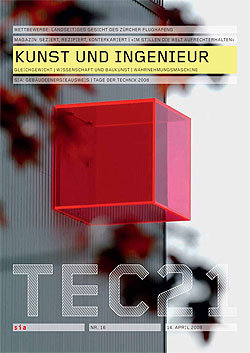Editorial
Es scheint überraschend, dass Ingenieure in der Kunst ihr berufliches Tätigkeitsfeld finden. Gelten sie doch oft als logisch denkende Rationalisten, die wenig kreativ sind und in der Planung von Bauwerken der Funktion mehr Gewicht zuordnen als der Ästhetik. So manche zeitgenössische Kunst kommt jedoch nicht mehr ohne Wissenschaft oder Technik aus. Dieser Bedarf öffnet (Bau-)Ingenieurinnen und -Ingenieuren eine spannende Tätigkeitsnische mit aussergewöhnlichen Herausforderungen. Ingenieure unterstützen die Künstler in der Umsetzung ihrer Ideen, indem sie technisches Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse in die Planung und die Ausführung einbringen. Ein Beispiel dafür gibt der Artikel ab Seite 22, worin die Zusammenarbeit zwischen dem Bauingenieur Peter Osterwalder und dem Künstler Jürg Altherr beschrieben wird. Die gemeinsame Umsetzung des Bauwerks führt zu einem Rationalisierungsprozess, der bereichernd und nützlich für beide ist.
Nicht alleine das Wissen der Ingenieure dient den Künstlern als Eingebungsquelle, sie lassen sich genauso von wissenschaftlichen Verfahren inspirieren. Oft bilden Modellversuche oder mathematische Algorithmen bei der Erarbeitung von Werken die Grundlage. «Wissenschaft und Baukunst» (Seite 26ff.) greift dieses Thema auf. Urs B. Roth beschreibt, wie er sich als «Geometrie-Ingenieur» mit einfachen Grundelementen auseinandersetzt und diese zu komplexen und repetitiven Ornamenten zusammensetzt. Mit abstrakter Mathematik als Werkzeug erstellt er grossflächige Muster, die dem Bedürfnis eines chaotischen Erscheinungsbildes entsprechen. Sein Ziel ist die vollständige und selbstverständliche Verflechtung von Wissenschaft und Baukunst.
Vereint wahrgenommen werden sollen Kunst und Wissenschaft in den Bauwerken des Künstlers Olafur Eliasson. Zusammen mit Ingenieuren und Architekten setzt er Projekte poetisch, aber doch greifbar um. In seinen künstlich hergestellten Naturphänomenen zeigt er die Konstruktionen. Er beabsichtigt dabei, speziell das Wahrnehmen wieder bewusst zu machen (Seite 31ff.).
Ingenieure werden hier in für sie ungewohnt poetische Prozesse involviert. Trotzdem arbeiten sie aber in einem überraschend vertrauten und zweckgebundenen Arbeitsumfeld, einer Verbindung von Kunst mit der mehrheitlich rationalen Arbeitsweise im Ingenieurbereich.
Clementine van Rooden
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Landseitiges Gesicht des Zürcher Flughafens
12 MAGAZIN
Seziert, rezipiert, konterkariert – Zürcher Raumkultur | «Im Stillen die Welt aufrechterhalten» | Verkehrsmittelführer des Schweizer Heimatschutzes | «Mais précisez!» – Rezension
22 GLEICHGEWICHT
Clementine van Rooden
Von Hand und mittels Modellen ermittelt Bauingenieur Peter Osterwalder die Kräfte in den Tragelementen der Kunstwerke von Jürg Altherr. Computerprogramme wären hier ineffizient.
26 WISSENSCHAFT UND BAUKUNST
Urs B. Roth
Der «Geometrie-Ingenieur» beschreibt einfache Grundelemente, die repetitive Ornamente bilden. Sie sollen nicht nur oberfl ächliches Dekor, sondern integraler Bestandteil eines Bauwerks sein.
31 WAHRNEHMUNGSMASCHINE
Lilian Pfaff
In Zusammenarbeit mit Architekten und Ingenieuren konstruiert Olafur Eliasson Kunstwerke, die das Wahrnehmen wieder bewusst machen sollen. Wissenschaft und Kunst ergänzen sich dabei.
37 SIA
Gebäudeenergieausweis | Tage der Technik 2008
38 PRODUKTE
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Gleichgewicht
Seit mehr als 30 Jahren arbeiten der Künstler Jürg Altherr und der Bauingenieur Peter Osterwalder zusammen an Kunstobjekten. Dabei quantifiziert der Ingenieur die Kräfte, die in den beweglichen Gleichgewichtssystemen des Künstlers wirken. Er bedient sich dabei nicht nur des leistungsstarken Computers, sondern in grossem Umfang auch der traditionellen Bemessungshilfsmittel. Dem Artikel liegt ein Gespräch mit Altherr und Osterwalder zu Grunde, in dem sie über realisierte und geplante Werke philosophierten.
Der Umgang mit der Baustatik und den statischen Bemessungen von Tragwerken hat sich über die letzten Jahrzehnte mit der Entwicklung der Rechenleistung der Computer stark verändert. Selten arbeiten Bauingenieure heute ohne Softwareprogramme. Auf der Grundlage der Finite-Elemente-Methode (FEM) erhalten die Anwender schnell alle Schnittkräfte und Verformungen von komplizierten statischen Systemen an beliebiger Stelle. Sie können komplexe Tragwerke innert nützlicher und wirtschaftlicher Frist dimensionieren. Früher quälten sich Bauingenieure beispielsweise tagelang mit der Dimensionierung einer Flachdecke. Sie mussten den realen Zustand abstrahieren und vereinfachen, damit sie überhaupt eine Bemessung vornehmen konnten. Flächentragwerke führte der Statiker auf lineare Systeme zurück und näherte sich sodann von Hand mit grafischen Methoden, iterativen Prozessen und dem Rechenschieber der Lösung. Oft kamen Modelle zum Einsatz, wodurch das Gesamtverständnis für die Konstruktion und deren Tragweise geschult wurde.
Diskretisierung
Nach wie vor stellt die Abstraktion von realen Zuständen in statische Systeme eine Hauptaufgabe des Ingenieurs dar. Die Flachdecke, um beim Beispiel zu bleiben, als hochkomplexes System ist jedoch kaum mehr als solches erkennbar, da der Computer den Rechenaufwand für die Ermittlung von aussagekräftigen Schnittkräften und Verformungen (es müssen zahlreiche Differenzialgleichungen gelöst werden) innerhalb sehr kurzer Zeit meistert. Mit der Fokussierung auf die massgeblichen Punkte hält man die Resultatmenge in Grenzen und reduziert somit den Interpretationsaufwand der Datenmenge. Varianten sind dann tatsächlich innerhalb nützlicher Frist studiert und Anpassungen rasch berücksichtigt. «Den Softwarehilfsmitteln gewinne ich durchaus etwas Positives ab», so Bauingenieur Peter Osterwalder, der über 35 Jahre ein eigenes Büro geführt hat. Für den täglichen Gebrauch, insbesondere bei komplizierten und schwierigen Tragsystemen, sei der leistungsfähige Computer für den Statiker eine enorme Erleichterung. Es sei möglich, immer komplexere Systeme wirklichkeitsnah zu erfassen und zu realisieren. Häufig greifen laut Osterwalder die Statiker heute aber zu rasch zu Statikprogrammen. Sie nähmen sich oft zu wenig Zeit, sich konzeptionell über das Tragwerk und den Kräftefl uss Gedanken zu machen, bevor sie die Daten des zu berechnenden Systems in die Masken des Programms eingeben. Während früher eine nicht dauernd kontrollierte Rechnung normalerweise falsch war, betrachte man heute die Computerresultate oft als unfehlbar.
FE-Berechnungen basieren auf Annahmen und Vereinfachungen, die bei der Anwendung unbedingt berücksichtigt werden müssen und die der Statiker als Voraussetzung für die Interpretation der Resultate kennen muss. Nähert sich das Rechenverfahren asymptotisch von der unsicheren Seite der Lösung? Die Eingabe des Tragsystems und der Belastung mit Hilfe einer grafischen Benutzeroberfl äche setzt somit eine hohe technische Kompetenz voraus. Einschlägige Literatur [1] weisst darauf hin, dass ein gesundes Misstrauen gegenüber den ermittelten Resultaten stets angebracht sei. So stellen zum Beispiel Betonplattenelemente nur ein numerisches Modell einer realen Platte dar. In die Elementsätze gehen Annahmen bezüglich des Dehnungszustandes und der Verformungsfreiheitsgrade ein. Daraus folgt, dass das Programm Normalspannungen in der Plattenmittelebene, die beispielsweise aus behinderten Verformungen entstehen können, nicht darstellen kann. Gerade aus solchen und analogen Gründen ist die Handrechnung nach «traditioneller» Art neben dem Computereinsatz immer noch notwendig, ebenso natürlich die Kontrolle auf zweitem Weg.
Konkretisierung
Der schnelle Griff zum Computer, bemerkt Osterwalder, wäre bei aussergewöhnlichen Projekten, die in sich beweglich sind und grosse Verformungen aufweisen, inneffizient, unwirtschaftlich, ja gar gefährlich. Für diese sehr schlanken Systeme müssen Stabilitätsprobleme oder komplizierte Seilstatik gelöst werden. Dafür seien die üblichen und alltäglich verwendeteten Statikprogramme nicht geeignet. Es werde deshalb meist zuerst versucht, die Kräfte «von Hand» abzuschätzen und die grossen, durchaus erwünschten Bewegungen der Seilwerke an Modellen zu veranschaulichen. Teilweise ermittelt man die Grösse der Kräfte direkt mittels dieser Modelle. Die Kunstwerke von Jürg Altherr (TEC21 6/2008, Artikel «Schwerter und Seile») gehören zu diesen komplexen Tragsystemen. Osterwalder geht darum mit traditioneller Handarbeit an die Bemessung der Tragsysteme heran. Viel Gespür für den Kräftefl uss und Neugier für die realisierbare Lösung sind für die Umsetzung not - wendig. Jürg Altherr war zu Beginn der Zusammenarbeit überrascht: «Ich erhielt keine wissenschaftlichen Erklärungen über das Wesen der Kräfte, sondern nur über das Funktionieren der Kräftebeziehungen.» Die Kunstobjekte, die Altherr umfassend und bezeichnenderweise als «Organisation der Leere» bezeichnet, setzen sich aus Pendelstützen und Drahtseilen zusammen. Diese Bezeichnung sei zwar in sich ein Widerspruch, meint der Künstler, dieser Name beschreibe aber, was die Tragwerke im Raum bewirken und wie sie ihn für die Benutzer erlebbar machen. Um diesen Zwischenraum zu definieren und zu realisieren, brauche es sowohl ihn als Künstler als auch den Bauingenieur, der die auftretenden Kräfte «lothartauglich» und ästhetisch überzeugend quantifiziert, ohne dabei das Konzept des Künstlers zu zerstören.
Die Durchführbarkeit stand nie grundlegend zur Diskussion, meinen der Künstler und der Bauingenieur einstimmig – die Art und Weise, das System zu beherrschen, war das Entscheidende. Dabei ist der Rationalisierungsprozess, der bei jedem Kunstwerk diskutiert wird, für Altherr eine wertvolle Bereicherung und gleichzeitig eine Steigerung der Komplexität und Aussagekraft. Das System vereinfache sich und erhalte eine klare Präsenz, wodurch die Kunst – der Zwischenbereich – mehr Raum einnehme. Gleichzeitig erhalten die Projekte durch Osterwalders Einfl uss die nötige Sicherheit. Die Ähnlichkeit zur Zusammenarbeit von Bauingenieuren mit Architekten ist offensichtlich – nur die Zweckgebundenheit der Architektur unterscheidet sie hier von der Kunst.
Schnittmenge zweier Disziplinen
Durch den Dialog zweier Fachdisziplinen entsteht etwas Drittes. Diesen Aspekt nimmt Altherr in seinen Arbeiten auf. Dabei ist die Statik die Sprache des Kunstwerks und übernimmt damit die verbindende Ebene der Disziplinen. Neben der klaren Lesbarkeit der Statik haben die Kunstwerke eine sinnliche Ebene, die jede Person anders erlebt. Die Skulptur auf dem Waffenplatz Frauenfeld (Bild 4), die Altherr für sich «Verhängnis» nennt, von den Benutzern aber «Bedrohung» genannt wird, wirkte auf die Rekruten sowohl erstaunlich (kein Nutzen für den Soldaten – also sinnlos) als auch gefährlich (unter hängenden Lasten lauert der Tod). Viel einfacher und klarer noch wirkt das Tragwerk «Equilibre» in Biel (Bild 1). Das höchst simpel erscheinende Seiltragwerk ist de facto relativ komplex. Das System ist wegen der geometrischen Anordnung der Druck- und Zugelemente und der Spannung im Seil stabil, nicht aber wegen der Wirkung der Schwerkraft. Das Seil wird von den Fundamenten her gespannt. Altherr sucht eine weitere Möglichkeit, dieser Skulptur sein bewegliches Gleichgewicht zu geben: Aus der Kunst soll eine Brücke werden (Bild 2). Als solche ist das System dann sehr wohl von der Schwerkraft abhängig: Das Gewicht der Gehwegplatte bringt die notwendige Seilspannung in das System. Altherr entfernt sich mit diesem Brückenprojekt aus dem Kunstbereich hinein in die Zweckgebundenheit. Für Osterwalder stellt sich eine weitere schwierige Frage: Die Brücke bewegt sich unter der Belastung der Fussgänger. Wie sie trotzdem sicher und ohne beängstigende Schwingungen realisiert werden kann, ist offen. Er meint: «Auch die Lösung dieser Aufgabe stellt eine neue Herausforderung dar.» Aktuell beschäftigt sich das Team ausserdem mit einer Skulptur in Hueb bei Wald (Bild 3). Ab Frühling 2009 soll eine Pendelstütze mit angehängten Seilen ihr bewegtes Gleichgewicht finden und den neu gestalteten Aussenraum der dann umgebauten Weberei definieren. Die Seile sollen dabei genügend schwer sein, sodass sie durch die Belastung nie voll gespannt werden, gleichzeitig aber so leicht, dass sie filigran wirken und als Tragelemente nicht viel Raum einnehmen.TEC21, Mo., 2008.04.14
Literatur
[1] Anwendung der FE-Methode im Betonbau – Fehlerquellen und ihre Vermeidung.
2. Auflage, Ernst & Sohn
14. April 2008 Clementine Hegner-van Rooden
Wissenschaft und Baukunst
In der morgenländischen Baukunst haben geometrische Muster eine reiche Tradition, in der Schweizer Architekturszene schwinden seit einigen Jahren die Berührungsängste gegenüber dem Ornament. Ein «Geometrie-Ingenieur» plädiert für kunstvolle Variation statt monotone Wiederholung.
Geometrie als Kunstform hat es im europäischen Kontext schwer. Zwar schwärmen Tausende von Touristen jährlich nach Andalusien, bewundern die Mosaike der Alhambra und die raffinierten Gewölbe der Moschee von Cordoba; doch das neu erwachte Interesse am Ornament steht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum bescheidenen Wissen über den Aufbau dieser Werke. Geometrische Muster sind und bleiben eine fremde Welt, und so erstaunt es nicht, dass ein bescheidenes additives Dreieckmuster an der Eingangshalle eines Museums für aussereuropäische Kunst in unseren Breitengraden schon zum Medienereignis wird. Die Meister aus Granada und Isfahan hätten für diese Simplizität nur ein müdes Lächeln übrig.
Nach dem endgültigen Verschwinden des Loos’schen Ornamentsverbots scheint in der Architektur geradezu ein Durst auf Muster aufzukommen. Und so wird fleissig – und gedankenlos – appliziert: Moderne digitale Techniken machen die Sache relativ einfach. Leider aber sind Werke, in denen geometrische Ordnungen nicht nur als oberflächlicher Dekor eingesetzt werden, sondern integraler Bestandteil des Bauwerks sind, bis anhin eher rar. Zwei solche Projekte, die in Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron entstanden sind, sollen im Folgenden vorgestellt werden.
Mathematischer Hintergrund
Hinter jedem Ornament mit Wiederholungen steckt mathematisch gesprochen eine kongruente Abbildung: Ein Bestandteil des Ornaments wird durch Parallelverschiebung, Drehung, Spiegelung oder Gleitspiegelung mit seinem Gegenstück zur Deckung gebracht. Grünbaum und Shepard haben die mathematischen Grundlagen dieses Gebietes umfassend dargestellt.[1] Alle hier gezeigten Studien behandeln das Thema des «tiling» der Ebene, das heisst: der gesetzmässigen und lückenlosen Aufteilung der Ebene mittels weniger standardisierter Grundelemente. Diese Grundelemente sind zumeist sehr einfach geformte Polygone. Die Komplexität steckt also nicht in den Teilen selbst, sondern in deren Anordnung. In diesem Gebiet ist die Mathematik noch längst nicht zu Ende geschrieben; es gibt immer wieder Raum für neue, unerwartet komplexe Strukturen. Eine soll am Ende des Artikels vorgestellt werden. Vorweg sollen jedoch drei wichtige Kategorien von ebenen Flächenteilungen erläutert werden.
1. Die periodische Flächenteilung: Die überwiegende Zahl aller repetitiven Ornamente – darunter auch sämtliche Stoffdrucke – fallen in diese Kategorie (Bild 1). Ihr Kennzeichen ist der Rapport (RP), jener kleinste Abschnitt im Rechteck, der durch Parallelverschiebung das gesamte Muster erzeugt. Enthält der Rapport seinerseits Symmetrien, so gibt es eine noch kleinere Einheit, eine Art Stammzelle (SZ) des Musters. Sie enthält die gesamte Information des Musters; es sind aber weitere kongruente Abbildungen notwendig, um es daraus zu generieren. Das Beispiel zeigt eine erste Abwandlung eines Motivs des römischen Bodenmusters, das im 18. Jahrhundert bei Buchs ZH gefunden wurde.
2. Die aperiodische Flächenteilung generiert ein Muster, das nie durch eine Parallelverschiebung mit sich selbst zur Deckung gebracht werden kann. Die Lage jedes Teils ist bis zur Unendlichkeit festgelegt. Das Muster beruht auf dem Prinzip der Selbstähnlichkeit: Jedes Teil kann fortlaufend in kleinere Bestandteile seiner selbst unterteilt werden. Bild 2 zeigt das wohl berühmteste aperiodische Muster: «Darts & Kites» von Roger Penrose (1973). Gelb markiert sind entsprechende Teile der 1. und der 4. Generation. 2007 haben Peter J. Lu und Paul J. Steinhardt solche komplexen Geometrien an mittelalterlichen Bauwerken des Vorderen Orients nachgewiesen. [2]
3. Die quasichaotische Flächenteilung: Es handelt sich um eine eigene Schöpfung des Schreibenden (Bild 3). Auch dieses Muster ist nichtperiodisch: Es besteht aus wenigen Grundbestandteilen, deren Anordnung nicht von vornherein festgelegt ist und lokal verändert werden kann. Das quasichaotische Pattern beruht auf einer versteckten periodischen Ordnung eines lateralsymmetrischen Grundteils, das wahlweise rechts- oder linkshändig eingesetzt werden kann. Im gezeigten Beispiel ist diese Stammzelle ein mit einem rechtwinkligen Muster belegtes Drachenviereck. Dem sichtbaren Muster aus drei Quadraten und einem Rechteck liegt also eine völlig anders geartete unsichtbare Geometrie zugrunde. [3]
„Astor Place“ für Ian Schrager Hotels, New York
Herzog & de Meuron beschäftigte 2001 ein kniffliges Geometrieproblem. In Zusammenarbeit mit Rem Koolhaas / OMA entwickelten sie einen kleineren Hotelturm in Manhattan. In der Vision der Architekten war das Gebäude eine Art poröser Stein, der keine Regelmässigkeit erkennen lassen sollte. Aus Kostengründen war aber klar, dass die tragende Fassade aus standardisierten Betonelementen aufgebaut werden sollte – anscheinend ein Widerspruch. Die Frage lautete nun: Gibt es geometrische Ordnungen aus Standardelementen, die trotzdem den Eindruck von Zufall und Chaos hinterlassen? Die Suche nach diesem «wohlorganisierten Chaos» – Chaos natürlich nicht im mathematischen Sinne – führte zu einer Struktur aus sechs verschiedenen Teilen (Bild 4). Auch hier wurde das Prinzip der quasichaotischen Flächenteilung angewandt.4 Im Gegensatz zur aperiodischen Flächenteilung kann dieses Pattern lokal angepasst werden: Derselbe Umriss kann auf verschiedene Arten mit den Standardteilen gefüllt werden. Das Gebäude wurde leider nicht realisiert (Bild 5).
„Shaikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan“-Moschee in Abu Dhabi
Bei dieser zweiten Aufgabe aus dem Büro Herzog & de Meuron war das Objekt der Studie eine riesige, von einem ortsansässigen Architekten geplante Moschee. Als der Rohbau schon sehr weit gediehen war, wurde offensichtlich, dass das Projekt schwerwiegende funktionale und gestalterische Mängel aufwies. Herzog & de Meuron erhielten daraufhin den Auftrag, Massnahmen für die Rettung des Baus vorzuschlagen. Ein Problem stellte ausgerechnet der Hauptraum dar: eine Gebetshalle für 6000 Gläubige. Er ist durch 24 massive Stützenbündel geprägt, die drei leicht verschieden grosse Kuppeln tragen. Diese Stützen stehen beliebig im Raum und kommen auch der Forderung nach regelmässigen Gebetsplätzen in die Quere. Herzog & de Meuron schlugen eine radikale Lösung vor: Könnte man die Kuppeln nicht neu abfangen? Ein regelmässiger Stützenwald – analog zur Moschee in Cordoba – gäbe dem Gebetsraum die nötige Regularität und Ruhe. In der Höhe würden sich die Stützen verzweigen und die Last der schon gebauten Kuppeln übernehmen (Bild 6). Der Bauherr lehnte jedoch ab: Die Stützen sollten da bleiben, wo sie sind. Die neue Fragestellung bezog sich auf die Geomerie: Gäbe es eine geometrische Ordnung, die im Nachhinein die seltsame Stützenstellung sinnvoll einbinden könnte? Mit Herzog & de Meuron wurde eine klare Arbeitsteilung vereinbart: Ich übernahm die Aufgabe des «Geometrie-Ingenieurs», sie übersetzten die entstandenen geometrischen Ordnungen in architektonische Elemente. Zwei unterschiedliche Lösungsansätze sollen im Folgenden vorgestellt werden:
1. Polygons: Es handelt sich um ein Puzzle aus zwei gleichschenkligen Dreiecken. Die Kombinationen dieser zwei Elemente ergeben eine riesige Vielfalt an Unterformen; die Teile sind aber auch dazu geeignet, eine gerade Raumbegrenzung zu bilden. Interessant ist das lateralsymmetrische Sechseck als Basis der Viererstützen: Es ist ein echtes Loch im Gewebe, das sich nicht mit Standardteilen füllen liesse. Insgesamt handelt es sich hier nicht um eine systematische, sondern um eine Art Ad-hoc-Lösung – das Resultat endlosen Probierens (Bild 7).
2. Lines: Der systematische Ansatz: Könnten die 24 Stützenbündel in eine reguläre, unendlich fortsetzbare Struktur eingebunden werden? In eine Art weltumspannendes Gewebe, wie es in der Idee der «Umma der Gläubigen» repräsentiert ist? Der Ansatz ist äusserst anspruchsvoll. Entstanden ist die symmetrische Überlagerung zweier kongruenter, um 45° gedrehter rechtwinkliger Gitter. Für den Mathematiker ist sofort klar, dass eine solche Überlagerung zu einer aperiodischen Struktur führen muss.[4] In diesem Gitter sind rhythmische Abfolgen zweier Abstände abzulesen: auch hier ein Rhythmus ohne Wiederholungen. Die Integration der Stützenbündel in dieses symmetrische Geflecht ist allerdings nur teilweise geglückt (Bild 8). Eine nachträgliche Analyse der Studie brachte Erstaunliches zutage: Zerlegt man dieses unendlich fortsetzbare Linienmuster in seine Elementarteile, so findet man ein Hintergrundpattern aus 4 Elementen: Quadrat, Drachenviereck, Sechseck und reguläres Achteck. Wieder kommt das Prinzip der Selbstähnlichkeit zum Zuge (Bild 9). Interessant ist die Anordnung der Sechsecke: Sie bilden geschlossene fraktale Ringe. Diese Struktur ist nicht eine Erfindung des Schreibenden, sondern ein mathematisches Gebilde, das per se existiert.[5] Leider ist auch dieses spannende Projekt schon früh abgebrochen worden. Ungewiss bleibt, was Herzog & de Meuron aus diesen geometrischen Ordnungen entwickelt hätten. Sicher ist, dass Abu Dhabi das geeignete kulturelle Umfeld für die Kunst der Geometrie gewesen wäre!
Ausblick
Alle hier vorgestellten geometrischen Ordnungen gehen vom Prinzip des Standardelements aus. Ist dieses Denken überhaupt noch zeitgemäss? Neue, digital gesteuerte Herstellungsverfahren ermöglichen die Produktion individuell geformter Teile zu durchaus vertretbaren Kosten; so ist das berühmte «Vogelnest»-Stadion von Herzog & de Meuron in Peking aus nicht standardisierten Teilen zusammengesetzt worden. Diese Debatte sollte jedoch nicht nur nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien geführt werden. Die herrlichen Bauten des Orients könnten vielleicht die Augen öffnen für das riesige Potenzial, das in komplexen Anordnungen von ganz einfachen Grundelementen steckt. Was dort beeindruckt, ist die vollständige und selbstverständliche Verschränkung von Wissenschaft und Baukunst. In unserem kulturellen Kontext ist die Situation eine ganz andere: Mathematiker und Gestalter leben offenbar auf verschiedenen Planeten. Sollte das Interesse an komplexen geometrischen Strukturen im Bauen anhalten, wäre es jedoch wichtig, dass wieder neue Brücken geschlagen würden. Es wäre wünschenswert, dass in Zukunft der Mathematiker in der Funktion des «Geometrie-Ingenieurs» ganz selbstverständlich zum Bauteam gehören könnte.
[Urs B. Roth, dipl. Architekt ETH / SIA, Atelier für Konkrete Kunst in Zürich]TEC21, Mo., 2008.04.14
Anmerkungen
[1] Branko Grünbaum, G. C. Shepard: Tilings and Patterns. W. H. Freeman and Company, New York 1987. Dies ist das Standardwerk zur Geometrie der regulären Flächenteilungen
[2] Peter J. Lu und Paul J. Steinhardt: Decagonal and Quasi-Crystalline Tilings in Medieval Islamic Architecture, in: Science 315, 2007. An mittelalterlichen Bauwerken aus Iran, Irak, Indien und der Türkei analysieren die Autoren Patterns mit pentagonalen und dekagonalen aperiodischen Strukturen. Das Geometrieverständnis der orientalischen Meister des 12. bis 16. Jahrhunderts ist höchst beeindruckend
[3] Die Elemente des Patterns sind Quadrate mit den Seitenlängen 1, 2 und 3 und ein Rechteck mit den Seitenlängen 2 × 3. Der dargestellte kleine Ausschnitt des Patterns umfasst 36 Drachenvierecke. Es gäbe demnach 236 (= ca 7 × 1010) verschiedene Anordnungen der Rechtecke in diesem Feld
[4] Grundmodul ist hier ein lateralsymmetrisches Fünfeck. Jedes Einzelteil kann im Pattern in acht verschiedenen Lagen erscheinen. Das ist der Grund, weshalb die versteckte (periodische) Ordnung kaum zu erkennen ist
[5] Für mathematisch Interessierte: Eine Überlagerung zweier um 45° gedrehter kongruenter Strukturen zu einer Gesamtstruktur mit repetitiven Elementen muss zwangsläufi g zu einer aperiodischen Struktur führen. Grund ist der Winkel von 22.5° des Symmetrieteils, dessen Kotangens eine irrationale Zahl ist. Dieser Wert, f = √2 + 1, ist auch der Skalierungsfaktor der Selbstähnlichkeit. Interessant ist die Anordnung der Sechsecke. Sie bilden geschlossene fraktale Ringe von 8, 16, 56, 160, 488, 1456 etc. Elementen. Analog zu «Darts & Kites» von Roger Penrose hat die Struktur ein Symmetriezentrum. Es ist der Schnittpunkt von 8 Symmetrieachsen. Die Struktur entwickelt sich alternierend in 2 Varianten: mit Achteck oder 8 Drachenvierecken im Zentrum
14. April 2008 Urs B. Roth