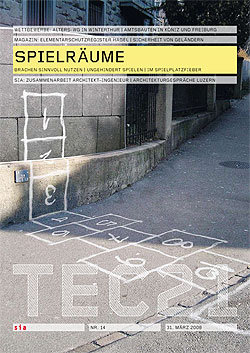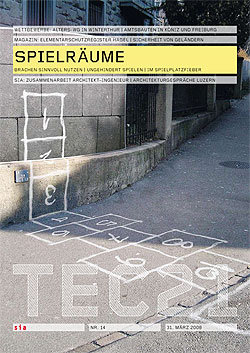Editorial
Kinderspielplätze erscheinen oft als ein notwendiges Übel, welches das schweizerische Baugesetz beim Bau von Mehrfamilienhäusern vorschreibt. «Kindgerechte Spielplätze an geeigneter Lage» sollen eingerichtet werden. Doch was ist eine geeignete Lage? Für die Eltern sicherlich immer der Ort, an dem sie ihre Kinder vom Küchenfenster aus beim Spielen beobachten können. Für die Kinder ist es der Platz, an dem sie ganz sicher kein Erwachsener sieht. Und für die lärmempfi ndlichen Nachbarn ist es am ehesten ein Bereich weitab von allen schallrefl ektierenden Objekten und noch sehr viel weiter weg von ihrer eigenen Terrasse. Doch auch die Lage abseits des Strassenverkehrs ist bei der Standortwahl entscheidend.
Es ist also eine schwierige Aufgabe, diese verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Die Planenden der drei hier gezeigten Projekte haben neue Ansätze gesucht und gefunden. Zum einen werden Brachland- und Baustellenspielplätze vorgestellt, eine Initiative, die in der Schweiz im Berner Raum ihren Anfang nahm. Denn warum sollen brachliegende Flächen nicht genutzt werden dürfen? Weil sie gefährlich sind, schlecht einsehbar und riesengross. Genau das reizt Kinder. Ein Verein nahm sich dieses Themas an und entwickelte ein Konzept, wie diese Flächen temporär für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Beim Spielplatzprojekt Hardau in Zürich entwickelten die Kinder aus dem Quartier gemeinsam mit Spielplatzbauern und Landschaftsarchitekten ein Konzept für einen Dschungelspielplatz. Die Zusammenarbeit von Kindern und Fachplanern wurde von einer städtischen Stelle koordiniert.
Auch die Kinder, die im Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn im Kanton Zug leben, konnten einen Spielplatzneubau miterleben. Der «Sensorische Garten», der auf die speziellen Bedürfnisse geistig und körperlich behinderter Kinder eingeht, wurde im Sommer 2006 fertiggestellt. Im neuen Freiraum können sich die Kinder abseits von Schul- und Therapiezimmern spielerisch mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Zudem ist dieser neu gestaltete Spielraum so attraktiv, dass auch Kinder aus der Umgebung hier spielen und damit das Schulgelände besser in die Umgebung integriert wird. Die neuen Ansätze für Spielplatzgestaltungen können dazu beitragen, dass auch wir Erwachsenen neue Spielräume kennen lernen und in unserem Alltag nicht nur tolerieren, sondern auch nutzen und fördern.
Katinka Corts
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Alters-WG in Winterthur | Arealüberbauung Liebefeld in Köniz | Verkehrsamt in Freiburg
10 MAGAZIN
Elementarschutzregister Hagel | Anonymes Wohnen erspart Konflikte | Sicherheit von Geländern
18 BRACHEN SINNVOLL NUTZEN
Sabine Gresch, Martin Beutler, Sabine Schärrer, Sabine Tschäppeler
Brachliegende Flächen müssen nicht gesperrt sein. Ein Verein setzt sich dafür ein, dass diese Areale von der Öffentlichkeit genutzt werden können.
22 UNGEHINDERT SPIELEN
Katinka Corts
Der «Sensorische Garten» im Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn wird zum Spiel- und Lernraum.
28 IM SPIELPLATZFIEBER
Barbara Käser
Wenn Kinder ihren Spielplatz mitplanen dürfen, entstehen überraschende und neuartige Projekte – wie der Dschungelspielplatz im Zürcher Quartier Hardau.
34 SIA
Zusammenarbeit Architekt–Ingenieur | Architekturgespräche Luzern | Frau Net
36 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Brachen sinnvoll nutzen
Können Teile von Brachen oder Baustellen durch die Quartierbevölkerung genutzt werden, führt dies zu einer spannenden, wenn auch temporären Erweiterung und Bereicherung des Freiraumangebotes. Denn Brachfl ächen bieten etwas, was kein Fussballplatz, kein Spielplatz, keine Parkanlage bieten kann: die Möglichkeit zu ganz ursprünglicher Kreativität.
«The bee dreams up the flower and the flower dreams up the bee.» Aldous Huxleys Metapher veranschaulicht das Entstehen dessen, was wir gemeinhin «die Realität» nennen: das Zusammenspiel der Realitäten jedes Einzelnen. Dieses poetische Bild wird sofort bedeutend fassbarer, nimmt man dazu z. B. die Hauptbeschäftigung von Buben in ihrem Wohnumfeld: das Fussballspielen. Ein Fussballspiel entsteht nicht wegen eines Fussballplatzes. Ein Fussballspiel entsteht, wenn mindestens zwei Buben mit einem Ball zwei Steine zu einem Tor, den einen Buben zum Torwart und den anderen zum Stürmer erklären. Ebenso entstehen Ritterburgen, Puppenstuben, Indianerdörfer, Feuerstellen und Wildpfl anzengärten – eines nach dem anderen oder alles gleichzeitig. Brachliegende Flächen sind nutzungsoffene Freiräume. Fahren auf der Brache die Baumaschinen auf, schaffen sie meist wiederum Brachfl ächen: Aushubmaterial wird abgelagert, Oberboden wird vor Ort deponiert, Sand- und Kieslager werden angelegt, auf angrenzendem Grünland wird die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben. Im Gegensatz zu manchem Spielplatz oder Park geben Brachen nichts vor, schränken nicht ein. Die Räume auf Zeit erlauben es den verschiedensten Gruppen, ihre Interpretation des Ortes zu leben, ihn sich zwischenzeitlich anzueignen und sich damit zu identifi zieren.
Naturraum Brachfläche
Typische Brachfl ächen sind kiesige, stark besonnte, trockene Böden, auf denen auch seltene, gefährdete Pfl anzenarten wachsen. Einige dieser seltenen Arten fühlen sich natürlicherweise auf den Kiesbänken in Auenlandschaften heimisch. Heute, da die hiesigen Gewässer weitgehend gebändigt sind, ist ihr natürlicher Lebensraum grösstenteils verloren gegangen. Städtische Brachfl ächen sind für diese Arten eine temporäre Ersatzheimat geworden. Es liegt hier zwar kein Flusskies, dafür Wandkies oder Bauschutt. Nicht Hochund Niederwasser sorgen für ständige Dynamik, sondern zum Beispiel Baumaschinen, die den Boden umschichten. So werden Brach- und Ruderalfl ächen in Siedlungsgebieten zu Refugien für seltene Pfl anzenarten. Brachfl ächen tragen dazu bei, dass diese Arten erhalten bleiben und sich sogar auf nahe gelegene Brachen ausbreiten können. Der Verein Brachland hat sich zum Ziel gesetzt, solche Brachfl ächen der Bevölkerung zugänglich zu machen. Entstanden ist die Idee bei der Zwischennutzung einer ehemaligen Kiesgrube im Berner Weissensteinquartier. Das Areal war mehrere Hektaren gross und grenzte an ein Wohnquartier. Die «Grube» wurde während Jahren vom Quartier zwischengenutzt – zum Ostereiersuchen, für Bocciarunden, Schlafen im Freien, Kunstausstellungen und für Konzerte. Nach diesem Vorbild konnte der Verein Brachland seit 2005 in Bern bereits einige Zwischennutzungen von Brachen und Baustellen initiieren und begleiten.
Verein Brachland als Kommunikationsplattform
Mitten durch das stadtbernische Naherholungsgebiet Studerstein baut der Kanton derzeit den Neufeldtunnel. Bereits vor Baubeginn wurde die gerodete Waldpartie u. a. als BMX-Piste zwischengenutzt. Diese Waldschneisen-Zwischennutzung konnte bei Baubeginn nahtlos in einen Baustellenspielplatz übergeführt werden: Die 10 Meter hohen Aushubhalden stehen zu Ruhezeiten der Baustelle abends und an den Wochenenden der Quartierbevölkerung zur Verfügung. Gleich angrenzend an die Bauabschrankung konnte zudem ein «Baustellenspielplatz miniature» eingerichtet werden. Hier haben die Kinder aus dem Quartier ein Paradies aus Sand, Kies, Steinen und Holz in Beschlag genommen. Nach der Fertigstellung der Hauptbaustelle werden die Kies- und die Sandhügel wieder abgetragen, und das Gelände wird rekultiviert. Auf der Grossbaustelle Brünnen bietet eine Brachfl äche Freiraum für das Gäbelbach- Quartier und hat dabei gleichzeitig eine interkulturelle Dimension: Während im Gäbelbach- Quartier viele MigrantInnen wohnen, wird das neu entstehende Brünnen-Quartier eher Wohnraum für Wohlsituierte bieten. Das Brachlandprojekt Brünnen bietet Raum für Begegnung zwischen den bereits Ansässigen und den neuen QuartierbewohnerInnen. Wo – wie im Beispiel Brünnen – neue Siedlungen oder Stadtquartiere entstehen, ist die Begeisterung der bereits Ansässigen erfahrungsgemäss klein. Sie beklagen die verlorenen Freiraumqualitäten und die versperrte Aussicht, sie beschweren sich über Baulärm und -staub. Werden Brachen oder Baustellen zugänglich gemacht, eröffnet sich für Eigentümer oder Bauherrschaften die Möglichkeit zum aktiven Dialog mit der Nachbarschaft. Im Unterschied zu anderen kommunikativen Massnahmen binden diese Projekte wichtige Anspruchsgruppen eines Bauprojekts mit ein und bieten ihnen einen direkt erlebbaren und nachhaltig wirkenden Mehrwert.
Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit
Was die ökologische Nachhaltigkeit von Bauprojekten anbelangt, existieren bereits etablierte Systeme. So sind Partikelfi lter, Baustoffrecycling oder die Minimierung der Transportwege heute Teil jeder professionell geführten Baustelle. Die Nutzung von Brachen eröffnet dazu eine weitere Perspektive: Als Ort der Begegnung zwischen den bereits Ansässigen und den neu zuziehenden QuartierbewohnerInnen, als Ort der Bewegung und des Spiels gewährleisten sie einen aktiven Beitrag der Bauherrschaft zur gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Zwar ist es in manchen Fällen aus Sicherheitsgründen notwendig und sinnvoll, Brachfl ächen oder Baustellen abzuzäunen. Dennoch gibt es auf den meisten Arealen Bereiche, die der Öffentlichkeit ohne besondere Risiken zugänglich gemacht werden können. Sogenannte «Brachen-Ordnungen», die auf Hinweistafeln im Gelände stehen, vermitteln den NutzerInnen die zu beachtenden Regeln. Mit einem kleinen Aufwand können die entstehenden Risiken sogar versichert werden. Sowohl auf Seiten der NutzerInnen (z.B. Quartierverein) als auch auf Seiten der Bauherrschaft besteht die Möglichkeit, eine Betriebshaftpfl ichtversicherung abzuschliessen oder bestehende Policen auf die Brachlandnutzung auszudehnen. Mit seinem Versicherungspartner hat der Verein Brachland errechnet, dass Mehrkosten von ungefähr 150 Franken je Brachfl ächenprojekt und Jahr entstehen. Das Wissen um die zeitliche Begrenztheit einer Situation nimmt die Schwellenangst der hohen Verbindlichkeit. In einem von der Natur inspirierten Prozess muss auch wieder Neuem Platz gemacht werden. Was bleibt, sind Erfahrungen und kollektive Erinnerungen, Fäden eines Netzes, an dem die QuartierbewohnerInnen selber weiterknüpfen können.
[ Sabine Gresch, Geografin, Landschaftsplanerin bei naturaqua pbk, Bern. Martin Beutler, Kulturmanager, Inhaber der Firma für soziale Plastik. Sabine Schärrer, Architektin, Vereinigung für Beratung, Integrationshilfe und Gemeinwesenarbeit. Sabine Tschäppeler, Biologin, Stadtgärtnerei Bern, Verantwortliche für Natur und Ökologie ]TEC21, Mo., 2008.03.31
31. März 2008 Sabine Gresch, Martin Beutler, Sabine Schärrer, Sabine Tschäppeler
Ungehindert spielen
Im Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn wurde 2006 ein grosser Spielplatz errichtet, der auf die speziellen Bedürfnisse körperlich und geistig behinderter Kinder zugeschnitten ist. Das Ziel der Planer war, einen Spielraum für alle Kinder zu schaffen – ganz egal für welches Alter und für welchen Grad der Behinderung.
Heilpädagogen und Lehrer wissen, dass die Bewegung im dreidimensionalen Raum auch die Bereiche im Gehirn schult, die für das Lernen extrem wichtig sind.1 Diese Erkenntnisse sollten auch in das Neubaukonzept für den Spielplatz in Hagendorn mit einfl iessen. Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn (HZH) liegt etwas abseits der Kantonsstrasse nach Cham und Zug, inmitten von Landwirtschaftsfl ächen und in der Nähe eines Wäldchens. Zur Anlage gehören ein Schulhaus, ein Mehrzweckbau mit Turnhalle und drei Internatsgebäude. Dazwischen gibt es einen Pausenplatz, unterhalb der Wohngebäude liegt eine grosse Grünanlage, in der sich der neue Spielplatz befi ndet (Bild 7). In der Ganztagsschule leben und lernen Kinder aus dem Kanton Zug und angrenzenden Kantonen. Sie haben sehr unterschiedliche Behinderungen, was eine einheitliche Lösung bei der Neuplanung des Spielplatzes unmöglich machte. Manche Kinder können zum Beispiel zwei Sprachen sprechen, sind aber in der Motorik gestört und brauchen Hilfe beim Essen. Andere sind körperlich nicht behindert, sind aber im frühpubertären Alter noch auf dem geistigen Niveau eines Kleinkindes.
Der Spielplatz als Lehrraum
Im Sommer 2004 stellte das HZH sein Unterrichtskonzept um. Die Kleinklassen wurden auf vier Lerngruppen mit je 12–16 SchülerInnen verteilt. Jeweils drei bis vier Pädagogen be - treuen die Gruppen über den ganzen Tag. Seit der Umstellung des Unterrichtskonzeptes werden auch die Pausen als Unterrichtszeiten angesehen, in denen zum Beispiel die Sen - sorik geschult wird. Der neue Aussenraum sollte demnach nicht nur Spielplatz, sondern auch Lernraum sein. Die Betreuenden konnten so die Pausen frei gestalten und deren Län - gen selbst festlegen, sie sollten die Kinder aber in dieser Zeit in eine Umgebung führen, in der ihre Aktivität angeregt wird. Auf dem Spielplatz sollen den Kindern Aufgaben gestellt werden, die sie dort lösen. Da die Kinder, die im Internat leben, den Spielplatz auch nach dem Unterricht nutzen, sollte er leicht verständlich und ohne Betreuer nutzbar sein. Bei der Erarbeitung des neuen Spielplatzkonzeptes wurden die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Heilpädagogen befragt, wie den Bedürfnissen der Schüler auf dem Spielplatz entsprochen werden könnte. Die Spielsachen sollten nach ihrer Auskunft selbsterklärend sein und keine grosse Anleitung durch die Betreuer bedingen. Zur Vorbereitung des Projektes sollten die Betreuenden die Kinder beim Spielen auf dem alten Platz beobachten. Dabei stellte sich heraus, dass die Kinder sich besonders gern mit Spielgeräten beschäftigen, die ihre Motorik fordern – also zum Beispiel Schaukeln und Wippen. Da auf dem künftigen Spielplatz ein Teil des Unterrichts abgehalten werden sollte, gaben auch die LehrerInnen ihre Wünsche zur Gestaltung an. Daniela Saxer vom Architekturbüro Raum B Architekten entwickelte nach diesen Vorgaben ein Konzept für die gesamte Schulanlage und erweiterte anschliessend das Planerteam. Gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro Appert & Zwahlen aus Cham und der Baarer Künstlerin Johanna Naef planten die Architekten das Projekt und setzten es ab 2005 um.
Dosierte Gefahren auf dem Weg
Der neue Spielplatz unterteilt sich in drei Bereiche: eine gekieste Fläche, einen Sandkasten und einen Pavillon. Ein Merkmal der Anlage ist, dass es den Kindern nicht zu einfachgemacht wird, an jede beliebige Stelle des Spielplatzes zu gelangen. Der Weg zu Spielplatz und Schwimmbad sollte nicht einfach durchgehend asphaltiert werden, sondern auch bezwingbare Hindernisse und «Abenteuerwege» enthalten. Die oberste Prämisse der Planenden war: je kürzer der Weg, desto grösser muss die Herausforderung für die Kinder sein. Beispiele dafür sind ein Riffelblechboden mit minimalen, für Rollstuhlfahrer aber überwindbaren Stufen und Gitterroste, die über den Sandkasten führen. Einer der Roste ist stabil, der andere gelenkig fi xiert. Hier ist die Motorik der Kinder gefordert, denn auf dem wackelnden Steg will das Gleichgewicht gehalten werden. Zwischen der ersten und der zweiten Ebene liegt ein Wackelsteg, die zweite ist mit der dritten über eine wippende und kippende Brücke verbunden. Diese kippt und schaukelt beim Begehen und Befahren mit Rollstuhl und Fahrrad. Beim Pavillon schliesslich wählte die Architektin einen weichen Sportplatzbelag, der durch seine Höhe von 11 cm sehr stark federt. Die verschiedenen Lauf- und Fahrerlebnisse machen bereits den Gang zum Spielplatz zum Abenteuer.
Alle Sinne fordern
Über den Asphaltweg gelangen die Kinder zuerst in den Kiesbereich. Sie haben hier eine Fläche, die mit Kies, nicht bindigem Sand und grossen Steinen bedeckt ist. Besonders ihre taktile Wahrnehmung schulen sie beim Spiel. Einige Kinder nehmen wegen ihrer Behinderung nur wenig über ihre Haut wahr. In Kies und Sand können sie sich gefahrlos eingraben, die Materialien wahrnehmen und die Wärme oder die Kälte der Steine spüren. Für diesen Bereich entwickelte Johanna Naef Liegen aus Kunststoff, auf die sich die Kinder alleine oder mit Hilfe legen können. So erreichen sie den Boden und können bäuchlings im Sand spielen. Der Sandkasten im zweiten Bereich ist mit bindigem Sand gefüllt – ideal zum Burgenbauen und Matschen. Auch die Kinder im Rollstuhl können diesen Bereich befahren und an einem Matschtisch auf einer Betonplattform ohne die Hilfe anderer spielen (Bild 4). Als Besonderheit wurde ein erhöht liegender Pavillon errichtet. Kinder, die im Rollstuhl sitzen, können ihre Umgebung nur selten von einem erhöhten Standpunkt aus wahrnehmen. Auf dem Spielplatz haben sie aber diese Möglichkeit. Der Pavillon ist für Rollstuhlfahrer über eine Rampe zu erreichen, nicht gehbehinderte Kinder können ihn auch über eine Kletterwand, ein Netz oder einen schmalen Kamin – ein Metallrohr mit Sprossen – erklimmen (Bilder 2 und 3). Das Holztragwerk, geplant von Bauingenieur Walter Bieler aus Bonaduz, ergänzte in spielerischer Weise einen Stützenwald unter der Rampe. Die schräg angeordneten Pendelstützen stabilisieren die Rampe und bilden gleichzeitig einen Spielraum für die Kinder (Bilder und Pläne Seiten 26 und 27). Rückwärtig schliesst der Bau mit einer fl acheren Rampe für die Rollstuhlfahrer an den Pausenplatz an. Von diesem gelangen die nicht gehbehinderten Kinder auch direkt zum Spielplatz, müssen dazu aber eine Röhrenrutschbahn nutzen und auf dem Rückweg über grosse Steine klettern. Hier wird erneut der Vorsatz der Planer deutlich: kurze Wege müssen schwieriger gestaltet sein und eine Herausforderung darstellen. Birken und Föhren schliessen den Spielplatz gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung ab. Strauchrosen setzen farbliche Akzente. Neu gepfl anzt wurden unter anderem Haselnuss- und Holundersträucher, die für die Kinder nicht nur in der Blütezeit interessant sind. Neben der optischen, akustischen, olfaktorischen und taktilen Wahrnehmung sind auch die Entwicklung des Gleichgewichtssinns und der Muskelkraft für ein Kind wichtig. Wenn die Kinder im Herbst die Beeren und Nüsse sammeln, trainieren sie ihre taktile Wahrnehmung und lernen, wie sie ihre Kraft dosieren müssen, um die Beeren nicht zu zerdrücken. Wollen die Kinder hingegen die Früchte der Erdbeeren erreichen, müssen sie sich auf den Boden knien, wobei sie für sie unübliche Bewegungsabläufe üben.
Neugestaltung von Pausenplatz und Mehrzweckraum
Die Betreuenden und die Kinder haben die neue Aussenraumgestaltung mittlerweile gut angenommen. Die Kinder sehen den Spielplatz auch als Aufgabe an, die es zu lösen gilt. Sie beschäftigen sich oft stundenlang mit einem Hindernis, bis sie es überwinden könnenDie Betreuenden verbieten den Kindern nichts, sie sollen ihre eigenen Erfahrungen im Ge - lände machen und ihre Grenzen selbst kennenlernen. Nach diesen positiven Erfahrungen will die Schulleitung des Heilpädagogischen Zentrums Hagendorn nun auch weitere Berei - che des Geländes umgestalten. Sie hat Daniela Saxer mit der Aufgabe betraut, ein Gestaltungskonzept für den zurzeit unattraktiven und verstellten Pausenplatz zu entwickeln. Hier sollen die Rabatten entfernt werden und so ein Platz zum Velofahren und Herumrennen entstehen. Ausserdem sollen der Mehrzweckraum generell saniert, die Raumfolge darin optimiert und die Zwischenräume mit spielerischen Komponenten versehen werden.
Öffnung zur Aussenwelt
Die Klassengrösse wird in Zukunft wohl eher abnehmen, da die Kinder schneller in Integrationsklassen öffentlicher Schulen aufgenommen werden sollen. Die Plätze im Internat hingegen werden nach wie vor gefragt sein, und damit wird auch die attraktive Gestaltung des Wohn- und Lernumfeldes ein Thema bleiben. «Behinderte wurden früher abgeschoben und ihre Einrichtungen abseits der Städte gebaut», so Saxer. Den Kontakt zur Aussenwelt könne das Heilpädagogische Zentrum heute wieder verstärken, indem es sein Gelände und seine Einrichtungen für Fachleute und Schulklassen öffnet. In den Mehrzweck- und Schulungsräumen sollen zum Beispiel Fachhochschulen Kurse, Weiterbildungen und Informationsabende durchführen. Das Interesse an einer Anlaufstelle für Personen aus der Praxis besteht. Andere Schulklassen sind eingeladen, den Spielplatz gemeinsam mit den Kindern des HZH zu nutzen. Das Angebot stösst auf Interesse, mittlerweile reisen auch Regelkindergärten und Schulklassen aus der Umgebung für einen Besuchstag an. Katinka CortsTEC21, Mo., 2008.03.31
31. März 2008 Katinka Corts-Münzner