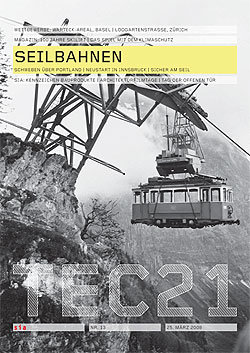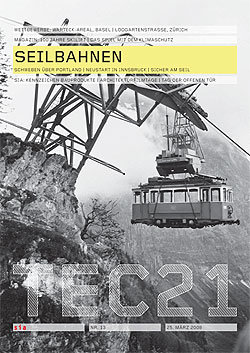Editorial
Mit der Eröffnung des Wetterhorn-Aufzugs bei Grindelwald am 27. Juli 1908 begann die Erschliessung der Schweizer Alpen durch Luftseilbahnen. Seither dienen Schwebebahnen in der Schweiz fast ausschliesslich touristischen Zwecken oder der Erschliessung schwer zugänglicher Siedlungen und technischer Anlagen im Gebirge. Eine prominente Ausnahme war die während der Landesausstellung 1939 in Zürich betriebene, nachher demontierte Pendel-Schwebebahn über das Seebecken. Seither sind in Schweizer Städten keine bedeutenden Personentransport-Schwebebahnen mehr erstellt worden. Zwischen Lausanne, Lugano und Zürich erfüllen Standseilbahnen und Zahnradbahnen städtische Transportaufgaben, wenn auf kurzen Distanzen grosse Höhenunterschiede zu überwinden sind. In zahlreichen anderen Ländern hingegen befördern Schwebebahnen seit Beginn des 20. Jahrhunderts die zunehmenden städtischen Fussgängermassen über Hindernisse aller Art.
Ein aktuelles Beispiel einer modernen, effi zienten und architektonisch ansprechenden Seilbahn in einer Grossstadt wird im ersten Fachartikel vorgestellt. Die im vergangenen Jahr eröffnete «Aerial Tram» in Portland (Oregon) glänzt nicht mit technischen Rekorden, demonstriert aber eindrücklich, wie Personenverkehrsprobleme in urbaner Umgebung mit Schwebebahnen elegant gelöst werden. Auch hierzulande können Schwebebahnen, wie die in Zürich als Zubringer zum Zoo geplante Seilbahnverbindung, attraktive Alternativen für den städtischen Personentransport sein.
Fast ein halbes Jahrhundert älter als die Luftseilbahnen sind die behäbigeren Standseilbahnen. Sie begannen ihren Werdegang als innerstädtisches Verkehrsmittel und wurden in der Belle Époque, zunächst als Zubringer zu erhöht gelegenen Hotels, zu Motoren der touristischen Erschliessung der Alpen. Ohne die ersten Standseilbahnen wäre die Entwicklung traditioneller Ferienorte wie St. Moritz oder Davos wohl anders verlaufen. Eines der bedeutendsten frühen Wintersportzentren im Alpenraum ist Innsbruck, wo der touristische Aufschwung mit der 1906 eröffneten Hungerburg-Standseilbahn begann. Die in die Jahre gekommene Anlage wurde kürzlich durch eine neue Standseilbahn mit verlängerter Linienführung ersetzt. Dass dabei nicht einfach eine neue Bahn gebaut, sondern mit spektakulärer Architektur ein städtisches Wahrzeichen geschaffen werden sollte, wird in «Neustart in Innsbruck» kritisch gewürdigt. Viele Fahrgäste fühlen sich nicht richtig wohl, wenn sie nicht auf solidem Boden stehen oder fahren, sondern in der Luft schweben. Ähnlich wie Flugzeuge werden auch Luftseilbahnen und insbesondere Sesselbahnen als gefährliche Verkehrsmittel empfunden. Ob dieser subjektive Eindruck statistisch begründet ist und wo sicherheitstechnische Verbesserungen möglich sind, geht aus dem dritten Fachartikel hervor.
Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Hoch hinaus – Warteck-Areal Basel | Holz, Stein, Metall – Wohn- und Beschäftigungsstätten für geistig Behinderte, Zürich
12 MAGAZIN
100 Jahre Skilift | Nicht schutzwürdig: Sesselbahn Kandersteg – Oeschinensee | Das Spiel mit dem Klimaschutz
18 SCHWEBEN ÜBER PORTLAND
Francesco Kleeblatt
Eine neue Luftseilbahn verbindet zwei Standorte der Universität von Portland (USA). Die Pendelbahn gefällt auch durch ihre Architektur, insbesondere bei der auf engem Raum aufgestelzten Bergstation.
24 NEUSTART IN INNSBRUCK
Eva-Maria Froschauer
Mit neu angelegtem, teilweise unterirdischem Trassee und spektakulär gestalteten Stationen als Publikumsmagnet ersetzt die neue Hungerburgbahn die hundertjährige erste Standseilbahn.
29 SICHER AM SEIL
Gàbor Oplatka
Die Analyse der Unfallstatistik zeigt, wo bei Seilbahnen Unfallschwerpunkte bestehen und was für präventive Massnahmen dagegen ergriffen werden können.
34 SIA
Preisänderungen im Baubereich | Zweite Reise nach Hamburg | Architekturfi lmtage | BGI und TEC21 im Dialog | Tag der offenen Tür
37 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Schweben über Portland
Die Oregon Health and Sciences University liegt an einem Hang über dem Stadtzentrum von Portland, ihre Erweiterung soll am Willamette River realisiert werden. Zwischen den beiden Standorten liegen historische Stadtteile, ein unter Schutz stehender Park und grosse Verkehrsachsen. Die Stadtverwaltung beschloss, die Verbindung mit einer Seilbahn zu gewährleisten. Den 2003 ausgeschriebenen internationalen Architekturwettbewerb gewannen agps architecture (Zürich / Los Angeles), Ende 2007 ging die Anlage – die zweite innerstädtische Seilbahnverbindung in den USA – in Betrieb.
Susan Anderson, Leiterin des Office of Sustainable Development (OSD) in Portland, fasste unlängst in prägnante Worte, was die bevölkerungsreichste Stadt des Bundesstaats Oregon von anderen US-amerikanischen Metropolen unterscheidet: «New York has its financial district. Los Angeles has freeways. Las Vegas has gambling. And Portland has sustainability. » Jeweils 100 Kilometer vom Pazifik im Westen und der Bergkette der Cascade Range im Osten entfernt zeichnet sich die Stadt mit ihren 560 000 Einwohnerinnen und Einwohnern durch eine landschaftlich attraktive Lage aus: Sie liegt in dem von Hügeln umgebenen Tal des Willamette River, der im Norden in den Columbia River mündet. Gewiss zählt Portland nicht zu den touristischen Hotspots der Vereinigten Staaten, doch Anderson spricht von «one of the most vibrant cities in the U.S.».
Weitsichtige Stadtverwaltung
Diese Aussage mag vielleicht einem gewissen Lokalpatriotismus geschuldet sein, doch wer die Stadt zum ersten Mal besucht, ist tatsächlich überrascht. In der Downtown fahren erstaunlich wenige Autos, und das nicht etwa, weil die Innenstadt wie andere urbane Zentren des Landes verödet wäre – im Gegenteil. In Portland rollen Trams, die kostenlos benutzt werden können, durch die Strassen, und so viele Fahrräder wie hier glaubt man selten in den USA gesehen zu haben. Tatsächlich erhielt die Stadt 2006 den Rang der «number one bicycling city», und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel hat sich seit 1990 beinahe verdoppelt.
Dass sich die Stadtverwaltung mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzt, geht auf die 1970er-Jahre zurück. Damals wurde eine «urban growth boundary» festgelegt, um die Ausdehnung der Stadt in die Fläche zu verhindern und die – zum Teil landwirtschaftlich genutzten – Freilandreserven jenseits der Stadtgrenze zu bewahren. Der Kampf gegen die Suburbanisierung hatte einen willkommenen Nebeneffekt: Er führte in Portland selbst zu einer Bevölkerungsdichte, die es ermöglichte, sukzessive ein effizientes öffentliches Nahverkehrssystem aufzubauen. Weitere Programme festigten Portlands Ruf als ökologische Modellstadt der USA: Dazu zählte die Sanierung der Flussläufe, aber auch die Stärkung des öffentlichen Verkehrs durch ein restriktives Parkplatzmanagement und der Verzicht auf den Ausbau der Highways in den Wohnquartieren. Aktiv begann man überdies in den 1990er- Jahren mit der Bekämpfung der Treibhausgase. Während landesweit die CO2-Emissionen seit 1990 um 16 % gestiegen sind, strebt man in Portland einen Wert an, der den von 1990 um 10 % unterschreitet. Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld ist ein nachhaltiges «grünes» Bauen, das besonders durch das OSD gefördert wird.
Mit der Seilbahn auf den «pill hill»
Einer der neuesten Bausteine des öffentlichen Verkehrssystems ist die Ende Januar 2007 offiziell eingeweihte Luftseilbahn, die vom Stadtentwicklungsprojekt des South Waterfront District, der südlich der Downtown auf einem flussnahen Areal realisiert wird, auf den Marquam Hill führt. Hier befindet sich, 150 Meter über dem Talboden, der Hauptcampus derOregon Health and Science University (OHSU). 1917 wurden erste medizinische Bauten auf dem «Pill Hill» errichtet, doch sind diese in einem ständig sich verdichtenden Konglomerat aus Bettenhäusern und Behandlungstrakten, Labors und Forschungsinstituten aufgegangen. Verbunden durch Lifttürme und Passerellen, staffelt sich die labyrinthisch anmutende Krankenhausstadt den Hang empor. Weil auf dem angestammten Standort kein Platz mehr vorhanden war, suchte die Leitung der OHSU nach einem Erweiterungsgelände. Ein geeignetes Areal fand man 2001 mit dem South Waterfront District. Er ist zwar nur einen Kilometer Luftlinie in östlicher Richtung entfernt, lässt sich aber auf bestehenden Strassen nur über einen mehr als drei Kilometer langen Umweg erreichen. Dafür verantwortlich sind der Geländesprung ebenso wie die Trasse des Interstate Highway 5, die am Hangfuss entlang führt und auf der Fahrt überquert werden muss.
Eine schnelle Verbindung zwischen Hauptcampus und Erweiterungsareal war für die Klinikleitung jedoch eine wesentliche Bedingung – anderenfalls hatte man gar mit einem völligen Neubau ausserhalb von Portland gedroht. Und selbstverständlich stiess die Idee einer leistungsfähigen ÖV-Verbindung von OHSU und South Waterfront District bei der Stadtverwaltung auf Gegenliebe, weil sie sich in das Nahverkehrskonzept einfügte. Zunächst wurden die möglichen Verkehrsmittel evaluiert: Dabei zeigte sich eine Luftseilbahn den übrigen Optionen – Pendelbusse, Tunnel oder Standseilbahn – deutlich überlegen. Die einzige innerstädtische Seilbahnverbindung in den USA war bislang das Roosevelt Island Tram in New York. In einem Architekturwettbewerb des Jahres 2003 unter vier eingeladenen Teilnehmern konnte sich am Ende das Büro agps aus Zürich und Los Angeles durchsetzen. Die Aufgabe umfasste nicht nur den Entwurf der Berg- und der Talstation, sondern auch die Gestaltung des Mittelmastes und der Kabinen.
Kein Platz mehr für die Bergstation
Neben der Strassenbahnhaltestelle im South Waterfront District, von dem aus die Innenstadt in wenigen Minuten erreichbar ist, steht die neue Talstation (Bilder 4 und 5). Über dem im Untergeschoss liegenden Antriebsraum, der die Elektromotoren und die Notstromaggegrate beherbergt, ist das Gebäude als luftiger, zu seiner Umgebung hin offener Pavillon konzipiert. Ein Stahlbetonskelett bildet die Grundstruktur, auf der eine Stahlrahmenstruktur aufliegt. Wie mit einem Überwurf, der aber nicht den Erdboden berührt, ist diese Konstruktion mit einem transluzenten Stahlgitternetz verkleidet. Dieses erlaubt den schemenhaften Einblick ins Innere ebenso wie von dort aus den Ausblick auf die Umgebung. Das kräftige Rot, das die Benutzer im Abfertigungsbereich umgibt, verstärkt als Signalfarbe den konstruktivistischen Charakter des Gebäudes.
Die Fahrt geht zunächst steil bergan – der 60 Meter hohe, mit Stahlblech verkleidete Zwischenmast erlaubt es, den Highway in ausreichender Höhe zu überqueren – und führtund Formensprache folgen den schon im Tal prägenden Gestaltungsprinzipien, also der Verbindung aus Stahlbetonskelett, körperhaften Einbauten in Primärfarben – hier ergänzt um Gelb und Blau – und einer transparenten Hülle als Flächenkomposition aus Gitterelementen. Doch aufgrund der speziellen topografischen Situation ist hier eine atemberaubende, waghalsig anmutende architektonische Struktur entstanden: Weil in dem völlig zugebauten Klinikareal buchstäblich nicht einmal für eine Seilbahnstation Platz war, wurde das kleine Gebäude gleichsam in der Luft errichtet. Man erreicht die als Plattform auskragende Abfertigungs- und Einstiegsebene durch den Erdgeschossbereich eines Klinikgebäudes; in die Tiefe wird die Last durch einen Liftschacht, der die Parkhäuser im Tal mit den Krankenhausbauten verbindet, und vier scheinbar zufällig wie ein Arrangement aus Mikadostäben wirkende Betonstützen abgetragen. Die bizarre, höchst expressive Konstruktion zeigt, welche Mühe es bedeutete, das neue Gebäude mit dem Untergrund zu verzahnen, wobei erschwerend die Tatsache hinzukam, dass Spitalgebäude und Seilbahn aufgrund möglicher Vibrationen statisch voneinander getrennt werden mussten.
Lang ersehnter architektonischer Höhepunkt
Für die Kabinen selbst, die jeweils 78 Personen fassen, wählten agps eine Form, die als Reaktion auf die Einsprachen von Anwohnern unterhalb der Seilbahntrasse visuell nicht zu dominant sein durfte. So sind es silbergraue «bubbles floating through the sky», wie die Architekten es formulieren. Zwei Gondeln im gegenläufigen Betrieb hängen an jeweils zwei Seilen und werden von einem Antriebsseil bewegt. Die Antriebsscheibe befindet sich in der Talstation, während ein Gegengewicht in der Bergstation die Last der Seile und Kabinen kompensiert.
Drei Minuten dauert die Fahrt hinauf oder hinunter. Für die Fahrgäste bieten sich eindrucksvolle Blicke über Downtown Portland, über das Tal des Willamette River und bei gutem Wetter sogar auf den schon im Bundesstaat Washington gelegenen Mt. Rainier, den höchsten Berg der Cascade Range. Nicht zuletzt rücken aber auch die Seilbahnbauten ins Gesichtsfeld, welche die jüngste architektonische Attraktion der Stadt darstellen. Bei allem berechtigten Lob der «green city»: Qualitativ hochstehende Architektur ist in der Stadt seit dem von Charles Jencks zur Ikone der Postmoderne erhobenen «Portland Building» (1980–82) von Charles Moore nämlich nicht mehr entstanden.TEC21, Di., 2008.03.25
25. März 2008 Francesco Kleeblatt
Neustart in Innsbruck
Nach der 2002 eröffneten Bergiselschanze hat Zaha Hadid 2004 bis 2007 gleich mehrere neue Bauten in Innsbruck realisiert. Die neue Hungerburgbahn mit ihren abenteuerlich geschwungenen Stationen bietet ein architektonisches Spektakel, das – so das Kalkül der Auftraggeber – die Rentabilität der gesamten Anlage inklusive ihrer historischen Teile verbessern soll. Zum Erlebnis trägt ein eigens entwickeltes Fahrzeug bei, das als U-Bahn losfährt und als Standseilbahn weiterrollt.
Ganz am Anfang, als noch keine Chance auf Realisierung zu bestehen schien, hat Zaha Hadids Architektursprache für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile sind die fliessenden, gebrochenen, schwebenden, verdichteten, verdrehten, zerpixelten oder verworfenen Räume konsensfähig geworden. Ihre realisierten Projekte erzeugen ein breites publizistisches Echo insbesondere in Publikumsmedien, die sie als längst fällige Erneuerung in der Architektur begrüssen. Dies war auch der Fall bei den vier Stationsbauten, die Zaha Hadid Ende 2007 für die Hungerburgbahn in Innsbruck fertig gestellt hat. In Bezug auf die doppelt gekurvten Glasflächen betonte die Architektin auch selbst, dass die Grenzen des derzeit Machbaren ausgereizt seien. Dennoch sind die Neubauten – trotz ihrer formalen Eigenständigkeit – Teil einer hundertjährigen Geschichte, deren vorläufig letztes Kapitel sie darstellen und in deren Kontext sie betrachtet werden müssen.
Herausragende Ingenieurleistungen ...
Die Erschliessung des Bergterrains nördlich der Tiroler Landeshauptstadt, der Hanglagen der Nordkette, ist auch eine Geschichte herausragender technischer Neuerungen. Der erste bauliche Eingriff datiert in die Pionierphase des Seilbahnbaus um 1900 zurück, als Standund Seilschwebebahnen für den «Bequemalpinismus» interessant wurden – versprachen sie doch, dem Transportaufkommen des neuen Sommer- wie Wintersportinteresses gewachsen zu sein. Der Wirtschaftsfaktor, der im Ausbau des neuen Verkehrsmittels lag, wurde von weitsichtigen Geschäftsleuten rasch erkannt. Die Initiatoren für die Erschliessung der Hungerburg, einer privilegiert über Innsbruck liegenden Siedlungs- und Erholungsterrasse, waren ein Tourismuspionier sowie ein Eisenbahningenieur und Bauunternehmer. Als 1906 die erste Hungerburgbahn – eine Standseilbahn – nach nur sieben Monaten Bauzeit eröffnet wurde, galt sie als beeindruckendes Projekt. Die Flussquerung über den Inn wurde mit einem kühnen, noch heute bestehenden Eisenbrückentragwerk gelöst, das Stampfbetonviadukt im weiteren Trassenverlauf galt als technische Meisterleistung.
Doch war dieser Bahnabschnitt, die Sektion I, nur der Auftakt zu einer fulminanten Eroberungsgeschichte der Innsbrucker Bergwelt: Bald nach Eröffnung der Bahn wurde bereits ein Ausbau erwogen, der allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg – nun als Seilschwebebahn – realisiert werden konnte (1927 / 28). Die Sektion II und III dieser Nordkettenbahn entwickelten sich rasch zu beliebten Ausflugszielen. Der Reiz lag in der unmittelbaren Nähe zur Stadt: Bei der Bahnfahrt liess sich der Gegensatz zwischen urbaner Kulturlandschaft und «unschuldiger » Bergwelt besonders pointiert erleben.
... und moderne Ar chitektur
Hinzu kam die raffinierte Qualität der heute denkmalgeschützten Stationshochbauten, die der Innsbrucker Architekt Franz Baumann nach einem Wettbewerb unter den damals besten Baukünstlern der Tiroler Zwischenkriegsmoderne errichtete (Bilder 1–3). Weitere Seilbahnstationen, die etwa zeitgleich in Tirol und Vorarlberg entstanden, haben dazu beigetragen, den baukünstlerischen Status des damals noch jungen Bautypus festzulegen. Dennoch kommt der Nordkettenbahn eine Sonderstellung zu: Ihre Übersetzung technischer rungen in kraftvolle architektonische Aussagen, ihre Eleganz bei der Bewältigung der topografischen Herausforderung blieben unübertroffen. Sie trug dazu bei, dass das Bauen im Alpenraum – allerdings nur für kurze Zeit – sowohl auf beschönigend-heimatverliebtes Gebaren als auch auf vermeintlich traditionelle Formen verzichtete. Die monumentale Kraft des «neuen tirolischen Geistes» ist bis heute spürbar.
Die drei Baumann’schen Stationen auf der Hungerburg, der Seegrube und dem Hafelekar sind 2004 bis 2006 denkmalgerecht saniert und im Interesse der Kapazitätssteigerung vorsichtig erweitert worden. Die für die Umbauten verantwortlichen Architekten Schlögl & Süss aus Innsbruck fanden schlichte und pragmatische Lösungen, die den Bahnbetrieb fliessender und für mehr Fahrgäste durchgängiger machen. Dabei wurden alte Raumkonzeptionen wiederhergestellt und Neuerungen wie Selbstbedienungstheken oder vergrösserte Warteräume und Kassenanlagen geschickt eingefügt. Beim Entwurf der Innenausstattung hatte sich Baumann in jedes Detail vertieft; Beleuchtungskörper und Türdrücker waren Teil eines Ausstattungsprogramms, das – die lokale Holzbautradition verfremdend – den Anschluss an internationale neue Strömungen suchte. Die kraftvollen Stühle und Tische tun bis heute ihren Dienst, als hätte der Entwerfer vorausgeahnt, welche Robustheit die künftigen Skischuhtrampeleien in Seilbahnrestaurationen erfordern würden.
Alte und neue Konflikte
Der Bergbahnbau, dessen Ingenieurleistungen einst als Sieg über die Natur gefeiert wurden, barg immer auch soziale Spannungen. In seinem Theaterstück «Die Bergbahn» (1929) stilisierte der österreichische Schriftsteller Ödön von Horváth den Bau einer Bahn zum Feld der Ausbeutung, bei der nichts dem Sieg, dem Ziel, dem grossen technischen Menschenwerk entgegenstehen konnte. Auch in der Gegenwart verlaufen Seilbahnbauten nicht immer ganz konfliktfrei; allerdings haben sich die Auseinandersetzungen in Umweltausschüsse und Gemeinderäte verlagert. Und noch eine Eigenschaft dieser Bauaufgabe hat sich bis heute erhalten: Sie ermöglicht – bezogen auf die notwendige Technik – ein überproportional hohes Erleben, denn jede Fahrt wird zum kleinen Gipfelsieg.
Dass dabei Selbstüberhebung und Absturz selten ausbleiben, zeigt die fortgesetzte Geschichte der Hungerburg- und Nordkettenbahnen. Was wurde nicht alles überlegt, um die Nordkette anziehend zu halten: ein Hotelbau auf der Seegrube, ein Höhenflugplatz oder die Erschliessung neuer Gebiete für den Wintersport. Die jüngste Entwicklung war eher ein Abstieg, unter anderem, weil sich das Gebiet auf Grund seiner steilen Kare nie wirklich zu einem grossen Skigebiet ausbauen liess. Die kostspielige Rettung der zwischenzeitlich privatisierten, dann wieder städtischen Anlagen kam von Seiten einer Public-Privat-Partnership. Deren Partner, die Stadt und die Firma Strabag AG, spielten nach einer weitgehend verdeckt durchgeführten Ausschreibung im Jahr 2004 die Trumpfkarte Zaha Hadid aus. Zwar regte sich anfangs Widerstand gegen das Projekt; unter anderem wehrte sich eine Bürgerinitiative gegen die Ausmusterung der alten Hungerburgbahn, deren Innbrücke und Viadukt nun zwar unter Denkmalschutz, aber ungenutzt stehen. Doch schliesslich einigte man sich in der Hoffnung, das visuelle Spektakel der Neubauten, die näher an die Altstadt gerückte Talstation, die neue Trassenführung und die höhere Transportleistungen würden die Bahn wieder rentabel machen.
Eigens entwickeltes Fahrzeug
Anfangs wurde eine grosse Umbaulösung bis zum Hafelekar erwogen; sie wurde jedoch zugunsten der oben beschriebenen denkmalgerechten Sanierung der Sektion II und III wieder aufgegeben. Für Sektion I sollten jedoch alle Register des Neuen gezogen werden. Die Einstiegsstelle liegt nun in fussläufiger Nähe zur Altstadt, zur Hofburg und somit zu den Zentren des Tourismus; schade, dass sie sich in einer seltsam anmutenden Konstellation an das bestehende Kongresshaus drängt. Von hier bis zur nächsten neuen Haltestelle, der nach einer anliegenden Gaststätte benannten Station Löwenhaus, wird die neue Hungerburgbahn als U-Bahn geführt. Danach quert sie mit freier Sicht den Inn. Zu diesem Zweck wurde eine Schrägseilbrücke entworfen, die weit weniger elegant ist als das hundertjährigeVorgängermodell: Zwei gekippte Pylonen tragen den Fahrtrog der Bahn, wobei die Konstruktion den Anschein erweckt, als hätte sie anstelle der periodisch pendelnden Fahrzeuge ungeheure Frequenzen zu bewältigen (Bild 7). In wechselweise ober- und unterirdischer Fahrt erreicht der Fahrgast die Haltestelle Alpenzoo, mit der eine Anbindung an den beliebten Tierpark gelingt. Die Fahrt zur Bergstation Hungerburg (Bilder 5 und 6) hinauf bietet gute Sicht auf die sich immer mehr entfernende Talsohle. Oben öffnet sich eine bemerkenswerte Aussicht, wenige Schritte weiter befindet sich die Talstation der weiterführenden Baumann-Bahn. Bezogen auf das Fahrvergnügen liegt der Neuigkeitswert der Hungerburgbahn im mehrmaligen Auf- und Abtauchen, in der Dramatisierung des kinematischen Erlebens, das jeden Bergbahnfahrenden begleitet. Für diese wechselvolle Trassenführung wurde ein Fahrzeug eigens entwickelt, das als U-Bahn losfährt und sich später in die Schräglage einer Standseilbahn neigt. Fünf in ein Rahmenwerk eingehängte Gondeln transportieren die Fahrgäste immer bequem in vertikaler Stellung (Bild 8).
Virtuos, aber wenig sensibel
Die vier Stationsbauten sprechen eine einheitliche und zusammenhängende Formensprache, die je nach Bauplatz und Höhenlage variiert – ein Anspruch, den bereits die alten Baumann’schen Bahnbauten einlösen. Die intendierte architektonische Anpassung gelingt Zaha Hadid indes nur bedingt. Zwar winden und verdrehen sich die amöbenförmigen Dächer, verkörpern Hadids «seamless fluidity» und zitieren aus dem Formenschatz von Gletschereisflächen. Doch sie sind weit mehr mit ihrer eigenen Virtuosität als mit dem tatsächlichen Umfeld beschäftigt.
Die Stationen weisen einen sauber ausgeführten Stahlbetonunterbau auf. Bei der Tal- und der Bergstation ist er in die Erde versenkt, beim Alpenzoo dagegen als spektakulärer Adlerhorst aufgerichtet, auf dem die fliessenden Formen der eisblau schimmernden Glasdächer aufbauen. Souverän geht Hadid mit dem grafischen System und seinen Möglichkeiten um; oft lässt sie dabei konkrete Nutzungsanforderungen bewusst ausser Acht, um sich genug Freiheit für völlig neue Raumkonzeptionen zu bewahren. Doch das Grid, welches das Koordinatensystem dieser freien Formen beschreibt, bildet sich auch als Stossfugen der Glasscheiben ab – und lässt mehr an Hürden denn an Grenzüberschreitungen denken. Bei der Eröffnung der Bahn waren die Unzulänglichkeiten in der Ausführung der Glashaut nicht zu übersehen; perfekt im Rechner generiert ist noch nicht perfekt gebaut. Gleichwohl herrscht in Innsbruck Schulterklopfen allerorten: Man spricht zwar noch nicht von einem «Zaha-Effekt», aber die Bemühungen, mit grossen Namen aus der ehemaligen Olympiastadt eine Architekturstadt zu machen, sind auf gutem Wege.TEC21, Di., 2008.03.25
25. März 2008 Eva Maria Froschauer
verknüpfte Bauwerke
Hungerburgbahn-Stationen