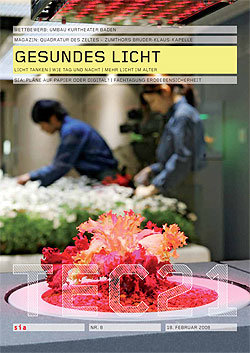Editorial
Edgar Allan Poe erzählt in «Die Maske des roten Todes»1, wie sich Prinz Prospero aus Angst vor dem Roten Tod in eines seiner Schlösser zurückzieht. Zur Ablenkung gestaltet Prospero dort sieben Festräume: «In jedem Zimmer ging zur Rechten und Linken jeder Wand ein hohes, schmales, gotisches Fenster auf einen geschlossenen Korridor hinaus, der den Windungen der Zimmerfl ucht folgt. Die Scheiben der Fenster waren aus buntem Glas, dessen Farbe mit derjenigen übereinstimmte, die in der Ausschmückung des Zimmers vorherrschte. Das Zimmer am östlichen Ende der Reihe war zum Beispiel in Blau gehalten, und dementsprechend strahlten auch die Fensterscheiben in funkelndem Blau. Das zweite Zimmer war mit purpurroten Wandbekleidungen und Zierraten ausgestattet, und auch die Scheiben waren purpurn – das dritte Gemach war ganz in Grün ausgestattet, und zauberhaftes grünes Licht ergoss sich durch seine Fenster. [...] In den Korridoren, welche die ganze Zimmerfl ucht umschlossen, stand jedem Fenster gegenüber ein massiver Dreifuss, in dem ein Kohlenfeuer loderte, das seine Flammen durch das bunte Glas in das Zimmer warf und ihm so eine glühende Helle und eine stets wechselnde, phantastische Beleuchtung mitteilte.»
Der Prinz erschuf also Lichträume, die in ihrer verschiedenen Farbigkeit die Wahrnehmung von Licht im Raum thematisierten. Heutzutage verfremden und verändern Architekten das Licht in Gebäuden. Das rein optische Erlebnis wurde aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse durch einen gesundheitlichen Aspekt ergänzt. Künstliches Licht beeinfl usst nicht nur Stimmungen, sondern wirkt auf den ganzen Menschen. Leuchtenhersteller und Forschungsinstitute entwickeln «biologisch-dynamische» Beleuchtungen, die sich in Lichtfarbe und -intensität verändern und so dem menschlichen Biorhythmus besser entsprechen sollen (Seite 20ff.). In der Planung und Gestaltung von Gebäuden spielt zunehmend die veränderliche Wahrnehmung von Licht eine Rolle (Seite 23ff.). Besonders bei der Lichtplanung für ältere Menschen erhöhen sich die Anforderungen. Spezielle Einbauten, zum Beispiel sehr intensive Lichtdecken, können helfen, den Wach-Schlaf-Rhythmus der Alten zu aktivieren (Seite 26ff.).
Kunstlicht kann (bisher) immer nur einen Teil des Sonnenlichts im Aussenraum wiedergeben und wirkt daher nicht auf die gleiche Weise wie natürliches Licht. Aber einzelne Aspekte des Naturlichts können heute schon simuliert werden – so werden Farmen wie «Pasona O2» (siehe Titelbild) geschaffen, bei denen es einen wohl noch mehr schaudert als Prinz Prospero am Ende von Poes Geschichte.
Katinka Corts
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Umbau Kurtheater Baden
10 MAGAZIN
Quadratur des Zeltes – Zumthors Bruder-
Klaus-Kapelle
20 LICHT TANKEN
Annette Vonder Mühll
Die Gotthardraststätte in Uri wurde mit einer neuartigen, «biologischdynamischen» Beleuchtung ausgestattet. Das Licht verändert entsprechend der Tageszeit seine Farbe und Intensität.
23 WIE TAG UND NACHT
Katinka Corts
Philippe Rahm integriert in seine Installationen und Projekte die Zeit und das Klima. Bei seinem Projekt «Split Time Café» beschäftigt er sich mit der Wirkung des Raumes bei unterschiedlichen Lichtfarben.
26 MEHR LICHT IM ALTER
Christoph Schierz
Die Bedürfnisse älterer Menschen nach mehr Licht werden häufig bei der Planung vernachlässigt. Dabei zeigt eine Studie in einem deutschen Altersheim, dass eine intensive blendfreie Beleuchtung das Sehen im Alter verbessern hilft.
31 SIA
Rekrutierungsmodell | Vernehmlassung Norm SIA 226-2 | Neue Publikationen | Pläne auf Papier oder digital? | Tagung Erdbebensicherheit
34 PRODUKTE
45 IMPRESSUM
46 VERANSTALTUNGEN
Licht tanken
Nach einer Autofahrt durch den Gotthardtunnel ist es erholsam, eine kurze Pause in angenehmer Atmosphäre einzulegen. Die Gotthardraststätte in Uri ist seit dem Umbau im Sommer 2007 mit einer neuartigen, «biologischdynamischen» Beleuchtung ausgestattet. Das Licht verändert sich im Laufe des Tages. Die Autofahrerinnen und Autofahrer sollen dadurch wacher
werden und sich rascher erholen.
Die Gotthardraststätte an der A2 bei Schattdorf, Uri, besteht seit 1980. Mit einem eingeladenen Wettbewerb der Gotthardraststätte AG wurden neue Ideen für eine Erweiterung gesucht. Es sollte ein neues und zeitgemässes Konzept umgesetzt werden, wobei nicht nur Shop und Restaurant vergrössert, sondern auch der Wohlfühl- und Erholaspekt bei einer Rast stärker gewichtet werden sollte. Das Architekturbüro Germann & Achermann aus Altdorf schlug einen hallenartigen Anbau an das bestehende Gebäude vor. Der neue Baukörper ist 72 m lang, im Schnitt etwa 11 m breit und bis zu 12.5 m hoch. Die Idee der Halle als Typus leiten die Architekten von anderen Einrichtungen ab, die uns vom Reisen bekannt sind, wie etwa Abfl ug- und Bahnhofshallen; von Orten also, an denen man als Reisender halten muss, die aber auch zum Wohlbefi nden beitragen. Die Aussenhülle des Neubaus ist in grossen Teilen mit Aluminiumschindeln überzogen. Im Inneren sind die Grosszügigkeit des Raumes und die Wärme der verwendeten Materialien angenehm – besonders nach der Enge der Tunnelröhre und des oberen Urner Reusstals.
Die neue Halle, die Eingangsbereich, Shop und einen grossen Teil des Restaurants aufnimmt, dockt an das bestehende Gebäude aus den 1980er-Jahren an und integriert dieses in das neue Raumkonzept. Die drei Nutzungen sind mit Schiebewänden voneinander abtrennbar, sodass sie je nach Saison, Tages- und Nachtzeit unterschiedlich kombiniert werden können. Das Selbstbedienungsbuffet und ein kleiner Teil des Restaurants befi nden sich im bestehenden Gebäude. Um eine ruhige Atmosphäre im Innenbereich zu schaffen, wählten die Architekten warm wirkende Materialien wie cremefarbiges Feinsteinzeug für die Böden und lasierte Täfer aus Buchenholz für Wände und Decke. Für einen besseren Schallschutz wurden die Holzplatten der Verkleidung gelocht.
Verbindendes Lichtband
Auch mit dem Lichtkonzept unterstreichen die Architekten die Hallenwirkung des Neubaus. Ein 64 m langes Lichtband zieht sich auf einer Höhe von 4.8 m durch Eingang, Shop und Restaurant und fasst so die Bereiche zu einer Einheit zusammen. Das Lichtband besteht aus drei Beleuchtungskomponenten mit verschiedenen Funktionen und beinhaltet die Lautsprecheranlage. Als Träger dient eine 1.2 m breite und 25 cm hohe Holzkonstruktion, die mit Stahlseilen an den Stahlträgern der Deckenkonstruktion verankert ist. Die Stromzuleitung an der Stirnseite des Bandes oberhalb des Shops dient zugleich der horizontalen Stabilisierung des Lichtbandes. In Richtung der Decke strahlt Fluoreszenzlicht, was die Höhe des Raumes unterstreicht. Nach unten wird der Gastraum hingegen durch diffus abstrahlende Lichtfelder und mit ausrichtbaren HIT-Strahlern (Halogenmetalldampf- Lampen) beleuchtet. Diese drei Beleuchtungsarten können separat gesteuert werden. Die diffusen Lichtfelder sind den drei Nutzungen entsprechend zudem in drei Schaltgruppen unterteilt. So kann in den Nachtstunden, in denen nur der Eingangsbereich geöffnet ist, die Beleuchtung auf diesen Bereich reduziert werden.
Auch im alten Gebäudeteil lenkt die Intensität der Beleuchtung den Gast durch den niedri - g eren Bereich des Selbstbedienungsbuffets. Hier sind die Tresen stirnseitig mit grossfl ächigen opaken Leuchtwänden versehen. Die Auslagen werden zusätzlich mit speziellen Hochleistungsstrahlern punktuell beleuchtet, um Raum und Produkte optisch zu trennen. Im neu gebauten Shopbereich, der ebenso vom Lichtband an der Decke beleuchtet wird, fälltdie Beleuchtungsstärke in den Randbereichen etwas ab, wodurch die Ware in den Regalen nicht immer optimal angeleuchtet werden kann. Die Absicht des Entwurfes ist, dass sich der Gast wohlfühlt.
Dem Tagesverlauf entlehnt
Zentral war die Idee, mit künstlicher Beleuchtung positive Lichtreize zu erzeugen und einen zeitlichen Rhythmus zu schaffen. Das Beleuchtungssystem wurde laut Hersteller unter anderem zusammen mit den Forschungsinstituten Spazio S.a.S. (Mailand), CNR (Nationales Forschungszentrum Rom) und dem Lighting Research Center des Rensselaer Polytechnic Institute in Troy (New York) entwickelt. Dabei wurden auch die psychologischen Auswirkungen von Licht berücksichtigt. Die diffusen Lichtfelder des Lichtbandes wurden so programmiert, dass sie sich nach einem zeitlichen Ablauf dynamisch verändern. «Biologisch- dynamisches» Licht wird dieses aktive Beleuchtungssystem vom Hersteller der Leuchte genannt. Im Laufe des Tages werden die Lichtstärke und die Lichttemperatur verändert, sodass sie dem Wandel des Farbspektrums des Sonnenlichts im Tagesablauf entsprechen. Mit laufenden Forschungsprojekten und Studien soll derzeit nachgewiesen werden, dass das auch eher dem Stoffwechsel der Menschen entspricht als eine immer gleiche Beleuchtung – und damit angeblich die Erholung beschleunigt (vgl. S.26 ff.). Am Morgen ist die Lichtintensität gering und die Farbtemperatur eher warm. Gegen Mittag erhöht sich die Intensität, während die Farbtemperatur kühler wird. Um die Mittagszeit wird die volle Stärke mit kühlem Licht erreicht. Gegen Abend wird das Licht wieder wärmer, angenehmer und weicher (Bilder 2–4).
Nach Sonnenuntergang beginnt in der Raststätte das Lichtspiel von Neuem; spät ankommende Gäste erleben so einen neuen «Sonnenaufgang», wobei der Körper das Signal «Wach werden!» erhalten soll. Lichtintensität und Farbtemperatur sind aber nicht vom Aussenlicht, sondern von der Tageszeit abhängig – und genau diese Gleichheit in Sommer 05 und Winter macht das Projekt nicht minergiefähig, denn sie bedingt den Bezug auf dieHelligkeit des Aussenraumes bei einem Projekt (siehe Kasten). Jedes Lichtfeld des Lichtbandes (Bild 5) beinhaltet sieben T16-Leuchtstoffl ampen à 54 W mit zwei unterschiedlichen Farbtemperaturen (4 × 6500 K und 3 × 2700 K). Durch diese Zusammensetzung der Lichtfarben kann ein dynamischer Verlauf von kaltweiss bis warmweiss gemischt werden. Die Steuerung funktioniert so, dass der mittlere Eingangsbereich mit dem 24-Stunden-Betrieb als Master dient, nach dem sich die beiden anderen Gruppen (Shop und Restaurant) richten. Alle 30 Sekunden wird ein Signal an den Master gesendet, der die Einstellung aktualisiert. Die Veränderung wird vom Auge des Betrachters nicht wahrgenommen. Die Gruppen Shop und Restaurant können vom Betreiber auch manuell verändert werden und bleiben dann statisch, bis sie wieder dem Master zugeordnet werden.
(K)ein Erfahrungsbericht
Die Verkäuferin an der Kasse im Shop arbeitet bis zu acht Stunden am Tag und hat bisher nicht bemerkt, dass sich das Licht dem Tagesrhythmus anpasst. Sie werde in Zukunft darauf achten, versichert sie. Ist das nun ein positives oder ein negatives Urteil? Soll man die Veränderung bemerken oder sich einfach nur wohl fühlen? Und würde sich die Verkäuferin bei statischem Licht unwohler fühlen? Die Antwort steht heute noch aus.
[ Annette Vonder Mühll, dipl. Designerin FH / dipl. Lichtdesignerin SLG ]TEC21, Mo., 2008.02.25
25. Februar 2008 Annette Vonder Mühll
Wie Tag und Nacht
Physiologische Aspekte stehen im Zentrum des Interesses des schweizerischfranzösischen Architekten und Künstlers Philippe Rahm. In seine Installationen und Projekte integriert er die Zeit und das Klima und passt beides den Bedürfnissen der Nutzer an. Eines seiner aktuellen Projekte beschäftigt sich mit der Auswirkung des Raumes bei unterschiedlichem Licht.
Viele Projekte von Philippe Rahm, der bis 2004 mit Jean-Gilles Décosterd zusammengearbeitet hat, drehen sich um Klima- und Lichträume – so etwa der Biennale-Beitrag «Hormo nium» von 2002 oder die Installation «Melatonin Room» zwei Jahre zuvor (vgl. TEC21 Nr. 36/2002 und 43/2004). Ein aktuelles Projekt Rahms, das seit 2007 besteht, ist ein Café, in dem die Wahrnehmung des Gastes über die physiologischen Wirkungen von Licht gezielt manipuliert werden soll. Ein blau verglaster Raum soll den Tag, ein gelb verglaster Bereich des Cafés die Nacht simulieren. Das Gebäude wird in das Fabric Outlet Center (FOC) im Schlosspark Eybesfeld im österreichischen Jöss, südlich von Graz, integriert.
Shoppen im Schlosspark
Nach dem Kauf der sanierungsbedürftigen Schlossanlage mit grossem Park entschloss sich die Bauherrschaft, die Restaurierung und Renovation gemeinsam mit verschiedenen Künstlern und Landschaftsgestaltern in Angriff zu nehmen. Das entwickelte Konzept sieht vor, wichtige historische Teile und Anlagen des Schlosses zu restaurierten; in anderen Bereichen des 70 ha grossen Geländes sollen zeitgenössische Kunst, Architektur und Landschaftsgestaltung Raum erhalten. Auf dem Gelände sollte neben temporärer Kunst und der sich verändernden Landschaft auch ein statischer Bereich entstehen. So wurden auf den Ländereien von Eybesfeld neue Gewerbefl ächen ausgewiesen, ein Fabric Outlet Center (FOC) sollte Mittelpunkt der neuen Anlage werden und auch die umgebende Landschaft nachhaltig verändern. Denn das Gut liegt an einer alten Handelsroute in einer Hügellandschaft und ist auch heute gut an Infrastrukturen wie Autobahn und Schnellstrassen angebunden. In der Umgebung befi nden sich neben Nutzwäldern, kleinen Städtchen und Dörfern auch grosse Gewerbegebiete. Die Landschaft um das Schloss erscheint heute nicht mehr als Einheit, sondern als Collage vieler kleiner Teile, denen die grossräumigen Beziehungen fehlen. Künstler und Bauherrschaft beschäftigten sich deshalb mit der Frage, inwieweit eine neue, die Einzelteile fassende Struktur auf dem Schlossareal umgesetzt werden könnte. In einem Masterplan entwickelten die Wiener Architekten BEHF ein räumlich übergeordnetes Landschaftskonzept, das das FOC in die Umgebung einbinden und ein räumliches Gesamtkunstwerk schaffen soll. Die Einkaufsmeile liegt im Zentrum der Gesamtplanung und nimmt im Masterplan eine Schlüsselposition ein. Alle Geschäfte gruppieren sich um einen zeitgenössisch gestalteten Garten. In diesem werden Kunst- und Raumobjekte die Kundschaft zum Verweilen einladen. Das Verkaufsareal wird von grünen Adern durchzogen, die einen Bezug zur umgebenden Landschaft schaffen und die Anlage mit dem Schlosspark und den umgebenden Wäldern verbinden.
«Split Time Café»
In diesem zentralen Garten soll auch das «Split Time Café» von Philippe Rahm eingebettet werden. Es ist in drei voneinander abgeschottete Bereiche unterteilt, jeder davon in ein eigenes Licht getaucht. Das soll bei den Gästen unterschiedliche Stimmungen wecken und verschiedene Wachheitsgrade verursachen. Die Gestaltung der Räume basiert auch auf neueren Erkenntnissen über die innere biologische Uhr des Menschen, seine Aktivierung mit Licht und den Melatoninhaushalt. Dieses im Gehirn produzierte Hormon wirkt schlaffördernd und ist für den Tag-Nacht-Rhythmus wichtig. Seine Ausschüttung wird durch die biologische Uhr und durch Licht gesteuert. Dabei, so fanden Wissenschafter heraus, reagiert dermenschliche Körper bei der Aktivierung mit Licht sehr stark auf die blaugrüne Region des Lichtspektrums (Strahlung zwischen 400 und 500 nm).
Mit Gelborange-Filtern, die nur das blaugrüne Spektrum des Lichtes blockieren, könnten also Räume geschaffen werden, in denen die Aktivierung des Körpers gedämpft wird. In dieser künstlich geschaffenen Nacht würden Menschen schneller müde werden.1 Als Gegenstück dazu könnte ein Glas mit Blaugrün-Filtern, das gelborangefarbenes Licht blockiert, die Aktivierung erhöhen und die Menschen im Raum wach halten. Im «Split Time Café» betritt der Gast zunächst einen Vorraum, der ihn in den grösseren Hauptraum führt. Die Fassade ist hier aus klarem, farblosem Glas und lässt das natürliche, reine Tageslicht ungefi ltert in den Innenraum: Der Gast erlebt in Echtzeit den Tagesverlauf, Witterung, Bewölkung und Besonnung und die natürliche Zu- und Abnahme der Lichtintensität. Möbliert ist der Raum wie ein traditionelles Café mit Tischen und Stühlen. Vom Hauptraum aus erreicht man den Tag- und den Nachtbereich. Der Tagbereich ist umgeben von blau eingefärbtem oder beschichtetem Glas. Hier wird der ewige Tag simuliert. Als Einrichtung sind bislang nur hohe Tische geplant, an denen die Kundschaft steht. Der zweite Raum ist gelb verglast. Hier wird am helllichten Tag eine physiologische Nacht erzeugt, obwohl der Raum hell erleuchtet ist. Die Möblierung soll entsprechend der empfundenen Tageszeit eher an eine Lounge erinnern. Bei Dunkelheit und im lichtärmeren Winter sollen die blaue und die gelbe Stimmung in den Räumen durch künstliche Leuchten erzeugt werden. Die Architektur gestaltet hier nicht mehr vordergründig den Raum, sondern dient vielmehr als Fassung für Zeit – sie konstruiert Tag und Nacht. Die Architektur wird zur Zeitmaschine.TEC21, Mo., 2008.02.25
Anmerkungen
[1] A. Sasseville, N. Paquet, J. Sévign und M. Hébert, Laval University, Laval-CHUL Research Centre, Quebec City, Kanada 04 05 06
25. Februar 2008 Katinka Corts-Münzner